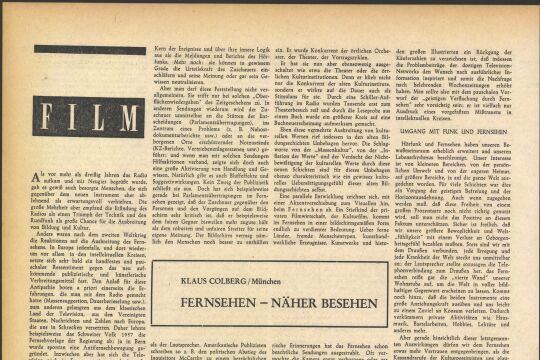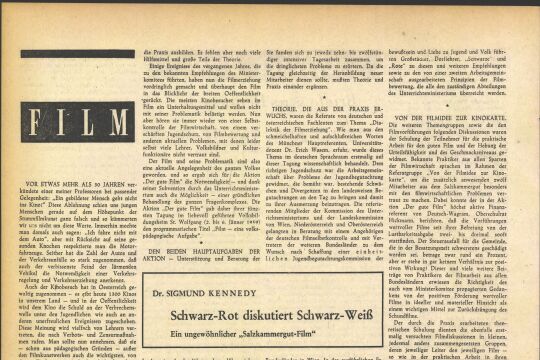Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hörer sollen Programm machen
„Hörer machen Programm“. Zu diesem Thema trafen sich Rundfunkmacher und -Kritiker beim diesjährigen „Hörfunkgespräch“ in Baden-Baden, einer Art Hörfunkmesse, die das Frankfurter Gemeinschaftswerk evangelischer Publizistik alljährlich veranstaltet.
„Hörer machen Programm“. Zu diesem Thema trafen sich Rundfunkmacher und -Kritiker beim diesjährigen „Hörfunkgespräch“ in Baden-Baden, einer Art Hörfunkmesse, die das Frankfurter Gemeinschaftswerk evangelischer Publizistik alljährlich veranstaltet.
Unerwartet zahlreich die Beteiligung — fast hundert Fachleute — und damit Indiz für die Aktualität der Fragestellung. Partizipative Programme, also solche, in denen Hörer aktiv mitgestalten, gehören seit einigen Jahren zu den Lieblingskindern der Programmacher. Oder aber sie wirken, für die anderen, wie ein rotes Tuch: auf jeden Fall ein Thema, zu dem man Stellung bezieht. Sendungen mit Hörerbeteiligung werden entweder zur Heilslehre hochstilisiert oder zum modischen Unsinn degradiert
Zunächst einmal ist es notwendig, den Begriff „Hörerbeteiligung“ zu klären. Denn es ist eine Sache, ein Wunschkonzert über den Äther zu schicken, und eine andere, eine ganze Sendereihe einer Hörergruppe in voller Verantwortung zu überlassen. Gleich vorweg: diese letztere Art von Partizipation gibt es im deutschsprachigen Raum nirgends, organisatorische, aber auch juristische Bedenken und Schwierigkeiten haben ihre Einführung bisher verhindert.
Und selbst eine solche, voll vom Publikum getragene Reihe würde, obwohl schon utopisch, doch dem utopischen Anspruch des Tagungsthemas nicht entsprechen: denn einzelne Sendungen zu machen, ist etwas ganz anderes, als „Programm machen“. Verantwortlich sind doch immer die Redakteure; sie kontrollieren die Art der Beteiligung; ihre Länge, ihre Diktion, ihre Färbung und Intensität bestimmt der Redakteur. Er ist der „goal-keeper“ und läßt herein, was ihm wünschenswert erscheint.
Diese goal-keeper-Position kann ideologisch fixierten Medienkritikern gegen den Strich laufen, weil der Bürger damit in seinen Möglichkeiten eingeschränkt wird — ich halte sie für sehr nützlich. Immerhin ist auch Hörfunk-Machen ein Beruf, wertn auch ein erst sehr junger und daher noch flexibler; und in gewisser Weise sind Vergleiche mit dem Bäcker, der seine Semmeln nicht von den Kunden backen läßt, sondern nach seinen eigenen Rezepten knetet, nicht ganz von der Hand zu weisen. Sendungen machen ist ein Handwerk, und es will gelernt sein.
Der Unterschied zum sonstigen Handwerker besteht vor allem darin, daß das auf Kommunikation bedachte Massenmedium diese Kommunikation mit weniger Rückendeckung betreibt als unser Bäckermeister. Denn der Bäcker hört von seinen Kunden, ob seine Ingredenzien und Backtemperaturen ein ihm genehmes Produkt ergeben; der Hörfunkmacher spürt von Reaktionen sehr wenig. Sie beschränken sich oft auf telephonische Verbalinjurien — und auf die höchst problematischen Auswertungen von Einschaltziffern. Die letzteren könnte man hinterlistigerweise als „Hörer machen Programm“ bezeichnen, denn die regelmäßigen Umfragen beeinflussen zumindest die Einschätzung bestimmter Sendungen seitens der Hörfunkmanager und damit ihr Gewicht im Programm. Eine solche Hörerbeteiligung Im Sinne eines Plebiszits könnte, konsequent durchgeführt, nur die katastrophale Niveaulosigkeit der Programme zur Folge haben.
Hörer machen Programm — das kann also nur meinen: Hörergruppen machen Programm. Tatsächlich bewährt sich das Modell dort am besten, wo Sendungen für ganz bestimmte Rezipienten konzipiert werden. Also etwa die verschiedenen Arten von Seniorenclubs via Radio — wenn dort Senioren mitbestimmen, zu Wort kommen, gefragt werden, dann kann das der Sendung nur nützen. Sie kann damit sprachlich, formal und inhaltlich auf ihre Zielgruppe eingehen und optimal befriedigen. Ähnliches gilt von Jugendsendungen, der neuen Hörfunkserie „Eltern raten Eltern“ und ähnlichem.
Bei solchen, von Thema und Interessenten eingegrenzten Sendungen, vermeidet man auch eine sonst nicht nur latent, sondern höchst augenscheinlich zutage tretende Schwäche partizipativer Sendungen: daß der Laie oft wesentlich weniger redegewandt, weniger gut informiert, weniger mutig ist als der Spezialist, mit dem er konfrontiert wird. Dies erlebt man immer wieder, wenn Politiker sich in Fragestunden (angeblich) kritisieren lassen wollen: der Politiker, der Fachmann überrundet den Laien kraft seiner 'WJendigkeit. Da ist es oft günstiger, der Journalist macht sich zum Anwalt seiner Hörer und vertritt selbst den Standpunkt derer, die als namen- oder sprachlos gelten.
Spätestens bei diesem Stand der Diskussion teilt sich die Fachwelt in zwei Lager: in jene, die vor allem die sozial Unterprivilegierten zum Zug kommen lassen wollen, und in jene, die eine neue Art von Unterprivilegierten am Horizont aufsteigen sehen: die kulturell und künstlerisch Anspruchsvollen. Auch sie gehören beim Infratest ganz eindeutig zu den Minderheiten, und manche Redaktion hat bereits mit der Idee geliebäugelt, die hörerschwachen Sendungen budgetär und sendezeitmäßig zu reduzieren. Dies betrifft in einigen bundesdeutschen Anstalten sehr konkret die Hörspielabteilungen, dies hegt aber auch der neuesten österreichischen Gerüchtewelle über mögliche Beschränkung von ö 1 zugrunde. Tatsächlich aber sollten sie, die durch ideologische und generationsbedingte Schranken getrennten Minderheiten, an einem Strang ziehen: Partizipation auch in den kreativen Sendeformen, nicht nur dort, wo es um politisches Engagement, Aufklärung und Transparenz geht.
Etliche Beispiele für rein kreative Höreraktivitäten gibt es bereits. Sowohl die „Amateurhörspiele“ des saarländischen Rundfunks, als auch die mit Schülern erarbeiteten „Hörstücke aus dem Jahr 2001“ beim hessischen Rundfunk sind hörfunkeigenen Produktionen durchaus ebenbürtig. Obwohl auch diese Qualifizierung problematisch ist: soll ein Amateurhörspiel denn ein Abklatsch des offiziellen Programms sein?
Hörerbeteiligung, und hier schließe ich mich den Ansichten von Manfred Linz (NDR) an, ist dann sinnvoll, wenn sie zwei Komponenten einbringt, die der „Normalbürger“ dem Funkjournalisten voraus hat — seine spezifische Sprache und seine spezifischen Erfahrungen. Aber dies nicht nur auf eine Hörerschicht eingeengt. Solchermaßen könnte der Hörfunk von seinem Image als Einweg-Weg-werf-Kommunikationslieferant wegkommen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!