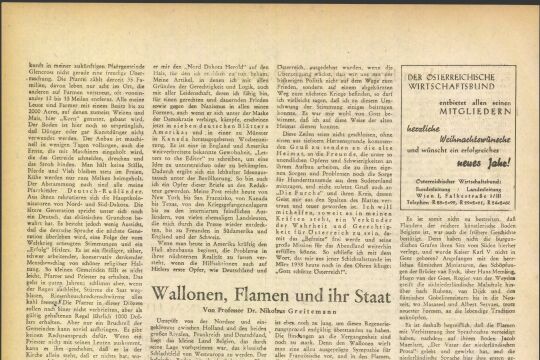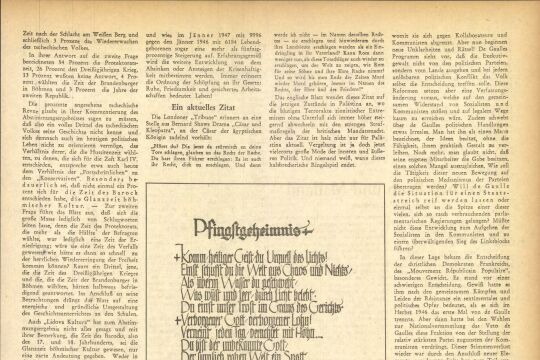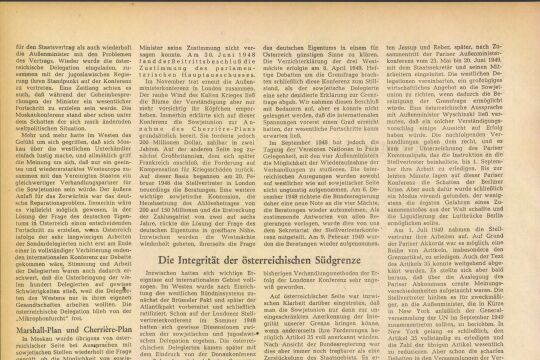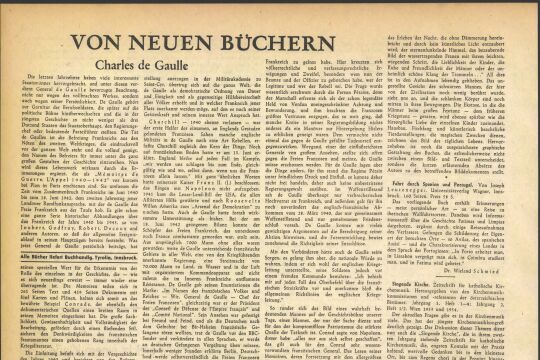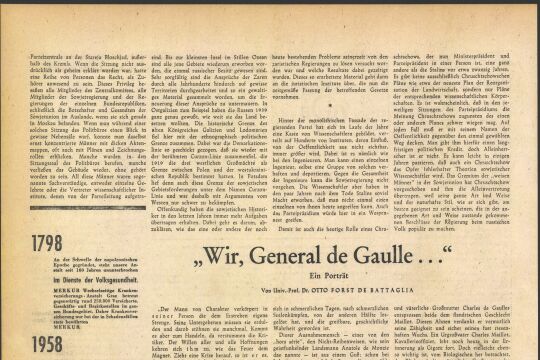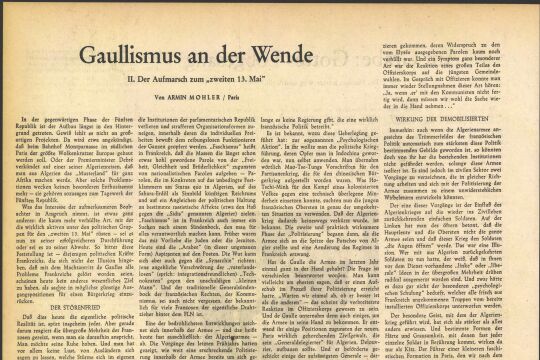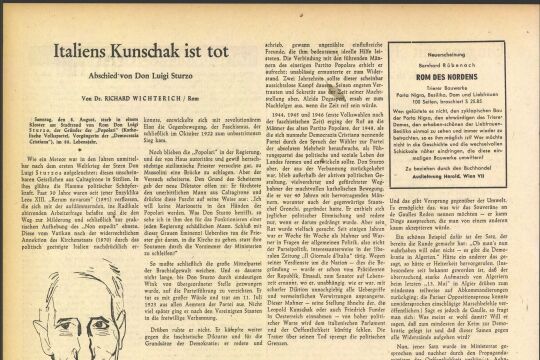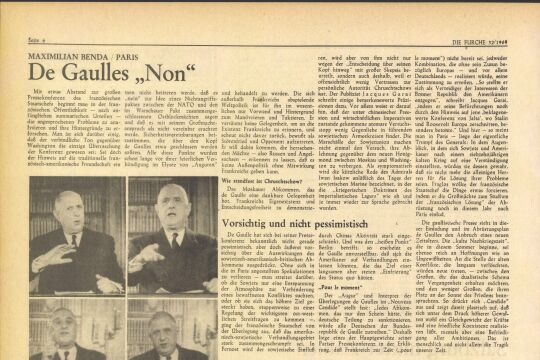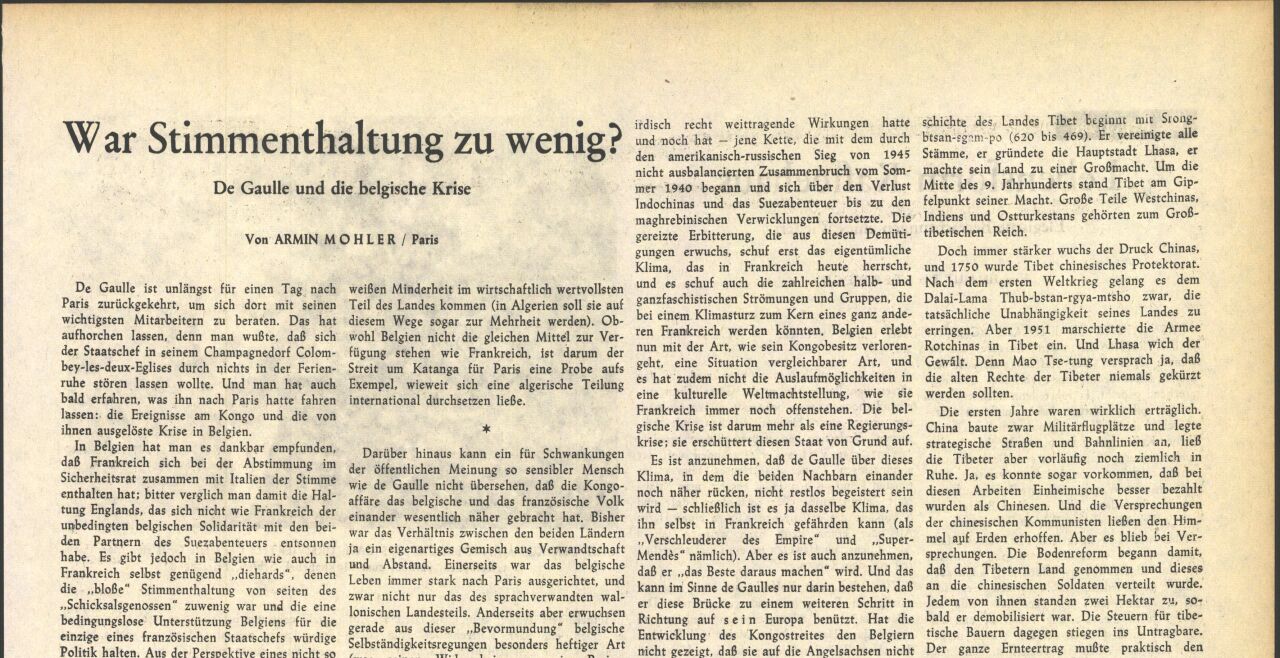
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
War Stimmenthaltung zu wenig?
De Gaulle ist unlängst für einen Tag nach Paris zurückgekehrt, um sich dort mit seinen wichtigsten Mitarbeitern zu beraten. Das hat aufhorchen lassen, denn man wußte, daß sich der Staatschef in seinem Champagnedorf Colom-bey-les-deux-Eglises durch nichts in der Ferienruhe stören lassen wollte. Und man hat auch bald erfahren, was ihn nach Paris hatte fahren lassen: die Ereignisse am Kongo und die von ihnen ausgelöste Krise in Belgien.
In Belgien hat man es dankbar empfunden, daß Frankreich sich bei der Abstimmung im Sicherheitsrat zusammen mit Italien der Stimme enthalten hat; bitter verglich man damit die Haltung Englands, das sich nicht wie Frankreich der unbedingten belgischen Solidarität mit den beiden Partnern des Suezabenteuers entsonnen habe. Es gibt jedoch in Belgien wie auch in Frankreich selbst genügend „diehards“, denen die „bloße“ Stimmenthaltung von seifen des „Schicksalsgenossen“ zuwenig war und die eine bedingungslose Unterstützung Belgiens für die einzige eines französischen Staatschefs würdige Politik halten. Aus der Perspektive eines nicht so unmittelbar und damit auch nicht so gefühlsmäßig beteiligten Beobachters allerdings muß man feststellen, daß die zögernde Stimmenthaltung der Position de Gaulles genau entsprach: für ihn gibt es fast ebensoviel Motive, die ihn heute an Belgiens Seite drängen, wie solche, die ihn von dem sprachverwandten Bruder trennen.
Zu Beginn der Wirren am Kongo hat de Gaulle Belgien sogar offen kritisiert. Denn nur als eine Kritik an der belgischen Kolonisation konnte, die wohlgefällige Art verstanden werden, mit der de Gaulle damals auf seiner Reise durch die Normandie feststellte, wie glücklich sich die friedliche Entlassung der ehemals französischen Republiken südlich der Sahara in die Unabhängigkeit vom Ende der belgischen Herrschaft am Konge abhebe. Nach anfänglichem Zögern, das mit an der dem Westen.: so feindlichen ^Haltung Guineas schuld is^, j|h^tgs^ch jäffc französische Staatschef ja erstaunlich schnell in einen erstaunlich radikalen Verfechter der „Dekoloni-sation“ verwandelt: In für Frankreich revolutionärer Weise auf juristische Sicherungen verzichtend, hat er die Staaten der kurzlebigen „Com-munaute“ mit einer Selbstverständlichkeit in die völlige Unabhängigkeit entlassen, welche die afrikanischen Politiker überraschte und die französischen Kolonialisten erbitterte. De Gaulle hofft offensichtlich, daß das, was das französische Kolonialreich in die Luft sprengte, sich nun als dauerhafter Kitt für ein dauerndes Freundschaftsverhältnis Frankreichs mit den zehn jungen Republiken erweisen werde. Die afrikanischen Eliten, die Frankreich — im Gegensatz zu Belgien — in seinem Machtbereich herangezogen hat, sogen in Paris die Parolen der Französischen Revolution von der Freiheit — Gleichheit — Brüderlichkeit und von der Selbstbestimmung der Völker ein; kein Wunder, daß sie sie auch auf sich selbst angewendet sehen wollten. De Gaulle scheint nun darauf zu vertrauen, daß jene Afrikaner, sich daran erinnern, daß ihre Ideen aus dem Quartier Latin stammen; er baut offensichtlich auf die alte Rolle von Paris als „Hauptstadt der Zivilisation“ und hält ihre Anziehungskraft auf die Dauer doch für stärker als die der Zentren des Stachanowismus in Ost und West.
Von seiner Politik im „schwarzen Afrika“ her müßte also de Gaulles Option im Streit um die belgische Erbfolge eindeutig sein. Schließlich ist das Experiment Katanga nichts anderes als das, was in der verblichenen „Communaute“ so schnell Schiffbruch erlitten hat: nämlich der Versuch, hinter der Fassade einer Scheinunabhängigkeit die alten Machtverhältnisse unverändert weiterbestehen zu lassen. Aber die Option kann nicht eindeutig sein, weil auch Frankreichs Afrikapolitik nicht eindeutig ist. Immerhin gehört auch Algerien zu Afrika, und dort gilt bekanntlich eine andere Politik als südlich der Sahara.
Von Algerien her gesehen ist die belgische Kongopolitik für de Gaulle ein ihn unmittelbar berührender Test. Der General hat kein Hehl daraus gemacht, daß er für Algerien eine Ausweichlösung bereit hat, wenn es nicht zu einer Einigung mit dem FLN kommt: nach palästinensischem Muster soll dann das Land zwischen den Kriegsparteien geteilt werden. Und wie in Katanga soll es dabei zu einer Konzentration der weißen Minderheit im wirtschaftlich wertvollsten Teil des Landes kommen (in Algerien soll sie auf diesem Wege sogar zur Mehrheit werden). Obwohl Belgien nicht die gleichen Mitte“! zur Verfügung stehen wie Frankreich, ist darum der Streit um Katanga für Paris eine Probe aufs Exempel, wieweit sich eine algerische Teilung international durchsetzen ließe.
Darüber hinaus kann ein für Schwankungen der öffentlichen Meinung so sensibler Mensch wie de Gaulle nicht übersehen, daß die Kongoaffäre das belgische und das französische Volk einander wesentlich näher gebracht hat. Bisher war das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ja ein eigenartiges Gemisch aus Verwandtschaft und Abstand. Einerseits war das belgische Leben immer stark nach Paris ausgerichtet, und zwar nicht nur das des sprachverwandten wallonischen Landesteils. Anderseits aber erwuchsen gerade aus dieser „Bevormundung“ belgische Selbständigkeitsregungen besonders heftiger Art (was seinen Widerschein sogar im Pariser Boulevardschwank findet, wo der Onkel aus Belgien die störrisch-komische Figur ist). Es ist möglich, daß die Kongoaffäre hier die Akzente neu setzt, weil sie die Schicksalsgemeinschaft zwischen den beiden Ländern verstärkt.
Die Kenner der französischen Psyche sind sich ziemlich darüber einig, daß die Kette von Demütigungen, welche Frankreich in den letzten zwanzig Jahren hat einstecken müssen, unterirdisch recht weittragende Wirkungen hatte und noch hat — jene Kette, die mit dem durch den amerikanisch-russischen Sieg von 1945 nicht ausbalancierten Zusammenbruch vom Sommer 1940 begann und sich über den Verlust Indochinas und das Suezabenteuer bis zu den maghrebinischen Verwicklungen fortsetzte. Die gereizte Erbitterung, die aus diesen Demütigungen erwuchs, schuf erst das eigentümliche Klima, das in Frankreich heute herrscht, und es schuf auch die zahlreichen halb- und ganzfaschistischen Strömungen und Gruppen, die bei einem Klimasturz zum Kern eines ganz anderen Frankreich werden könnten. Belgien erlebt nun mit der Art, wie sein Kongobesitz verlorengeht, eine Situation vergleichbarer Art, und es hat zudem nicht die Auslaufmöglichkeiten in eine kulturelle Weltmachtstellung, wie sie Frankreich immer noch offenstehen. Die belgische Krise ist darum mehr als eine Regierungskrise; sie erschüttert diesen Staat von Grund auf.
Es ist anzunehmen, daß de Gaulle über dieses Klima, in dem die beiden Nachbarn einander noch näher rücken, nicht restlos begeistert sein wird — schließlich ist es ja dasselbe Klima, das ihn selbst in Frankreich gefährden kann (als „Verschleuderer des Empire“ und „Super-Mendes“ nämlich). Aber es ist auch anzunehmen, daß er „das Beste daraus machen“ wird. Und das kann im Sinne de Gaulles nur darin bestehen, daß er diese Brücke zu einem weiteren Schritt in Richtung auf sein Europa benützt. Hat die Entwicklung des Kongostreites den Belgiern nicht gezeigt, daß sie auf die Angelsachsen nicht zählen können und nur für die „Festlandnationen“ Frankreich und Italien (Deutschland kam durch sein Nichtvorhandensein in UNO und Sicherheitsrat um die peinliche Entscheidung herum) die Solidarität unter (Nato-) Verbündeten noch gilt? So sieht es zumindest von gaullistischer Warte aus. Aber es fragt sich, ob man jeden sich anbietenden Antrieb zu einer Europakonstruktion, um welchen Preis auch immer, benützen soll.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!