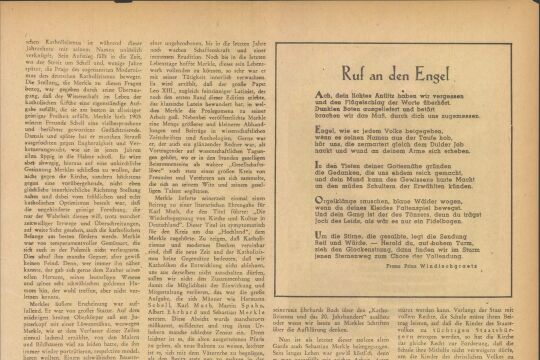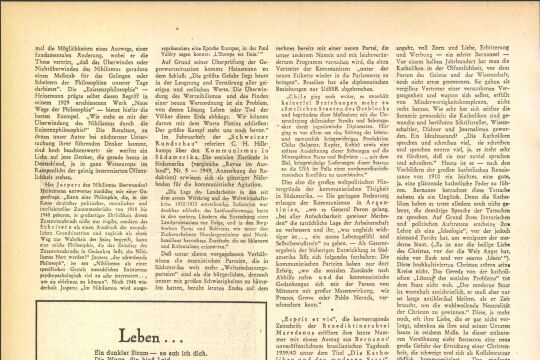Seit nahezu 50 Jahren vom Staate voll anerkannt, jedem im Arbeitsleben Stehenden bestens vertraut, ist der Kollektivvertrag keineswegs so problemlos, wie es den meisten scheint. Seine faktische Bewährungsprobe hat er freilich in Jahrzehnten bestanden. Sein Erfolg rührt daher, daß er kein Geschöpf der grauen Theorie ist, sondern sich zunächst neben dem Gesetz in der gesellschaftlichen Wirklichkeit des aus klingenden 19. Jahrhunderts seinen Weg bahnen mußte. Das rechtlich Neue am Kollektivvertrag ist der Umstand, daß zwei Parteien (in der Regel ein Arbeitgeber- und ein Arbeitnehmerverband) einen Vertrag schließen, dessen wesentlicher Inhalt sich nicht an dile vertragsschließenden Verbände selbst, sondern an am Vertragsschluß unbeteiligte Personen — die einzelnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer — richtet.
Unabdingbarkeit des Kollektivvertrages
Die im Kollektivvertrag vereinbarten Mindestlöhne, Urlaubsbestimmungen, Kündigungsfristen und dergleichen sollen nach der Absicht der Kollektivvertragsparteien Inhalt der einzelnen Arbeitsverträge werden. Das Vertragsrecht des bürgerlichen Gesetzbuches reicht zur Begründung solcher „Drittbestim- mung“ freilich nicht aus, weshalb die Einhaltung dieser Bestimmungen in der Frühzeit des Kollektivvertrages nur indirekt erzwungen werden konnte: Dnie abschließenden Verbände verpflichteten sich, auf ihre Mitglieder einzuwirken, den Kollektivvertrag durchzuführen. Nur mittels der „Einwirkungspflicht“ und „Durchführungspflicht“ der Verbände war der Kollektivvertrag also rechtlich zu realisieren.
Als die sozialreformatorische
Welle in der jungen Republik Österreich ihren Höhepunkt erreicht hatte, nahm sich auch der Gesetzgeber dies Kollekitiiwentrages an und verlieh ihm jenes Attribut, das uns heute selbstverständlich ist, damals aber eine juristische Neuschöpfung ersten Ranges war: die Unabdingbarkeit. Seit 1920 stellen die Kollektivvertragsbestimmungen daher — ähnlich wie ein Gesetz — einen sozialen Mindestschutz der Arbeitnehmer dar, der durch Einzelarbeitsvertrag nicht angetastet werden kann. An die Stelle des Aushandelns der Arbeitsbedingungen durch Individuen trat nun allgemein das Aushandeln auf kollektiver Ebene durch die Verbände — die soziale Autonomie der Verbände war legalisiert. Der Kollektivvertrag sollte infolge des Verhandlungsgleichgewichtes der Verbände gerechtere Ergebnisse als Einzelarbeitsverträge erzielen, eine Friedensordnung etablieren und kraft seiner „Kartellwirkung“ einheitliche Branchenarbeitsbedingungen schaffen, woran auch die Arbeitgeber interessiert waren.
Ist der Kollektivvertrag verfassungswidrig?
Der Umstand, daß nunmehr die Verbände „Recht“ erzeugten, das in seinen Wirkungen dem staatlichen nicht nachstand, erregte 1923 verfassungsrechtliche Bedenken bei Hans Dechant, der sich allerdings damit bei den Schöpfern der österreichischen Verfassung nicht durchsetzen konnte. Die verfassungsrechtliche Problematik des Kollektivvertrages wird erst seit einem aufsehenerregenden Vortrag von Hans Klecatsky im Jahre 1963 eingehend diskutiert. Klecatsky ging mit der herrschenden Lehre vom Rechtsetzungsmonopol des Staates aus und gelangte damit zu dem Schluß, daß die österreichische Verfassung die Setzung allgemeiner Rechtssätze nur in den Formen des Gesetzes und der Verordnung zulasse. Da der Kollektivvertrag unbestritten kein Gesetz ist, könne er — sofern er überhaupt mit der Verfassung vereinbar sein soll — nur als (staatliche) Verordnung gedeutet werden. Selbst in dieser Sicht verstoße der Kollektivvertrag aber gegen die Verfassung, weil jede staatliche Verordnung nur die Grundgedanken im Detail ausführen dürfe, es aber keinerlei gesetzliche Richtlinien für die inhaltliche Ausgestaltung des Kollektivvertrages gäbe. Zur Sanierung schlägt Klecatsky die Bildung eines Verbänderates als zweite oder dritte Kammer des Parlamentes vor, die als echtes Gesetzgebungsorgan dem Kollektivvertrag die fehlende Legitimität geben könne.
Die Judikatur hat diese Bedenken bisher nicht aufgegriffen. Der Oberste Gerichtshof hat sie erst jüngst verworfen, allerdings ohne nähere Begründung. In einem älteren Erkenntnis aus dem Jahre 1952
hatte der Verfassungsgerichtshof keine verfassungsrechtlichen Zweifel geäußert und den Kollektivvertrag ausdrücklich staatlichen Verordnungen als etwas Eigenständiges gegenübergestellt. Die wissenschaftliche Diskussion hat bisher weder zweifelsfrei die Verfassungsgemäßheit noch die Verfassungswidrigkeit belegen können. Allgemeine Überzeugung ist aber, daß eine einwandfreie verfassungsrechtliche Fundierung dies Kallektiwertrages wünschenswert wäre, nicht zuletzt deshalb, weil sich Österreich auch durch internationale Übereinkommen gebunden hat, die soziale Autonomie der Berufsverbände zu garantieren. Es stsht au erwarten, diaß diese Frage anläßlich der bevorstehenden Grundredl tsreform beziehungsweise im Zuge der Arbeitsrechtskodiflka- tion eine Klärung finden wird.
Wer sind die Partner?
Der zunächst vielleicht nicht klar erkennbare Konnex des Kollektivvertrages zu den Grundrechten ergibt sich daraus, daß seit geraumer Zeit auch sogenannte soziale Grundrechte diskutiert werden, zu denen neben dem jedem Individuum zustehenden Koalitionsrecht auch Grundrechte der Vereinigungen selbst gerechnet werden. So haben in Deutschland Rechtsprechung und Lehre aus dem in Artikel 9 Absatz 3 des Bonner Grundgesetzes verankerten Koalitionsrecht im Laufe der Zeit auch Grundrechte der Koalitionen (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände) abgeleitet, darunter auch das Recht zum Kollektivvertragsabschluß. Auch die — von Österreich bisher nicht ratifizierte — Europäische Sozialcharta sieht ein solches Recht der Verbände zum Kollektivvertragsabschluß vor.
Für Österreich ist die verfassungsrechtliche Verankerung der Kollektivverträge im Wege des Koalitionsrechtes allerdings infolge einer spezifischen Eigenart der österreichi schen Kollektivverträge ohne wesentliche Rechtsänderungen nicht möglich. Das Koalitionsrecht garantiert den freien Entschluß des einzelnen, einer Berufsvereinigung beizutreten oder dieser fernzubleiben; es bezieht sich daher auf frei gebildete Vereinigungen. Das österreichische Recht hat aber die Kollektivvertragsbefugnis in erster Linie den gesetzlichen Interessenvertretungen (Kammern), die sich durch Pfiicht- mitgliedschaft auszeichnen, zuerkannt. Nur dann, wenn frei gebildete Vereinigungen gewisse Voraussetzungen (wie entsprechender Repräsentationsgrad und wirtschaftliche Bedeutung) erfüllen, haben sie Anspruch auf Zuerkennung der Kol- lektiwertragsfähigkeit.
In der Wirkung herrscht aber das Subsidiaritätsprinzip: schließt ein freier Verband tatsächlich einen Kollektivvertrag ab, so entzieht er damit insoweit der Kammer die Kollektivvertragsfähigkeit — wie dies der österreichische Gewerkschaftsbund gegenüber den Arbeiterkammern auf breiter Front getan hat. Auf Arbeitgeberseite sind dagegen die bedeutendsten Kollektivvertragspartner die Handelskammern, da nur wenige der vielen bestehenden freien Untemehmerver- bände auf eigene Kollektivvertragsfähigkeit Wert legten. Wollte man also den Kollektiwerträgen über das Koalitionsrecht eine verfassungsrechtliche Grundlage verleihen, so könnte das nur bezüglich freier Verbände, nicht aber auch hinsichtlich der Kammern geschehen.
Die problematische Außenseiterwirkung
Eine zweite verfassungsrechtliche Schwierigkeit bereitet eine andere österreichische Besonderheit des Kollektivvertragsrechtes. Wie in den übrigen Staaten bezog sich der Geltungsbereich eines Kollektivvertrages ursprünglich nur auf die Mitglieder der vertragschließenden Verbände. Als Folge stellte sich das sogenannte Außenseiterproblem ein. Kollektiwertragliche Lohnerhöhungen erfaßten etwa nur die Mitglieder der abschließenden Gewerkschaft, nicht aber die Außenseiter, also die Mitglieder rivalisierender Gewerkschaften (die wir bis 1934 auch in Österreich hatten) oder nichtorganisierte Arbeitnehmer. Ein Zustand, der noch heute in der Bundesrepublik Deutschland geltendes Recht ist.
Demgegenüber bezog schon das Kollektivvertragsgesetz von 1919 die
Außenseiter in den Geltungsbereich des Kollektivvertrages ein; solange es rivalisierende Gewerkschaften gab, konnten dadurch allerdings auch die Mitglieder der mehrheitlich in einem Betrieb vertretenen Gewerkschaft dem Kollektivvertrag einer betrieblichen Minderheitsgewerkschaft unterworfen werden. 1930 gab man daher dieser Mehrheit des Betriebes das Recht, sich von einem solchen Kollektivvertrag zu distanzieren. Die nach 1945 erfolgte Bildung einer österreichischen Einheitsgewerkschaft ließ das Problem der rivalisierenden Gewerkschaften als wenig dringlich erscheinen, weshalb es der Gesetzgeber offen ließ. Die Außenseiterwirkung nahm er dagegen erneut auf und ordnete innerhalb des Betriebes die völlige Gleichstellung aller Gewerkschaftsund Nichtgewerkschaftsmitglieder an. Diese Lösung hat sich praktisch durchaus bewährt; Spannungen in den Betrieben wurden vermieden, der Organisationsgrad in den Gewerkschaften (zirka 67 Prozent) ist einer der höchsten der freien Welt.
Die deutschen Differenzierungsversuche
In der Bundesrepublik Deutschland hat sich dagegen in der Praxis erwiesen, daß die Arbeitgeber auch ohne Rechtspflicht die Außenseiter meist gleich behandeln. Dieser Umstand sowie der wesentlich geringere gewerkschaftliche Organisationsgrad der deutschen Arbeitnehmer (zirka 30 Prozent) hat einige Gewerkschaften aus finanziellen Gründen und um ihre „Werbewirksamkeit“ zu erhöhen, dazu bewogen, finanzielle Belastungen der Außenseiter (Solidaritätsbeiträge) ins Auge zu fassen oder kollektivvertragliche Besserstellungen der Gewerkschaftsmitglieder zu verlangen. Der Gedanke des Solidaritätsbeitrages wurde zwar bald wieder verworfen, die Besserstellung der eigenen Mitglieder aber durch Kollektivvertrag zu realisieren versucht. Das Instrumentarium reichte von groben Waffen, wie dem ausdrücklichen Ausschluß der Außenseiter (Tarifauschlußklau- sel), bis zu den diffizilen Strategien der Spannensicherungsklausel (die gewährleisten soll, daß im Falle der Nachziehung der Außenseiter den eigenen Mitgliedern ein Superplus zukommt) oder der Schaffung gemeinsamer Einrichtungen der Kollektivvertragsparteien (zum Beispiel gemeinsame Urlaubskasse), die den Gewerkschaftsmitgliedern höhere Zuwendungen garantiert als den Außenseitern.
Über die Zulässigkeit dieser Methoden entbrannte bald heftiger Streit, der seinen sichtbarsten Ausdruck Ende 1966 auf dem Deutschen Juristentag in Essen fand. Der Einsatz schien lohnenswert, weil vor dem Bundesarbeitsgericht ein Modellverfahren anhängig war, das diese Probleme lösen sollte. Die mit großer Spannung erwartete Entscheidung des Großen Senates des Bundesarbeitsgerichts hat entschieden, daß alle Klauseln, die zu einer Andersbehandlung von Organisierten und Außenseitern führen sollen, unzulässig sind. Ob der Streit damit endgültig bereinigt ist, läßt sich noch nicht sagen, da nach deutscher Verfassung auch gegen den Spruch eines Höchstgerichts Verfassungsbeschwerde eingelegt werden kann. Möglicherweise wird sich also auch das deutsche Bundesverfassungsgericht mit diesem Problem zu beschäftigen haben.
Das deutsche Beispiel zeigt immerhin, welche soziologischen Probleme die Ausschaltung der Außenseiter für den Kollektivvertrag aufwirft. Das enthebt allerdings für Österreich nicht der Sorge, wie dem verfassungsrechtlichen Einwand begegnet werden kann, daß die Parteien des Kollektivvertrages Recht auch für Personen schaffen, für die sie — selbst bei weitestgespannter Repräsentation — der Sache nach zu sprechen nicht legitimiert sind.