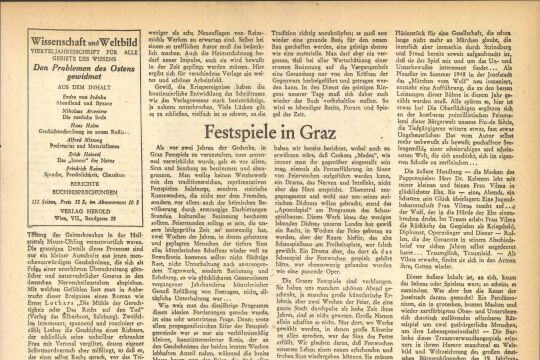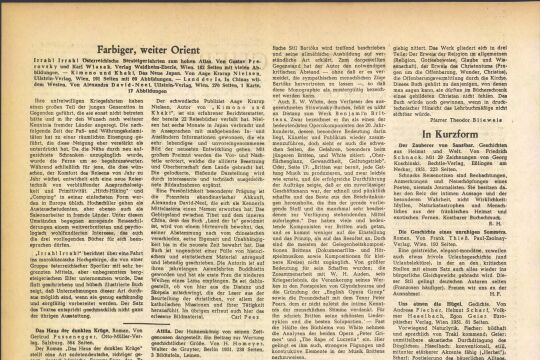Vor fünf Jahren, am 22. September 1959, starb in einem Wiener Krankenhaus der österreichische Zwölftonmusikpionier Josef Matthias Hauer im Alter von 76 Jahren. Er wird heute allgemein als Entdecker einer Zwölftontechnik anerkannt, die er bereits entwickelt hatte, als Arnold Schoenberg seine „Methode mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ zu komponieren, publizierte. Diese historische Tat Hauers wurde auch offiziell durch die Verleihung des österreichischen Staatspreises gewürdigt. Im Verleihungsdekret des Bundesministeriums für Unterricht vom 4. Mai 1956 wird Hauer als „Entdecker des Zwölftonsystems, der damit das Prinzip einer neuen Art musikalischen Schaffens festgelegt und verschiedenen Musikern Anregung zu ungewöhnlichen kompositorischen Leistungen gegeben hat“, apostrophiert.
Das trifft allerdings nur zum Teil zu, denn Hauer hat im Gegensatz zu Schoenberg niemals ausgesprochen „Schule gemacht“. Er hat wohl stets „Schüler“ — richtiger „Jünger“ — um sich versammelt; diese waren aber in den wenigsten Fällen Musiker, denen er „Anregung zu ungewöhnlichen kompositorischen Leistungen“ gegeben hätte, sondern größtenteils Maler, Bildhauer, Dichter, Architekten, Philosophen — Menschen, die sich von seiner gewiß faszinierenden Persönlichkeit magisch angezogen fühlten. Das wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß Hauers Lehre nicht bloß eine neue Kompositionsmethode beinhaltet, sondern den Anspruch erhebt, ein allgemein geistiges Prinzip zu sein, die „Offenbarung der Weltordnung“ im Melos. Er war fest davon überzeugt, daß seine „absolute“ Musik, die nicht er, sondern „der Weltenbaumeister von Ewigkeit her ein für allemal komponiert hat“, wahrlich völkerverbindend zu wirken imstande sei und durch „Temperierung“ der Leidenschaften der Menschen, insbesondere der Staatsmänner, sogar den Ausbruch von Kriegen zu verhindern vermöge. Diese Musik könne, ähnlich wie das Schachspiel, als „Zwölftonspiel“ gelehrt und gelernt werden und werde sich wie jenes gleichsam „spielend“ verbreiten. (Der Gedanke der „Temperierung“ menschlicher Affekte durch Musik ist übrigens gar nicht so absurd; er wird gegenwärtig in der „Musiktherapie“ — einem an der Wiener Musikakademie vertretenen Lehrfach — praktisch erprobt)
Während das System Arnold Schoenbergs — insbesondere in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg — weltweite Verbreitung fand, sind Lehre und Musik Josef Matthias Hauers bis heute so gut wie unbekannt geblieben. Das mag zum Teil mit der schon erwähnten Tatsache Zusammenhängen, daß Hauer niemals eine regelrechte „Schule“ gegründet hat. Man kann ihn aber auch keineswegs als Repräsentanten der sogenannten „Wiener Schule“’ indes Schoenberg-Kreises betrachten, da seine eigenartige und durchaus originelle Zwölftontechnik von der Kompositionslehre Schoenbergs grundsätzlich verschieden ist, so daß übrigens schon aus diesem Grund jede Rivalität und jeder Prioritätsstreit müßig sind. Leider gibt es zur Zeit fast keine sachlich auf Hauers Theorien eingehende und erschöpfend informierende Literatur1. Hauers eigene theoretische Schriften sind wenig aufschlußreich, da sie vor allem seine wesentlichen Erkenntnisse aus späterer Zeit unberücksichtigt lassen. Auch die in Wien existierenden kleinen Hauer- Gemeinden kommen kaum als ausreichende Informationsquelle in Betracht. Sie werden von einzelnen, angeblich im Interesse des Meisters wirkenden Hauer-Schülern beherrscht, die sich jedoch so gebärden, als hätten sie ein exklusives Anrecht auf das Werk Hauens, mit dem sie eine Art Geheimkult treiben. Der Verfasser dieses Artikels, der sich seit Jahren bemüht, Leben und Werk Hauers in einer Monographie2 auf sachlicher Basis darzustellen, konnte jedenfalls in diesen „esoterischen“ Kreisen — anscheinend als fremder Eindringling und unerwünschter Konkurrent angesehen — keinerlei Auskünfte, geschweige denn Einblick in das vorhandene umfangreiche, ängstlich gehortete Noten- und Handschriftenmaterial erlangen. Daß diese Haltung kaum dazu beiträgt, der Musik Hauers neue Freunde zu gewinnen und ihre Verbreitung zu fördern, braucht nicht besonders betont zu werden.
Ein weiterer Grund dafür, daß Hauers Musik nur äußerst selten im Konzertsaal oder im Rundfunk zu hören ist, muß wohl im Managertum und Starinterpretenunwesen des gegenwärtigen Kunstbetriebes gesucht werden. Um auch breiteren Publikumsschichten eine Urteilsbildung über das Schaffen dieses bedeutenden Musikerphilosophen zu ermöglichen, den Max Graf einmal als die „stärkste geistige Kraft, die Österreichs Musik neben Schoenberg besessen hat“, bezeichnete, müßte der Öffentlichkeit vor allem Gelegenheit geboten werden, die Werke Hauers in einwandfreien Aufführungen kennenzulernen. Eine Auswahl aus dem reichen Oeuvre zu treffen, fiele wahrlich nicht schwer (Hauer hat 89 mit Opuszahlen versehene, zum Großteil noch unaufgeführte Werke für alle erdenklichen vokalen und instrumentalen Besetzungsmöglichkeiten und an die 1000 Zwölftonspiele geschrieben!), und das Risiko wäre nicht allzu groß, wie ein Blick auf die durchweg enthusiastischen Kritiken von den Musikfesten in Baden-Baden (1928) und Wien (1951 und 1953) beweist, wo sich Dirigenten vom Range Hermann Scherchens und Hans Rosbauds mit Erfolg für Hauer einsetzten.
U” berblickt man das Lebenswerk Josef Matthias Hauers, so zeichnen sich deutlich drei Schaffensperioden ab. Die erste reicht bis zum Opus 18 und könnte als eine Phase „freier Atonalität“ bezeichnet werden; Hauer selbst nanntesie einmal „den ersten Ansturm seiner Zwölftonmusik“. Von seinem Opus 19 an komponierte Hauer bewußt und konsequent nach dem 1919 von ihm entdeckten „Zwölftongesetz", welches besagt, daß die zwölf temperierten Halbtöne der chromatischen Skala innerhalb einer bestimmten Reihenfolge immer wieder abgespielt werden müßten, wobei kein Ton wiederholt und keiner ausgelassen werden dürfe. Die mit dem Opus 19 beginnende Phase reicht ungefähr bis zum Opus 73. Als Grundlage für Hauers damaliges kompositorisches Schaffen diente die Lehre von den „Tropen“. Die 1921 von Hauer gefundenen „Tropen“ sind 44 „Wendungsgruppen“, in die man alle 479,001.600 Möglichkeiten, verschiedene Zwölftonreihen (die „Melosfälle“) zu bilden, einteilen kann. Sie sollen gewissermaßen die Tonarten des herkömmlichen Dur-Moll-Systems ersetzen. In dieser Zeit schrieb Hauer neben Kammermusik in verschiedener Besetzung auch große Chor- und Orchesterwerke. So entstanden u. a. die Sinfonietta (op. 50), das Violinkonzert (op. 54), das Klavierkonzert (op. 55), 8 Orchestersuiten, 7 Tanzfantasien, 4 Tanzsuiten für 9 Soloinstrumente und, nach Texten von Friedrich Hölderlin, die großen Kantaten „Wandlungen“ (op. 53, 1927), „Vom Leben“ (op. 57, 1928), „Emilie vor ihrem Brauttag“ (op. 58, 1928), „Der Menschen Weg“ (op. 67, 1935) und „Empedokles“ (op. 68, 1935). Auf dramatischem Gebiet schuf Hauer die beiden Opern „Salambo“ (op. 60, 1929), nach Gustave Flaubert, und „Die schwarze Spinne“ (op. 62, 1931), nach Jeremias Gottheit
Das letzte Werk, das Hauer mit einer Opuszahl versehen hat, ist das Opus 89, „Zwölftonmusik für Orchester“, aus dem Jahre 1939. Von hier ab läßt sich eine dritte und letzte Phase seines Schaffens konstatieren, die im sogenannten „Zwölftonspiel“ gipfelt. Diese Entwicklung bahnt sich schon etwa 1937 an, als er mit dem Opus 74 beginnt, eine Reihe von „Zwölftonmusiken“ zu schreiben. Schon damals bezeichnete er seine Zwölftonmusik als ein „Spiel mit den zwölf temperierten Tönen der chromatischen Skala“, das strengen Spielregeln gehorche. Die Zwölftonreihen müßten zuerst — am besten vierstimmig — „in Harmonie“ gebracht werden, dann erst könnten sich daraus die Melodien mit ihren mannigfachen Rhythmen entfalten. 1940 finden wir schon die Bezeichnung „Zwölftönespiel für Orchester“, und im Februar 1942 schreibt Hauer ein „Erstes Zwölftönespiel mit den endgültig f astgelegten monodischen Spielregeln“, dem weitere nachfolgen. Schließlich verzichtet er gänzlich auf eine Numerierung seiner Zwölftonspiele, von denen er bis zu seinem Tode an die tausend schuf.
Da bei Hauer die Musik einen so hohen Grad von Absolutheit erreicht hat, hör; sie auf, Kunst im üblichen Sinne zu sein. Er scheut sich daher in seiner letzten Schaffensperiode, gestaltend und schöpferisch in den „Kompositionsprozeß“ einzugreifen und begnügjt sich mit der Rolle eines „Deuters des Melos“. In Hauers Musik ist — zumindest was das Zwölftonspiel betrifft — alles streng determiniert und präformiert. Gerade dieser Umstand gibt aber seinem Denken und Schaffen einen ungeahnt „modernen“, oder besser: „zeitgemäßen“ Zug. Die Entwicklunglslinie der „fortschrittlichen“ Musik des 20. Jahrhunderts führt von der völligen „Befreiung“ von den formalen und klanglichen „Spielregeln“ der Klassiker — man spricht zum Beispiel gerne von der „Emanzipation der Dissonanz“ — zu einer extremen „Durchorganisierung“ und Strukturierung in der seriellen Technik, die nicht nur die Tonhöhen einer strengen reihenmäßigen Ordnung unterwirft, sondern auch andere „Parameter“, wie Klangfarbe, Dynamik, Zeitdauer usw. Bemerkenswert ist, daß in neuester Zeit diese totale Determinierung wieder gelockert wurde und gewisse Freiheiten in den Schaffensakt oder in die Interpretation Eingang fanden; man denke etwa an den Amerikaner John Cage, an die sogenannte „Aleatorik“ und an ähnliche Praktiken der Avantgarde. Diesen Entwicklungsgang von der totalen Anarchie zur strengen Diktatur hat Hauer genauso durchgemacht wie Arnold Schoenberg, nur fehlt bei Hauer die expressionistische Phase der Entfesselung gewaltiger und neuartiger Klangmassen im Dienste des „Ausdrucks“ von Gefühlen und ähnlichen seelischen Vorgängen. Hauer bestritt und bekämpfte immer schon die Ansicht, daß die Musik die Aufgabe habe, „Gefühlen“ Ausdruck zu verleihen. Er forderte eine rein geistige, völlig unsinnliche Musik, wie er sie in seiner ersten, an der von ihm entwickelten „Klangfarbenlehre“ orientierten Schaffensphase angestrebt und später in den „Zwölftonspielen“ tatsächlich verwirklicht hat. Hauer verabscheute alle im Dienst oder Banne einer (außermusikalischen) „Idee“ stehende Musik, im besonderen die Programmmusik der Romantiker und ihrer Nachfolger und das „Musikdrama“ Richard Wagners. Auch Beethoven verursachte ihm Unbehagen, da er bei ihm den Ausgangspunkt alles Übels — nämlich der „Ideen- und Gefühlsmusik“ — sah (der „Naturalismus“ der Pastorale, die „Idee“ der Fünften!).
Es war ihm jedoch — ebenso wie Schoenberg — klar, daß der Weg von der durch die Romantiker immer mehr erweiterten Chromatik folgerichtig zur völligen Auflösung der Tonalität, dem „Denken in den alten Leittongeleisen“, führen müsse.
„Es ist und bleibt richtig: es gibt keine Regeln mehr! Durch das Verlassen der Tonalität ist die Phantasie durch nichts mehr gefesselt. Die Temperatur ist ein allumfassendes Ausdrucksmittel. Wi. kommen nie mehr über die Temperatur hinaus. Es ist an und für sich ganz gleichgültig, wie die Stimmen geführt werden, wie die Akkorde aneinandergereiht werden, wie die Formen aufgebaut werden usw. Einzig und allein ist die .musikalische' Intuition maßgebend.“
So schreibt Hauer in einem Brief im Februar 1919. Er bezeichnete damals Schoenberg als „einen Mann, der sich getraut, die äußersten Konsequenzen zu ziehen, einen Mann, der das Chaos hergestellt hat, von dem aus es einzig und allein möglich ist, wieder zu einer Musik zu kommen“. Und weiter heißt es: „Gewiß, mein Chaos in den Noten, in den Tönen, Akkorden usw. und das Schoenbergs ähneln sich auf ein Haar.“
Im selben Jahr 1919 fand Hauer den Ausweg aus diesem Chaos, das „Gesetz“ der zwölf temperierten Töne der chromatischen Skala, das er erstmalig in seinem Opus 19, Nomos für Klavier und Harmonium (Entstehungszeit: 25. bis 29. August 1919) konsequent anwendete. Dąmit ist der Über-, gang von der Phase der „freien Atonalität“ (der vielstrapazierte Ausdruck „atonal“ dürfte übrigens eine Wortschöpfung Hauers sein) zur zweiten Schaffensperiode eindeutig markiert. Auch Schoenberg ist — wohl unabhängig von Hauer — diesen Weg des „Gesetzes“ gegangen, und auch er fand die gleiche panchromatische Regel, das Zwölftongesetz. Diese Parallelität scheint zu beweisen, daß die Lösung gewissermaßen „in der Luft lag“, daß sie ein Gebot der Zeit war.
Während nun Schoenbergs Zwölftontechnik — wie bereits erwähnt — weitgehende Verbreitung fand, ist Hauers Lehre im allgemeinen unbekannt geblieben. Angesichts der Entwicklung, die die neue Musik seit ihren Anfängen genommen hat, kann man heute allerdings behaupten, daß Hauer der radikalere und „modernere“ der beiden Vorkämpfer gewesen sei. Schoenberg wollte niemals der Reihentechnik den musikalischen „Einfall“ und das kompositorische Gestalten preisgeben, während Hauer seine einzig und allein aus dem „Material“, den zwölf temperierten Tönen, abgeleiteten Gesetze immer strenger und totaler faßte. Dieses „materialgerechte“ Denken und die weitgehende Gebundenheit an die durch die einmal gewählte Reihe bedingte Präformierung sind Merkmale, die auch der seriellen und elektronischen Musik anhaften. Übrigens hat Hauer schon 1919 einen obertonfreien Idealton — wie er heute als Sinuston in der elektronischen Musik Verwendung findet — gefordert, was folgende Brief stelle beweist:
„Zur restlosen Realisierung dieser ,reinen' Klangfarbe brauchte der Komponist also ein Instrument mit unendlich vielen Tönen. Diese müßten aber eigentlich ohne Obertöne und so beschaffen sein, daß einer vom andern sich wirklich nur durch die Höhe unterscheidet (also ähnlich wie beim Klavier, nur unendlich vollkommener). Diese Töne müßten auch die Eigenschaft haben, daß man sie beliebig stark anspielen und beliebig lange aushalten kann. — Die letzte Bedingung aber erfüllt weder das Klavier noch das Harmonium. Wer baut mir ein halbwegs brauchbares Instrument?“
Schließlich vermag man sogar in der Tatsache, daß Hauer seine Reihen oft erwürfelte oder mit Hilfe von zwölf mit den Notennamen versehenen Scheibchen ziehen ließ, eine Parallele zur „aleatorischen“ Richtung (alea = Würfel) der Gegenwartsmusik erblicken, die den Zufall Einfluß auf das musikalische Geschehen nehmen läßt. Hauer selbst faßte allerdings auch das Wählen der Reihe als schicksalsbedingten, somit determinierten Akt auf. Trotz der angeführten „modernen“ Züge hat Hauers stark verinnerlichte und vergeistigte Musik jedoch wenig mit manchen Produktionen heutiger Avantgardisten gemein, die man kaum treffender als mit seinem schon in den zwanziger Jahren geprägten Ausspruch vom „organisierten Lärm“ kennzeichnen könnte.
Zu den wenigen wirklich fundierten Auseinandersetzungen mit Hauer gehören die Dissertation E. Bambergers „Die Zwölftonalität“ (Innsbruck 1957), der Aufsatz „Über Josef Matthias Hauer“ R. Stephans (Arch. f. Muslkwlss. 1961/3—4) und vor allem die soeben im Druck erschienene Dissertation „Untersuchungen zur Theorie der Zwölf tontechnlk bei Josef Matthias Hauer“ (Regensburg 1964) von M. Lichtenfeld.
!) Der Band „Josef Matthias Hauer“ soll demnächst als 6. Monographie der Buchreihe „österreichische Komponisten des XX. Jahrhunderts“, herausgegeben vom Verlag der österreichischen Musikzeitschrift In Gemeinschaftsproduktion mit dem österreichischen Bundesverlag, erscheinen.
Vgl. Hauers Schriften „Über die Klangfarbe" (191 ) und „Vom Wesen des Musikalischen“ (1920).