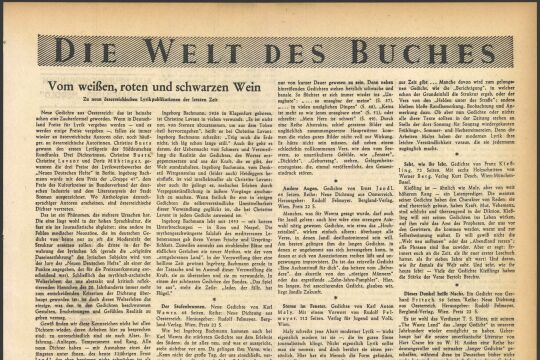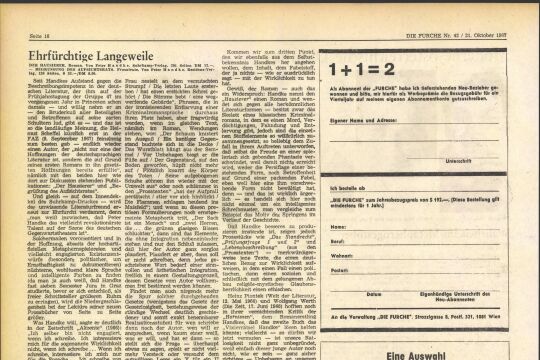60 Jahre Dichterin, 50 Jahre Bücherleben. Rede zu Friederike Mayröcker.
Verehrte Damen und Herren, am Beginn möchte ich uns zwei Jubiläen in Erinnerung rufen und Ihnen, liebe Friederike Mayröcker, dazu gratulieren: 60 Jahre sind es heuer, dass Sie Ihr erstes Gedicht veröffentlicht haben - 1946 in Otto Basils Zeitschrift Der Plan - und vor einem halben Jahrhundert ist Ihr erstes Buch erschienen: "Larifari".
Ich bin glücklich über den Titel "Poetisches Universum" - schon deswegen, weil man ein Universum weder erklären noch umfassend beschreiben kann und Sie daher das auch nicht von mir erwarten können. Es ist für mich eine Premiere, zu Friederike Mayröcker zu sprechen, und das hat seine Vorgeschichte. Ich erinnere mich gut, wie ich während des Germanistikstudiums eines ihrer Gedichte gelesen und gar nichts verstanden habe. Danach fand ich eine Interpretation, die mir sehr eingeleuchtet hat. Daraufhin las ich noch einmal das Gedicht - und verstand gar nichts mehr: weder die Interpretation noch das Gedicht. Ich habe verdrängt, um welches Gedicht und um welchen Aufsatz es sich handelte, denn ich schämte mich sehr. Germanist zu sein hieß für mich ja: jeden Text verstehen, interpretieren, erklären können. Kann man das nicht, hat man das falsche Handwerk - wie ein Schlosser, der eine Tür nicht aufsperren kann. Geht es schwer, so ist es nur gut, denn dann wird der Ehrgeiz umso größer und der Beweis des Fachkönnens wertvoller, aber wenn es nicht gelingt, ist man fehl am Platz.
Ohne Verstehenszwang
Endgültig gelöst hat diese Blockade erst ein Auftrag der Furche, für die letzte Nummer des Jahres 2001 ein Gespräch mit Frau Mayröcker zu führen. In der Vorbereitung darauf kam die Befreiung, denn in einem Interview muss man ja nur Fragen stellen. So las ich einfach im Werk von Friederike Mayröcker. Und habe bemerkt: Wenn ich mich löse von diesem Zwang des Verstehen-Müssens, sondern dort verweile, wo mir etwas aufgeht, kann ich viel entdecken.
Das hat mich nachdenklich gemacht: Was ist das für ein Verständnis von einem Text, von Kunst: dieser Anspruch, alles verstehen zu müssen. Ein solches Verstehen wird leicht zum intellektuellen Kolonialismus, der etwas von gewaltsamem Sich-Aneignen und von Einbrechen an sich hat - das Bild vom Schlosser ist verräterisch. Und ich habe gesehen, zumindest bei Friederike Mayröcker muss ich diesen Anspruch loslassen. In der Folge bemerkte ich: Das tut auch anderen Texten gut.
Die "Magischen Blätter", die ich damals vor allem gelesen habe, sind mir lieb geworden, und die lange Zugfahrt, auf der sie mich begleitet haben, ist mir noch bis in die Gerüche hinein gegenwärtig. Schon der erste Text beginnt mit einer wichtigen Warnung: Die meine Arbeit begleitenden Theorien und Absichten befinden sich in einem Zustand permanenter Bewegung, die zwar ihr Tempo ändert, sich aber an keinem Punkt fixieren lässt weil dadurch die Arbeit selbst gestört würde. Auf dieser Nicht-Fixierbarkeit - und schon gar nicht auf ein theoretisches Konzept - hat Friederike Mayröcker 1970 bestanden, und das ist noch immer gültig. Eine Frage, die sie sich in den "Magischen Blättern" stellt, ist auch eine wichtige Leitfrage durch ihr poetisches Universum: ist die Schreibkunst eine Vernunftkunst, ist die Schreibkunst eine Empfindungskunst, ist die Schreibkunst eine Erfindungskunst, oder alles zusammen nicht.
Keine Story
Friederike Mayröcker wurde oft in Zusammenhängen wahrgenommen, die das Spezifische ihres Werkes eher verstellen als freilegen. Ein Zusammenhang ist die experimentelle Prosa, die den Erzählzusammenhang verweigert. Dieser Kontext ist wichtig, aber nicht Mayröcker-spezifisch. Thomas Bernhard etwa hat sich als "Geschichtenzerstörer" verstanden und geschrieben: wenn ich nur in der Ferne irgendwo hinter einem Prosahügel die Andeutung einer Geschichte auftauchen sehe, schieße ich sie ab. Friederike Mayröcker, so scheint mir, musste nie eine Geschichte abschießen, weil sich am Horizont gar keine gezeigt hat. Jedenfalls hat sie 1975 in einem Interview gesagt: ... ich habe immer vermieden, eine Story zu machen, d. h. ich sehe nirgends eine Story. Ich sehe auch im Ablauf meines Lebens oder im Leben überhaupt keine storyähnlichen Erscheinungen. Und ich kann auch kein Buch lesen, das eine Story hat.
Von Anfang an wurde Friederike Mayröcker im Kontext österreichischer Avantgarde wahrgenommen, wobei die engste Verbindung mit Ernst Jandl gesehen wurde - mit gutem Recht: Da gibt es die gemeinsamen Hörspiele, da gibt es einen intensiven poetischen Austausch und das lange gemeinsame Leben, das "Requiem für Ernst Jandl" und die Reflexe auf "EJ" im jüngsten Buch "Und ich schüttelte einen Liebling". Aber dieser Zusammenhang verstellt den Blick auf die große Unterschiedlichkeit, ja geradezu Gegensätzlichkeit des Werkes von Jandl und Mayröcker. Ernst Jandl hat in seiner "Rede an Friederike Mayröcker" (zum 70. Geburtstag) darauf hingewiesen: Friederike Mayröcker nennt den, oder einen, heiligen Geist die Quelle ihrer Inspiration; es gibt, für sie, in ihrer Kunst etwas, das von außen kommt, und zwar von oben, während ich nicht sicher bin, wo oben ist. Ernst Jandl hatte einen viel konstruktivistischeren Zugang zur Dichtung als Friederike Mayröcker.
Ein Zusammenhang, auf den die Autorin auch selber zu sprechen kommt, ist der von Dadaismus und Surrealismus. Und sie sagt in dem Text "Dada" auch, dass sie öfters Kollegen, Theoretiker darauf hingewiesen hat, dass sie eben nicht nur aus einer Richtung komme, sondern sie habe auf meine Vorbehalte nach allen Seiten hin, von allen Blickpunkten aus, verwiesen. Es gibt also immer mehrere Blickpunkte - nicht nur auf das Werk, sondern im Werk von Friederike Mayröcker selbst.
Radikales Aufschreiben
Von welchen Punkten aus kann man das Mayröcker-Universum betrachten? Zum einen: Die Basis ihrer Literatur ist ein radikales, konsequentes Aufschreiben, das sehr früh eingesetzt haben muss: Also bin ich immer schon den Eingebungen meines Auges gefolgt und habe alles sogleich an die Wand meines Zimmers mit Bleistift gekritzelt wie beim Vokabellernen das lernbeflissene Kind, wofür es mit sanfter Rüge bedacht wurde. Hier ist der Ursprung der legendären Mayröcker-Wohnung mit den vielen verstreuten Zetteln, zwischen denen kein Platz ist, weil alles sofort aufgeschrieben, festgehalten werden muss. Auf Zetteln, weil sie variierbar sind, einfügbar in Zusammenhänge - nicht einem kontinuierlichen Tagebuch, das würde zu sehr fixieren und diesen Prozess des Weiterverarbeitens blockieren. Radikales Aufschreiben in möglichst jeder Lebenssituation: unterwegs, auf der Straße, am Morgen beim Aufstehen.
Das ist auch ein Unterordnen des Lebens unter das Schreiben: ans zweifelhafte Licht der Kunst geklammert, fragen wir uns von Zeit zu Zeit, welches Echo unsere ungeheuren Anstrengungen haben, unser Verzicht auf das naive Glück undsoweiter. Ausbeutung des Lebens für die Kunst, aber es gibt auch den umgekehrten Prozess: Die Kunst wird ein Teil des Lebens und ist davon nicht mehr zu unterscheiden.
Ein zweiter Fixpunkt ist das Musikalische. Es kommen immer wieder Musikernamen vor, die auch inspirierend waren für Texte, die ganze Musikgeschichte von Bach und davor bis zu Eric Satie oder Arthur Honegger. Aber nicht nur Namen kommen vor, die Texte selber sind leitmotivisch komponiert, nach musikalischen Prinzipien strukturiert, und sie haben auch einen eigenen Ton, jenen Mayröcker-Ton, der sich besonders vermittelt und festsetzt, wenn man die Autorin selbst lesen hört.
Das Musikalische bedeutet auch das Vergängliche, denn im Unterschied zur Literatur existiert die Musik nur, solange sie aufgeführt wird. Vergänglichkeit ist ein Grund-Thema Friederike Mayröckers - ich nenne nur das Gedicht "Wird welken wie Gras" [siehe rechts oben, Anm.] aus dem Band "Tod durch Musen":
"Wird welken wie Gras"
Es ist ein unmittelbar verständliches Gedicht, und gleichzeitig ein Text mit viel Hintergrund. Denn alles Fleisch es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen - das kennen wir aus dem Jesaja-Buch des Alten Testaments und haben es im Ohr aus dem Brahms-Requiem, das diesen Text vertont. Und es begegnet uns ein Formprinzip aus den Psalmen, mit denen sich Friederike Mayröcker auch immer wieder beschäftigt hat. Die Zeilen haben einen Punkt in der Mitte, er markiert die charakteristische Zäsur nach dem Halbvers. Und trotz all dem haben wir hier ein unverwechselbares Mayröcker-Gedicht.
Ein weiterer Fixpunkt ist die Spannung zwischen dem Assoziativen und der Form. Friederike Mayröcker hat die Intuition vehement verteidigt: Immer wieder stellt sich mir die Frage, warum es heute als fragwürdig, ja anachronistisch gilt, von Eingebung, von Ingenium zu sprechen, man spricht lieber davon, daß es jedermann gegeben ist, einen Text herzustellen. Ich melde meine Bedenken an. In einem Interview mit Hans-Jürgen Heinrichs sagte sie: Ich habe immer wieder das Gefühl, daß ich nicht allein an diesem Schreiben beteiligt bin, sondern daß eine Kraft durch mich hindurch wirkt. Andrerseits aber erlebe ich mich dann auch als wirklicher Kreator des Schreibens. Im selben Gespräch spricht sie von einem seligen Schreibzwang - um dann gerade die konsequente Arbeit an einem Text zu betonen.
Mayröckers Texte haben immer etwas Dialogisches: auch in dem Sinn, dass mit vielen poetischen, musikalischen und Bild-Welten ein Dialog geführt wird - oft spontan ausgelöst wie im Vorjahr durch die Goya-Ausstellung im
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!