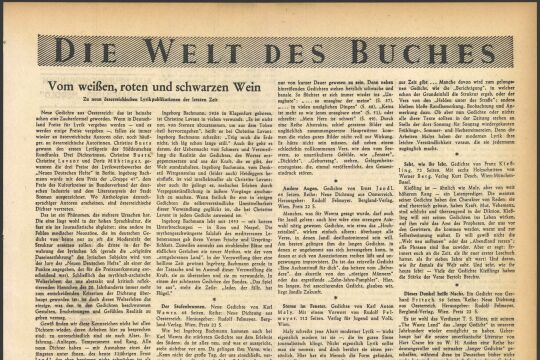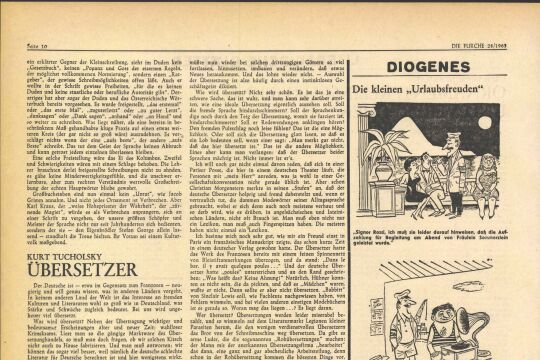"Ich bin nicht der Herr des Textes"
Der Bachmann-Preis sei vor allem ein spektakel, meint Franz Josef Czernin. Ein Gespräch über literaturkritik und Feuilletonblüten, Kitsch und Erbaulichkeit und die Ästhetik von Texten.
Der Bachmann-Preis sei vor allem ein spektakel, meint Franz Josef Czernin. Ein Gespräch über literaturkritik und Feuilletonblüten, Kitsch und Erbaulichkeit und die Ästhetik von Texten.
Franz Josef Czernin schreibt Lyrik, Aphorismen und Essays. Einerseits von der "Wiener Gruppe" beeinflusst, befasst er sich auch mit traditionellen Gedichtformen wie dem Sonett. Czernin erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise, unter anderem 2007 den Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik und heuer den Ernst-Jandl-Preis. Mit Erich Klein, Übersetzer und Literaturkritiker (auch Klein erhielt den Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik), sprach Czernin über den Bachmann-Preis, über Literatur und den Literaturbetrieb.
DIE FURCHE: Was halten Sie vom alljährlichen Wettlesen im Fernsehen, dem Bachmann-Preis? Hat das noch mit Literatur zu tun, oder geht es nicht vielmehr um die Eitelkeit der Kritiker vor großem Publikum?
Franz Josef Czernin: Nichts - es ist vor allem ein Spektakel. Ich wurde einmal von einer Jurorin gefragt, ob ich mitmachen will, lehnte aber ab. Zugegeben, die Art von Wettlesen hat eine antike Tradition, die Juroren und das Publikum sind die Löwen.
DIE FURCHE: Zur Namensgeberin der Veranstaltung, gibt es zu der noch etwas zu sagen?
Czernin: Bachmanns Lyrik ist ja nicht schlecht, aber bei weitem nicht so gut wie die versammelte Literaturwissenschaft heute meint.
DIE FURCHE: Vor etlichen Jahren erhielten Sie, obschon Lyriker, den Staatspreis für Literaturkritik. Sie meinten damals, Sie würden nur aus Unmut über den Zustand der Kritik zur Feder greifen. Wie ist die Lage heute?
Czernin: Was im Fernsehen passiert, weiß ich nicht, die Qualität in Zeitungen und Radio ist sehr unterschiedlich. In einigen Online-Zeitschriften findet man großartige Kritiken. Das Feuilleton ist extrem unbefriedigend. Der Bildhauer Walter Pichler sagte mir einmal kurz vor seinem Tod: "Die Leute wollen nur unterhalten werden!" Im Fall der Kunst, wo das Ernste und Komische eigentlich keine Widersprüche darstellen, ist das ein Problem.
DIE FURCHE: Das klingt jetzt nach Adorno und den Bannflüchen über die Kulturindustrie. Fehlt nur noch das Verbot, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben.
Czernin: Wenn ich mich recht erinnere, ging es Adorno darum, sich der Gefahren der Kulturindustrie bewusst zu sein. Was die Gedichte nach Auschwitz betrifft, so war die Frage, ob es noch möglich wäre, mit höchsten ästhetischen Ansprüchen diese Dinge zum Thema zu machen. Das gilt auch für Bilder oder Kompositionen. Ist Kunst nach der Selbstdesavouierung des bürgerlichen Kunstbegriffes unter den Nazis noch möglich? Wobei für Adorno der einzig statthafte Kunstbegriff der bürgerliche war - antibürgerlicher Untergrund genügte ihm nicht, von Popkultur ganz zu schweigen.
DIE FURCHE: Haben Sie seinerzeit etwa auch geglaubt, man dürfe Strawinsky nicht hören?
Czernin: Ich habe es geglaubt, aber, so wie die meisten, irgendwann nicht mehr. Dass die Popkultur ein alles verschlingendes Ungeheuer ist, davon bin ich aber bis heute überzeugt. Zu ihr gehört dieser unglaublich dumme Pluralismus, in dem alles geht: Es gibt Udo Jürgens und Boulez und die Beatles - weil es all das gibt, ist es gut. Absolut gedankenloser Unsinn!
DIE FURCHE: Üblicherweise wird argumentiert, die Leute wollen das ja.
Czernin: Wenn es um ethische Probleme geht, wenn eine Mehrheit etwa ausländerfeindlich ist, wird protestiert - mit Recht. Bei ästhetischen Dingen steht man hingegen sofort im Geruch des Elitären.
DIE FURCHE: Wollen Sie einen modernen Kanon aufstellen? Wie wäre Kritik befriedigend?
Czernin: Das könnte ich nicht. Im Zentrum der Kritik sollte die ästhetische Qualität eines Werkes stehen und nicht, ob etwas lustig oder angenehm ist. Es geht um den Versuch herauszufinden, was tragfähig ist, auch wenn man sich dabei immer wieder irrt. Handke sagte mir lange Zeit überhaupt nichts, plötzlich fand ich einzelne Texte absolut großartig. Darauf wirft man mir vor, es gebe keine ästhetischen Maßstäbe, alles sei nur subjektiv. Das ist falsch -allein ein Kunstwerk zu beurteilen, ist eine verwickelte Sache!
DIE FURCHE: Sie erhielten kürzlich den Ernst-Jandl-Preis, den Österreichischen Staatspreis für Lyrik. Was bedeuten Preise für Sie?
Czernin: Dass ich mich geschmeichelt fühle und mich ständig daran erinnern muss, dass Preise überhaupt kein Maßstab sind.
DIE FURCHE: War Jandl ein Vorbild?
Czernin: Mit zwanzig war das Rilke, der irgendwie ein Dichter für die Jugend ist. Jandl kam ein wenig später. Viele von seinen Arbeiten sind mir nicht mehr geheuer, aber Jandl wurde im Lauf seines Lebens immer besser. Die schonungslose Darstellung der eigenen Hinfälligkeit in seinen späten Stanzen finde ich großartig.
DIE FURCHE: Jandl war in den Achtzigerjahren fast ein Popstar - später wurde es in der Lyrik insgesamt ruhiger.
Czernin: Das hatte mit seinem spektakulären Vortrag zu tun und seine Gedichte haben einen gewissen Plebsappeal - das unmittelbar Pointierte ist ohne große hermeneutische Tiefseeforschung verständlich. Karl Valentin ist ein ähnliches Beispiel - extrem populär und unfassbare Bedeutungsschichten. Aber das Rezept gilt nicht allgemein -bei Mayröcker ging es in die Gegenrichtung.
DIE FURCHE: Sie kennen das Literaturleben seit vier Jahrzehnten - was hat sich am meisten verändert?
Czernin: Heute ist ein unglaublich restauratives Moment im Spiel. Ich frage mich bei manchen jüngeren Lyrikern, ob die letzten hundert Jahre überhaupt stattgefunden haben. Der Vergleich mag hinken - aber ein Mathematiker würde sich lächerlich machen, wenn er zum zweiten Mal dieselbe Lösung findet. Die Moderne schreibt sich kaum in die Gedichte der Jungen ein, man dichtet so, als wäre einem ein Rilkeschnabel gewachsen, allerdings auf formal niedrigerem Niveau. Gewisse Dinge kann man heute nicht mehr sagen, die haben sich erschöpft. Ich meine damit nicht den Reim, der eine Zeitlang tabuisiert war. Gute Leute wie Jandl oder die Wiener Gruppe hielten sich an solche Tabus sowieso nie.
DIE FURCHE: Gegenwärtig ist vom Lyrik-Boom die Rede, den wichtigen Leipziger Buchpreis bekam ein Dichter, Poetryslams sind in.
Czernin: Das sind Feuilletonblüten. Es mag ja begabte junge Autorinnen geben, aber mir kommt vieles harmlos vor. Was die Poetryslams mit ihren einfachen metrischen und rhythmischen Formen betrifft, so holen sie nur einen gewissen Tranceimpuls nach, den die so genannte Hochlyrik lange Zeit vermissen ließ.
DIE FURCHE: Was hat sich in Ihrer eigenen Arbeit seit dem ersten Gedichtband "Ossa und Pelion" 1979 verändert?
Czernin: Viel und wenig zugleich. Ich merke bei jedem fertigen Gedichtband: Was ich sagen wollte, ist nie ganz zu sagen. Etwas bleibt immer ungelöst und das führt zur nächsten Arbeitsanordnung. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass einmal alles ganz stimmt, aber es stimmt nie ganz.
DIE FURCHE: In einer Anmerkung zu "zungenenglisch" aus dem Vorjahr schreiben Sie, Gedichte müssen extrem sein; Texte müssten gelesen werden, als wären sie sakral. Woher der erhabene Ton?
Czernin: Ich meine nicht, dass sie sakral sind. Unlängst wurde ich bei einer Veranstaltung in Frankfurt vom Moderator auf das Religiöse in meinen Texten festgenagelt. Was ich selbst glaube oder nicht, ist uninteressant! Wichtiger ist der Umstand, dass Gedichte alles über die Welt herausfinden wollen - ob Gott existiert oder nicht, wie es sich mit den transzendenten Dingen wie Himmel und Hölle verhält. Existiert Gott nicht, kann er auch in einem Kunstwerk nicht evident werden. Der Maßstab, ob etwas existiert, liegt im Text und bei dem, der ihn liest.
DIE FURCHE: Philosophische Gottesbeweise haben schon nicht funktioniert, sollen das jetzt Gedichte leisten?
Czernin: Im ungünstigen Fall entsteht Kitsch, weil eine falsche Vorstellung von etwas evoziert wird, im glücklichen Fall ist Kunst der Prüfstein für alle letzten Fragen. Die Poesie ist meiner Meinung nach am besten geeignet, diese Fragen zu stellen. Das Ästhetische ist ein unbarmherziger Richter, das Gedicht ein Wahrheitsindikator. Will jemand nur seinen eigenen Glauben durchsetzen, kommt wie bei einer Dorothee Sölle Kitsch heraus. Deren Gedichte sind nett und harmlos - aber die Sprache des Gedichts muss die Ungeheuerlichkeit des Ganzen zeigen. Wenn Harnoncourt sagt, er empfinde Musik als Offenbarung des Göttlichen, glaube ich ihm das, aber es liegt nicht in seiner Hand, sondern in jener der Wirklichkeit. Erbaulichkeit ist in diesen Belangen entsetzlich.
DIE FURCHE: Sie haben sich in vielen Essays mit konservativen Autoren auseinandergesetzt, Shakespeares Sonette übersetzt, sehr eigenwillig Goethe und jüngst Müllers Textvorlage für Schuberts "Winterreise" nachgedichtet. Wie wichtig ist für Sie Tradition?
Czernin: Gar keine Tradition kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin wie alle mit dem Christentum und den antiken Texten aufgewachsen, auch wenn ich mich diesbezüglich für einen Analphabeten halte. Irgendwann spürt man die Tragfähigkeit eines Sonetts von Gryphius, dass sich da etwas Tiefgreifendes abspielt. Möglicherweise ist Shakespeare nur von einer Aura umgeben, aber der Text enthält eine Kraft und Intensität, die man irgendwie bewahren will. Dann beginne ich zu übersetzen, und zwar durch Verwandlung. Es ist ein alter Spruch, aber er stimmt -um dasselbe noch einmal zu sagen, muss man es anders sagen.
DIE FURCHE: Man trifft heute an den ungewöhnlichsten Orten auf Lyrik - in Museen, bei der Eröffnung eines Landschaftsparks. Würden Sie über Jesus Christus schreiben, würde man Sie scheel anschauen.
Czernin: Ist es nicht so, dass man das aus einer semiotischen Befangenheit nicht erträgt? Ich frage mich das oft. Wenn ich nachts nicht schlafen konnte, hörte ich eine Zeitlang relativ viel Bibel auf CD als Schlafmittel. Das Problem besteht darin, dass man sich allzu rasch auf eine geläufige Interpretation festlegt - Christus ist der Sohn Gottes, es gibt da noch den Heiligen Geist und so fort. Was aber heißt - Sohn? Es gibt in "zungenenglisch" möglicherweise sogar Anspielungen auf Christus, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin nicht der Herr meiner Texte. Mir gefällt die jüdische Auslegungstradition: Unter der Prämisse, dass wir noch nicht wissen, was in einem Text alles steht, wird dieser ständig weiter bearbeitet. Sicher ist nur, dass man von Christus nicht expressiv verbis sprechen kann.
DIE FURCHE: Georg Trakl sprach vor hundert Jahren in seinem letzten Gedicht über die Schlacht von Grodek noch unumwunden von Gott, inklusive Prophetie.
Czernin: Er hat das so erlebt und den Ist-Zustand des Ersten Weltkriegs beschrieben. Trakl befand sich, anders als Zweig oder Hofmannsthal an der Pseudowortfront im Wiener Kriegspressequartier in einer Extremsituation. Mein Leben ist bürgerlich abgefedert und im Vergleich dazu harmlos - bis sich die Lage wie bei allen zuspitzt.
DIE FURCHE: Sie sind Dichter in harmloser Zeit?
Czernin: Das glaube ich nicht. Wir müssen nur um die Ecke gehen, am Karlsplatz sitzen fünfzehn obdachlose Rumänen herum. Da schaut man geflissentlich weg.