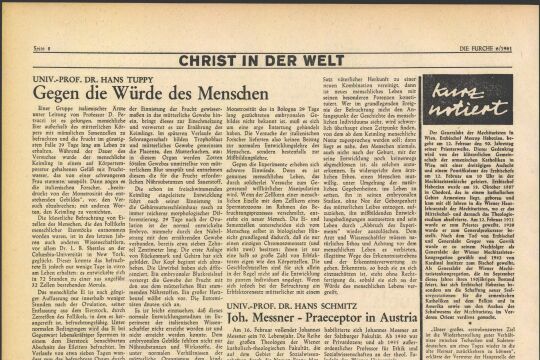Stephen Minger schuf 2003 die erste britische Stammzelllinie aus menschlichen Embryonen. Die Forschung mit embryonalen Stammzellen hält er für ein probates Mittel, um neuartige Therapien zu enwickeln. Für sein Spezialgebiet - die Parkinson-Krankheit - prophezeit er, dass erste Therapien in rund fünf Jahren verfügbar sein werden.
Die Furche: Professor Minger, während Ihres Konferenzvortrags nannten Sie sich mehrmals einen Neurobiologen. Sind sie nicht viel eher ein Stammzellforscher?
Stephen Minger: Mein Hauptanliegen war es stets, Therapien für neurologische Krankheiten zu entwickeln. Meine Doktorarbeit etwa war im Bereich der Alzheimerforschung angesiedelt. Da ich merkte, dass es bei dieser komplexen Erkrankung noch Jahre dauert, bis eine Therapie entwickelt würde, habe ich mich Parkinson zugewandt. Die Stammzellen sind dabei lediglich ein vielversprechendes Mittel für eine medizinische Behandlung.
Die Furche: Sie erhielten Ende 2001 die Erlaubnis, die erste britische Stammzelllinie aus menschlichen Embryonen herzustellen.
Minger: 2003 gelang uns das auch. Wir waren unter den ersten zehn Teams weltweit, die das überhaupt gemacht haben.
Die Furche: Die Stammzelllinie kam 2004 in die neue und weltweit erste nationale Stammzellbank.
Minger: Die Gründung einer britischen Stammzellbank war der richtige Weg. Die Bank ist eine unabhängige Einrichtung und nicht mit einer bestimmten Forschergruppe affiliiert. Alle Forscher spenden ihre Stammzelllinien der Bank. Und die Stammzelllinien können von allen Forschern wiederum kostenlos bezogen werden. Da das leitende Gremium sich alle drei Monate trifft, wartet man längstens diesen Zeitraum, bis man die gewünschten Stammzellen erhält. Das Ganze ist also sehr effizient.
Die Furche: Großbritannien hat eine sehr liberale Gesetzgebung. In Österreich ist die Herstellung von Stammzellen aus Embryonen verboten; Forschung an embryonalen Stammzellen wird nicht betrieben. Wie erklären Sie sich diesen innereuropäischen Unterschied?
Minger: Zuerst einmal eine Klarstellung: In Großbritannien ist das Gesetz liberal, das heißt aber nicht, dass es lax ist. Den Forschern wird die Möglichkeit gegeben an menschlichen Embryonen zu forschen, jedoch muss die Verwendung jedes Embryos minutiös dokumentiert werden. Die Zurückhaltung in Österreich - und zum Beispiel auch in Italien - wird wohl mit der Stellung der katholischen Kirche zusammenhängen -, deren Einfluß in Großbritannien sehr gering ist.
Die Furche: Wie rechtfertigen Sie Ihre ethisch umstrittene Forschung?
Minger: Die Embryonen stammen aus der In-Vitro-Fertilisation (IVF), bei der stets mehrere Embryonen geschaffen werden. Es handelt sich also um überzählige Embryonen, die nicht für eine Transplantation vorgesehen sind. Wenn Paare sie für die Forschung spenden, wo sie eine gewisse Nützlichkeit haben, habe ich kein Problem damit. Und würden sie von den Forschern nicht verwenden, würden sie auch zerstört.
Die Furche: Und wenn man die IVF ablehnt …
Minger: Darüber hatte ich lange Gespräche mit katholischen Priestern. Sie sagen: Zwei negative Sachen - die IVF und die embryonale Forschung - machen noch keine positive Sache. Einige Leuten erklären mir auch, dass ich wie ein Vampir sei und mich von einem bösen medizinischen Programm - der IVF - ernährte. Ich verstehe die Argumente, stimme dem aber nicht zu.
Die Furche: Letzten Freitag feierte das Fachmagazin "Nature" einen Durchbruch in der adulten Stammzellforschung. Warum kann man mit der ethisch umstrittenen Forschung nicht ein wenig warten …
Minger: Wozu warten? Wir sollten die Mittel verwenden, die wir haben.
Die Furche: Muss die Forschung so schnell vorangetrieben werden?
Minger: Ich bin zuversichtlich, dass ich mit meiner Methode in fünf Jahren die ersten Parkinson-Patienten in Großbritannien heilen kann. Was wird man dann in Österreich machen?
Die Furche: Wir fliegen vielleicht mit unseren Parkinson-kranken Müttern und Vätern nach England.
Minger: Klinik-Tourismus also. Vielleicht wird man die Methode dann auch in Österreich zulassen. Jedenfalls hätte Österreich keinen Beitrag zur Forschung geleistet und würde die Früchte des Erfolges ernten. Ist das korrekt?
Die Furche: Nicht unbedingt.
Minger: (Schulterzucken) Mir ist es ehrlich gesagt egal. Die Menschen müssen für sich entscheiden, was sie wollen. Wenn es einmal Therapien gibt, werden sich viele Meinungen auch wandeln.
Die Furche: Anfang 2006 haben Sie mit dem Vorschlag, menschliches Genmaterial in Eizellen von Kühen zu verpflanzen, Aufssehen erregt. Die Vorstellung einer Mensch-Kuh-Chimäre hat viele Menschen erschreckt …
Minger: Die Hybrid-Forschung wird kontroversieller diskutiert. Die Regierung hat leider sehr schnell ihr Missfallen signalisiert. In Umfragen waren 40 Prozent der Menschen dagegen; 60 Prozent dafür. Wir hätten unsere Absichten besser kommunizieren sollen.
Die Furche: Was sind Ihre Absichten?
Minger: Wir möchten Stammzelllinien mit speziellen genetischen Mutationen herstellen, die Krankheiten mit verursachen. Zum Beispiel ließe sich bei Alzheimer die Bildung der Plaques - eine fehlerhafte Anhäufung bestimmter Proteine - in der Petrischale beobachten. Die heutigen Tier-Modelle erlauben das nicht: Dort laufen oft tausende von Reaktionen gleichzeitig ab.
Die Furche: Warum braucht es eine Chimäre aus Kuh und Mensch?
Minger: Die hierfür notwendige Technik, der Nukleare Zelltransfer, ist zurzeit nicht sehr effizient. Der Koreaner Hwang Woo-Suk produzierte etwa eine Stammzelllinie aus zwei Tausend Versuchen. Und obwohl seine Klonexperimente 2005 als Fälschungen enttarnt wurden, muss man sagen: Sein Team hatte am meisten Erfahrung. Wenn nun mein Team nur eine zehnmal schlechtere Quote hätte, woher soll ich 20.000 weibliche Eizellen bekommen? Welche Frau würde für so ein unsicheres Projekt eine Eizelle spenden? Deshalb möchte ich Eizellen von Kühen verwenden. Meine Überlegungen sind lediglich pragmatisch. Ich versuche nicht, umstritten zu sein.
Das Gespräch führte Thomas Mündle.
Neurobiologe, der auch mit Stammzellen arbeitet
Stephen Minger zählt zu den führenden Stammzellforschern der Gegenwart. Am Wolfson Centre for Age-Related Diseases des King's College London leitet er das Stem Cell Biology Laboratory. Im Rahmen einer Tagung der Life Science Governance-Plattform der Universität Wien sprach Minger über Forschritte in der menschlichen Stammzellforschung. Er schilderte dabei gleichzeitig seinen Werdegang: Anfang der 1990er Jahre wandte er sich Parkinson zu, nachdem Lindvall und Mitarbeiter eine viel beachtete Studie vorgelegt hatten: Aus fötalem Gewebe, das ins Gehirn von Parkinson-Kranken eingepflanzt wurde, bildeten sich neue Nervenzellen. Da die Methode im großen Maßstab nicht anwendbar war, wollten Minger und sein Team Stammzellen aus Föten gewinnen und diese in der Petrischale vermehren. Nach mehreren Jahren Arbeit gelang es Minger große Mengen neuronaler Stammzellen zu züchten. Nur: Jene speziellen Zellen, die er für Parkinson-Kranke benötigte, waren nicht dabei. Deshalb forschte er ab 1997 mit den mächtigeren embryonalen Stammzellen von Mäusen. 1999 kamen die ersten Berichte über Versuche mit menschlichen embryonalen Stammzellen heraus. Auch das wollte er probieren. Während er für die Lieferung aus Singapur und den USA auf eine Warteliste kam, änderte sich die Gesetzgebung im Königreich. So konnte er 2003 die erste britische Zelllinie aus menschlichen Embryonen schaffen. Zuletzt sorgte er Anfang 2006 mit der Idee zu einer Mensch-Kuh-Chimäre für Aufsehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!