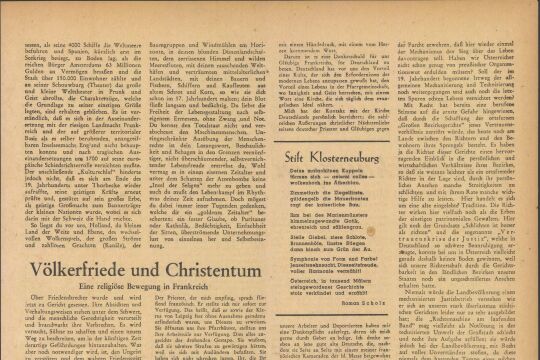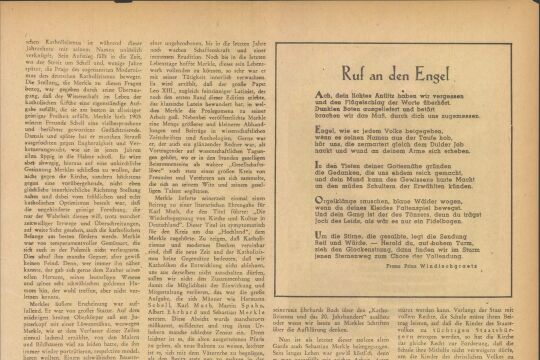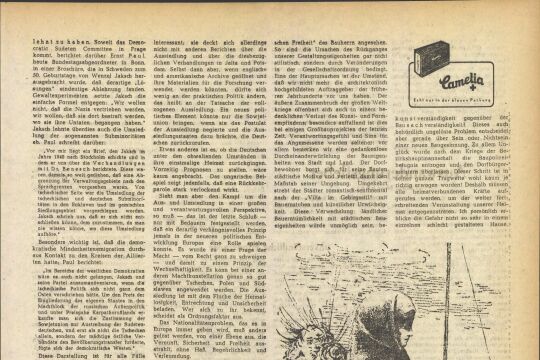Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kein Pensionszwang für Richter!
Wie eine Laune des Zufalls mutet es an, daß der recht prosaische Anlaß des vieldiskutierten 14. Monatsgehaltes den Schutt wegräumen könnte, der sich nach dem ersten Weltkrieg über eine der wichtigsten Säulen unserer Staatsordnung gelegt hatte. In den wirren Jahren nach dem ersten Weltkrieg hatten die Vertreter der rechtsphilosophischen „Wiener Schule“ die nach den 1867er-Staatsgrundgesetzen machtvoll als „Dritte Kraft’ eingesetzte Gerichtsbarkeit bedeutend stutzen können. Zwei Maßnahmen sollten diesem Vorhaben dienen. Durch die Bundesverfassung 1920 wird die gerichtliche Rechtsprechung nach dem Bundespräsidenten, der Bundesregierung und dem Bundesheer als bloßes
Vollzugsinstrument für die Durchführung der Gesetze erklärt — über welche Diskriminierung ffeihdk'J diü Tatsadföfl' fwegge'sbhnt tdžp3 SftiS : nach öie vor dieser estuhmuhg!'He!iaup?ltenSe Gerichtsbarkeit nicht nur ihren Rang als gleichwertiger Partner mit den beiden anderen „Gewalten“, Gesetzgeber und Regierung, sondern wurde vom Drang der Verhältnisse zumindest in ihrer heute hervorstechendsten Erscheinung, dem Verfassungsgerichtshof, nahe jenem vakanten Sitz der Höchstgewalt getragen.
Dafür hielt sich um so zäher eine verhängnisvolle weitere verfassungsgesetzliche Maßnahme. Das Staatsgrundgesetz legte bekanntlich in seinem berühmten Artikel 6 nicht nur die volle richterliche Unabhängigkeit fest, sondern ver- ordnete darüber hinaus ausdrücklich, daß kein (einmal ernannter) Richter — außer durch gerichtlichen Beschluß — jemals seines Amtes entsetzt oder in den Ruhestand versetzt werden darf. Den Vätern unserer 1920er-Verfassung war diese letztere Vorschrift offenbar ein Dorn im Auge — vielleicht auch die Richterunabhängigkeit selbst? Wie immer dem auch gewesen sein mag: ein Federstrich — und an Stelle der letztgenannten Kautelen wurde das Gegenteil verordnet: die Bestimmung einer Altersgrenze. Im übrigen, sagt die Bundesverfassung dann etwas verschämt, bleibt es bei den Vorschriften der Dezembergesetzgebung von 1867. Diese Altersgrenze wurde sodann gesondert mit grundsätzlich dem vollendeten 65. Lebensjahr festgesetzt.
Daran zu erinnern, gibt nun, wie eingangs angedeutet, die Suche nach Ersparungsquellen zur Abdeckung des 14. Monatsgehaltes Anlaß: Wie in dem beachtenswerten Beitrag zum Problem der Altersgrenze von J. F. Thinn („Dem Vaterland seine Väter!, Die „Furche“ vom 8. März 1958) bereits einprägsam ausgeführt wurde, bedeutet die Beibehaltung der heutigen starren und unpersönlichen Entlassungsvor- schrift einen für Oesterreich unerträglichen Luxus. Leider sind die Argumentationen von
J. F. Thinn mit einem bedenklichen Fehlschluß behaftet, der ihnen manches von ihrer Ueber- zeugungskraft rauben kann. Der Autor meint nämlich, es liege ihm ferne, an der Bestimmung einer Altersgrenze überhaupt rütteln zu wollen, zumal sie auf verfassungsrechtlicher Basis beruhe und den großen Vorteil bringe, die kompetenten Stellen von der „sehr bitteren Aufgabe zu befreien, diejenigen abzusondern, welche dienstunfähig geworden sind."
So bestechend der Hinweis auf humanere Wirkung der jetzigen Verfassungsvorschriften gegenüber jenen Zeiten (1867 bis 1920) der
Notwendigkeit individueller Pensionierungen aufs erste erscheinen mag, so wenig hält er einer tieferschürfenden Ueberlegung stand: man vergegenwärtige sich bloß, in wie wenigen — man darf sagen verschwindend wenigen — Fällen es in der verflossenen Aera der Vollwirksamkeit des Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt zur Anwendung der „bitteren Zwangsausscheidung gekommen ist! Daß es vielmehr in der überwiegenden Mehrzahl genügte, durch einen taktvollen und der individuellen Situation des Betroffenen angepaßten Wink von oben Remedur zu schaffen. Dafür schwebte nicht nur über den anderen, in das Alter der Weisheit und Erfahrung gelangten Richterfunktionären niemals jenes blinde und daher wohl desto grausamere und verhängnisvollere Schwert der Autoiyftik ihrer Zwangspensionierung, deren Folge für sie selber ebenso wie für den Staat der Autor ohnedies richtig erkannt und charakterisiert hat.
Zu Unrecht ist also J. F. Thinn der Suche nach den Wurzeln jener von ihm mit Recht beklagten Beraubung von jenen Alten, jenen Weisen ausgewichen, die uns nicht nur fehlen, sondern deren Abgang unseren jüngeren Kräften, ihren Nachfolgern, die Basis für eine angemessene Besoldung entzieht. Hier, bei der 1920 getroffenen Neuregelung des Umfanges der Richterunabhängigkeit, müßte daher eingesetzt werden, um zweierlei zu erreichen: einerseits die Beseitigung der mit der blind-automatischen Außerdienststellung unserer 65jährigen, heutzutage besonders „jungen" Staatsdiener, zumal Richter, entstehenden Lücken und dem Verlust an Kraft und Güte unserer Rechtsprechung, anderseits die Eröffnung einer bedeutsamen Ersparnisquell e zur Aufbringung der Mittel, aus denen die geforderte Einkommensverbesserung zumindest im Sektor der Justiz getragen werden kann.
Wenn noch bedacht wird, daß von der bedenklichen Festsetzung einer Altersgrenze für die Richter — ganz abgesehen von der Frage, ob ihre Fixierung mit dem 65. Lebensjahr nicht bereits einen Anachronismus darstellt — die ÄllersgenzzieTnjng“'"auch "räffgVmSfnen Verwaltung ihr’ėn Ursprung geftoriiihen hat, dann dürfte die Forderung um so mehr berechtigt sein. Die volle Wiederherstellung des Staatsgrundgesetzes vom Dezember 1867 über die richterliche Gewalt würde eine in mehrfacher Hinsicht wohltuende Wirkung äußern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!