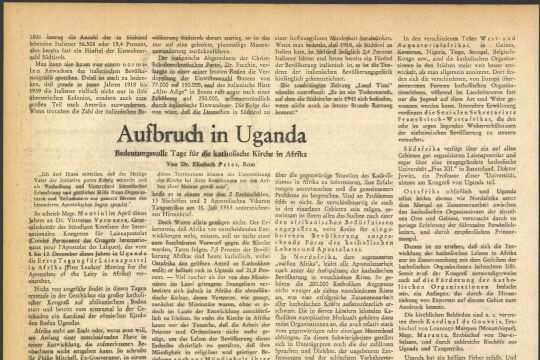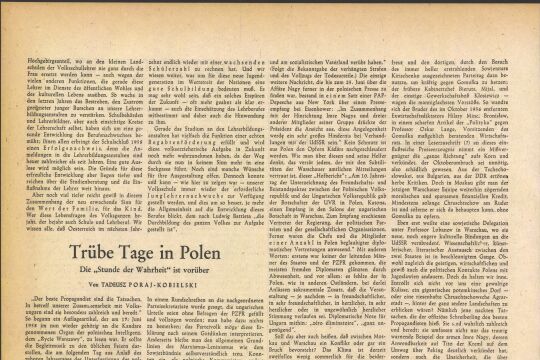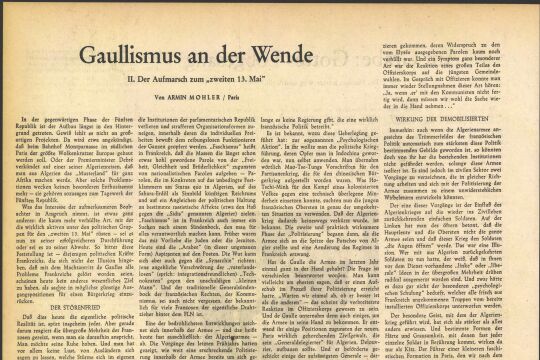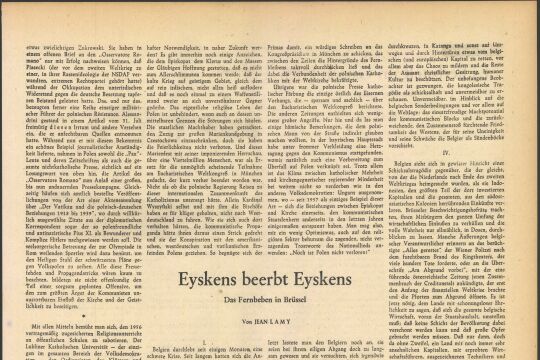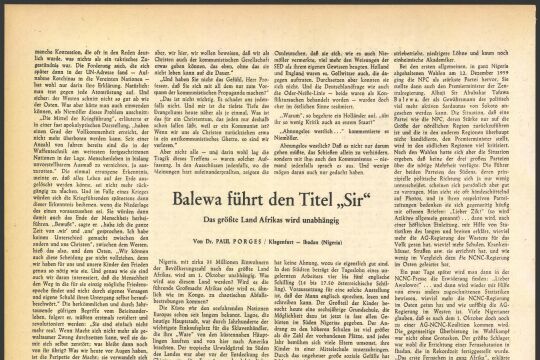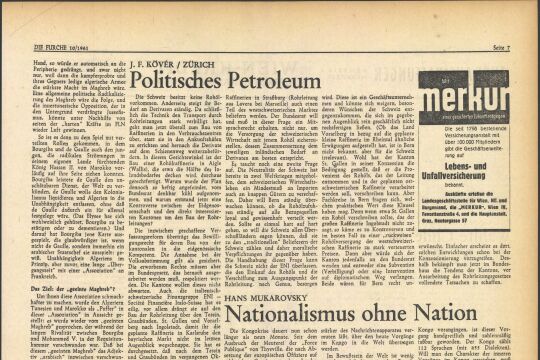Die in ihren Auswirkungen noch kaum abschätzbaren, vielfach mißverstandenen tragischen Juliereignisse im Kongo haben eine Weltöffentlichkeit, die sich im „Jahre Afrikas“ an eine rasch wachsende Anzahl selbständiger Staaten südlich der Sahara zu gewöhnen trachtet, unvorbereitet getroffen. Schlagworte, Vereinfachungen und Kurzschlußreaktionen begleiteten die Geschehnisse und haben deren Bild verdunkelt. Es scheint daher geboten, zunächst von den Grundgegebenheiten auszugehen.
Der vormals belgische Kongo erstreckt sich über ein etwa der Gesamtfläche Europas westlich einer Linie Triest—Hamburg entsprechendes Gebiet von 2,345.860 Quadratkilometer. Dieser gewaltige Raum ist in sechs Verwaltungsprovinzen unterteilt, deren kleinste (Kivu) größer ist als Großbritannien und Nordirland, während die beiden größten, die Ostprovinz und Katanga (vgl. „Die Furche“ Nr. 31), das Flächenausmaß aller kontinentaleuropäischen Staaten mit Ausnahme Frankreichs übertreffen. Zwar leben in jedem dieser Gebiete nur knapp 2 bis 3 Millionen Menschen, aber die 13,3 Millionen Kongolesen sind völkisch noch viel uneinheitlicher als die rund zwanzigmal zahlreicheren Bewohner des westlichen Europa. Ihre 112 Sprachen zerfallen in 450 Dialekte, der Mehrzahl nach untereinander näher oder weiter verwandte Bantu-sprachen. Auch unter Vernachlässigung aller der kleineren Gruppen und Zusammenfassung der größeren läßt sich die Anzahl der Hauptsprachen nicht unter ein bis zwei Dutzend herabdrücken. Nicht nur die Staatsgrenzen des Kongo bilden fast nirgends zugleich Volksgrenzen, auch keine der sechs Provinzen bildet in sich nur einigermaßen eine völkische Einheit, denn fast in allen der einzelnen Länder wohnen mehrere, größere Volksgruppen. Hier beginnt das Problem des Kongo. Es ist als solches nicht spezifisch, denn die Situation der Zersplitterung besteht auch in anderen Teilen Afrikas, nur ist sie dort durch B,das Eftfjstghefl eine?JneHen*ls.tammÄS.yetbin4en<kn Natiönalgefühls in stärkerem Maße überwunden Uder Mali zeigen auch föderale Strukturen, für deren Bewährung und weitere erfolgreiche Anpassung in einem Vielvölkerstaat das Beispiel Indiens vor Augen steht. Im Kongo haben namentlich die Bakongo, südlich Leopoldville, und die Baluba im östlichen Kasai wiederholt Autonomieforderungen erhoben.
Daß die belgische Kolonialzeit der von ihr begründeten Wirtschaftseinheit des ungeheuren Raumes kein gleichartiges geistig-politisches Erbe vermitteln konnte, begann sich lange vor dem Unabhängigkeitstag abzuzeichnen. Während sich im benachbarten französischen Zentralafrika ein politisches Eigenleben seit 1945 entfaltete, ja selbst, als nach dem historischen Plebiszit vom 28. September 1958 die exekutive Gewalt im benachbarten Brazzaville und Bangui in die Hände afrikanischer Ministerpräsidenten der Communaute-Gliedstaaten überging, existierten im Kongo weder politische Parteien noch bekleideten Afrikaner wichtige Funktionen des öffentlichen Lebens. Dafür waren politische Streitfragen des belgischen Mutterlandes, wie der Kampf gegen die Subventionierung der katholischen Schulen oder der Streit um die Gleichberechtigung des Flämischen neben dem Französischen, im höheren Erziehungswesen und anderswo, auf den Kongo übertragen worden. Die sozialen Einrichtungen und das allgemeine Schulwesen zählten zu den am breitesten entwickelten Afrikas; mehr als 70 Prozent der schulpflichtigen Jugend waren erfaßt. Das Analphabetentum der jüngeren Generation war vielfach im Verschwinden. Aber weder erreichten die kongolesischen Mittelschulen den europäischen Standard, noch waren Kongolesen vor 1954 überhaupt zum Studium zugelassen, während schon hunderte Westafrikaner an europäischen Hochschulen den Doktorhut erworben hatten. Auslandsreisen waren bis in die jüngste Vergangenheit fast unmöglich. Was so entstand, war keine Elite, aber eine breite Schichte Halbgebildeter.
Das große Werk des katholischen Belgien bildete inmitten dieser, von Wirtschaftsinteressen diktierten Halbheiten eine Ausnahme. Mehr als 5 Millionen, das sind fast 40 Prozent der Bevölkerung dieses vor einem halben Jahrhundert zur Gänze heidnischen Landes, in das der Islam kaum vorgedrungen war, sind heute katholisch. Die Studienschranke galt nicht für Theologen, und so verfügt der Kongo bereits über annähernd 500 afrikanische Priester, davon mehrere Bischöfe. 1956 studierten 2580 weitere Afrikaner an 27 Priesterseminaren im Kongo. Die protestantischen Missionen, vorwiegend in der Hand von Nichtbelgiern, zählten 1366 Seminaristen und die Anzahl der protestantischen Christen im Kongo wurde auf rund 1 Million geschätzt. Es bestehen freilich auch eine Anzahl zum Teil kirchenfeindlicher Sekten und synkretistischer, neoafrikanischer Schwärmerbewegungen, wie die Kibanguj oder die Kitawala, eine afrikanische Spielart der Zeugen Jehovas, die bei den Jännerunruhen 1959 in Leopoldville für die Angriffe auf Kirchen und Missionen verantwortlich waren. Die vom laizistischen Kabinett Lumumbas geplante Verstaatlichung des Schulwesens läßt allerdings für die Zukunft noch andere Schwierigkeiten befürchten.
Wie die Schaffung der ersten akademischen Bildungsstätte im Kongo, des 1954 von Löwen aus errichteten Levanium in Kimwenza, auf die Initiative katholischer Kreise zurückging, war auch eine Veröffentlichung, die zwei Jahre später in der katholischen Zeitschrift „Conscience Africaine“ erschien, das erste deutliche Lebenszeichen des politischen Erwachens im Kongo. Ein von einer Reihe von Persönlichkeiten unterzeichnetes Manifest geißelte das System niedriger Löhne für Kongolesen bei gleichzeitigen hohen Investitionen, lehnte eine belgisch-kongolesische Staatsgemeinschaft ohne die Zustimmung der Kongobevölkerung ab und umriß erstmals einen Weg zu einer kongolesischen Nation schwarzer und weißer Bürger. Andere, bald schärfere politische Manifeste folgten in schneller Abfolge. Im Oktober 1958 wurden politische Parteien zugelassen, aber die „kongolesische Nation“ war kaum in den „Cercles des Evolues“ Gemeingut. So traten in den politischen Leerraum weniger politisch orientierte Gruppen als die in der Kolonialzeit entstandenen völkischen Kulturvereinigungen. Regionale oder lokale Gruppen suchten den Zusammenschluß auf Grund taktischer Koalitionen, die die stürmische Enwicklung von 1959 bestimmen. Aus den ersten Koj^owahlen vom M|i. 1960 j^%^J>ajdament it Ja Weimar hervor, dessen 137. Mandate sich .überwiegend-auf. zehn .größere Parteien.verteilen, aber acht von ihnen mit fünf bis dreizehn Mandaten haben ihre völkische Basis, die öfter auch in einer Front kleinerer Stämme besieht, innerhalb einer einzelnen Provinz. Auch die gemäßigte probelgische PNP (Parti National du Progres) hat ihre 22 Mandate hauptsächlich in bestimmten Regionen zweier Provinzen errungen, und die größte der Kongoparteien, das MNC (Mouvement National Congolais) Lumumbas verdankt seinen Vorsprung von 35 Mandaten hauptsächlich dem überwältigenden Erfolg seines Führers in der Ostprovinz, wo es mehr als 80 Prozent der Stimmen errang und Lumumba eine an das kultische grenzende Verehrung genießt. Trotz seines unbedingten Eintretens für einen zentralistischen Einheitsstaat mußte er sich aber in den übrigen Provinzen stammesmäßig verankerter Gruppierungen bedienen, so etwa im Kasai der Anti-Baluba-Organisation der „Lulua-Freres“ oder der „Ressortissants du Lac Leopold II.“ in Leopoldville; in anderen schloß er Wahlbündnisse mit vorhandenen starken Gruppen, wie Balubakat in Katanga und dem Centre du Regreupement Africain in Kivu, und könnte so unter Einbeziehung der ABAKO Kasavubus und der PSA (Parti Solidaire Africaine) Gizengas eine Regierung zustande bringen, in der sein gefährlichster Gegner, der Bangala-Führer Jean Bolikango, ebenso wie andere als „probelgisch“ geltende Politiker ausgeschaltet waren.
Es erscheint wahrscheinlich, daß Lumumba, dem der „Tribalismus“ als die gleiche Todsünde gilt wie anderen panafrikanischen Politikern vom Schlage seines großen Vorbildes Kwame Nkru-mahs, damit rechnet, daß die Zeit für ihn arbeiten und die Erweiterung seines MNC zur gesamtkongolesischen Kongreßpartei ermöglichen wird. Tatsächlich hat der heutige Übergangszustand, in dem 23 Prozent der Kongobevölkerung im stammesfremden Milieu leben, bisher stärker landsmannschaftliche Zusammenschlüsse gefördert, als die Gegensätze zu überbrücken geholfen. So mußten im Frühjahr 1960 in Leopoldville die 8000 Lulua vor der Verfolgung der 20.000 Ba-lubas in bewachte, stacheldrahtumzäute Lager außerhalb der Eingeborenenvorstädte flüchten, während in der Stadt Bakongokommandos Jagd auf Bateke machten.
Die belgische Herrschaft der Kolonialzeit war zentralistisch und autoritär, und der Kurs Lumumbas ihr logisch folgerichtiges Erbe. Den Einschnitt zwischen beiden bildete die Julirevolte der 25.000 Mann starken „Force Publique“, der auf dem Prinzip der stammesmäßigen Dislokation b?riiHend|n, bei de£tJ^lzung .vielfach.verhaßten Sicherheitstruppe. Auf ihr regional sehr verschiedenes. Verhalten .köainte... wahrscheinlich ihre latente Zusammensetzung einiges Licht werfen. Zweifellos ist in der nach harten Grundsätzen geführten Truppe, die nicht selten durch die Stellung daheim unliebsam gewordener Elemente ergänzt wurde und in deren Geschichte Meutereien — die letzte größere 1944 — nicht gefehlt haben, mit dem Ende der „weißen“ Herrschaft eine ungewöhnlich starke Aggressivität freigeworden. In der Folge konnte auch die überstürzte Afrikanisierung des Offizierskorps ihren weitgehenden Zerfall nicht verhindern. *
Die Kluft, die die kongolesische Bevölkerung von den im Lande lebenden, zu 80 Prozent belgischen Europäern trennte, war freilich breit. Beobachter aus dem benachbarten französischen Zentralafrika haben wiederholt auf überflüssige gesellschaftliche Zurücksetzungen der Eingeborenen hingewiesen. Der Schulunterricht in Eingeborenensprachen mag nicht nur den Partikularismus der Kongovölker übermäßig gefördert, sondern auch das Empfinden bestärkt haben, man wolle den Kongolesen nicht den vollen Zugang zur westlichen Bildung gewähren. Der französische Afrikaexperte F. Charbonnier berichtete aus Leopoldville, er habe anfangs Juli, vor Ausbruch der Unruhen, das Empfinden gehabt, einer sozialen Revolution beizuwohnen, bei der eine neue Klasse an die Macht kam. Zu ungeniert
vhät*eH;dieuen!Herfen ihr Selbstbewußtsein an den Tag gelegt. Die ABAKO m ursprünglich Bewegung zur Erhaltung des Kikongo'gegen das belgischerseits als offizielle Verkehrssprache geförderte Lingala, zeigte seit mehreren Jahren antieuropäische Züge. Ihr Organ „Unser Kongo“ veröffentlichte während des Wahlkampfes den Satz: Während in der Vergangenheit Mulatten von schwarzen Frauen geboren worden seien, werde dies in Zukunft durch weiße Frauen geschehen. Andere Parteien haben, mehr demagogisch, die Hoffnung nach Übernahme des Besitzes der Kolonisten genährt. Der Stillstand des Wirtschaftslebens hat das bereits bestehende Arbeitslosenproblem gewaltig verschärft.
Die wirtschaftliche Krise des Kongo begann allerdings schon 1957 mit dem damaligen scharfen Rückgang der Exportpreise infolge der weltweiten Rezession. Die Investitionsbeteiligungen der Kongoregierung, die 1958 eine Rendite von 25 Millionen Dollar abwarfen, wurden damals noch mit 750 Millionen Dollar bewertet, sanken aber seither bis 1960 um 50 Prozent, während die Staatsschuld 850 Millionen Dollar erreichte. Zugleich hatte, während sich die Handelsbilanz wieder zu erholen begann, mit den ersten Vorzeichen der kommenden Unabhängigkeit ein steigernder Abfluß privater Kapitalien eingesetzt, der 1959 70 Millionen, zwischen 15. Dezember 1959 und 31. Jänner 1960 allein weitere 28 Millionen Dollar überschritt, während das Staatsdefizit 50 Millionen erreichte. Bis Anfang Juni war die Zahl der vordem 110.000 Weißen im Kongo auf 80.000 gesunken, aber schon damals schätzte der belgische Minister De Schrijver, daß mehr als 80 Prozent der Belgier den Kongo verlassen wollten. Nach einer Restriktion der Umtauschquoten für Kongofranken liefen 20.000 Ansuchen um Spezialquoten ein, und Beamten wurde bei Verlassen des Kongo der Verlust ihrer Pensionsrechte angedroht.
Die Flucht von weiteren 45.000 Europäern, ausgelöst durch die Panik über die Ausschreitungen der Meuterer, hat nun das Problem der fehlenden Kader brennend gemacht. Das Manifest der „Conscience Africaine“ von 1956 hatte festgestellt, Belgiens Freundschaft würde nicht nach den investierten Kapitalien, sondern nach der Hilfe auf dem Wege zur politischen Selbstbestimmung zu messen sein. Die Frage, wer den Kader ersetzen und die nötige Wirtschaftshilfe leisten wird, ist heute zu einer Schicksalsfrage Afrikas geworden.