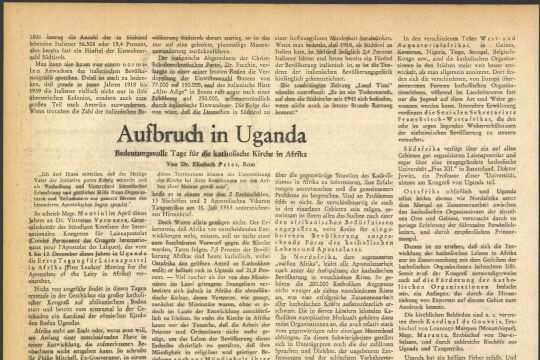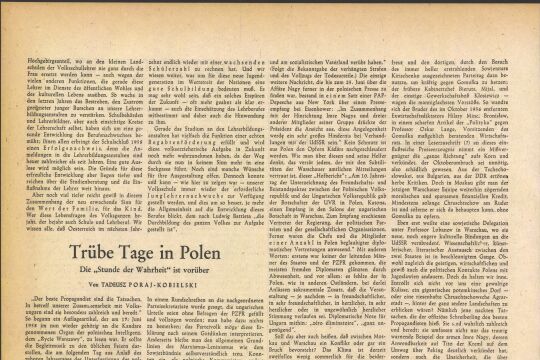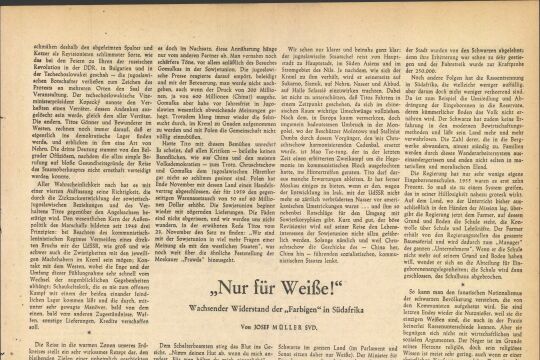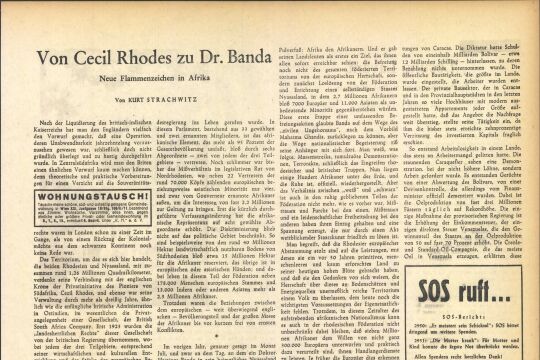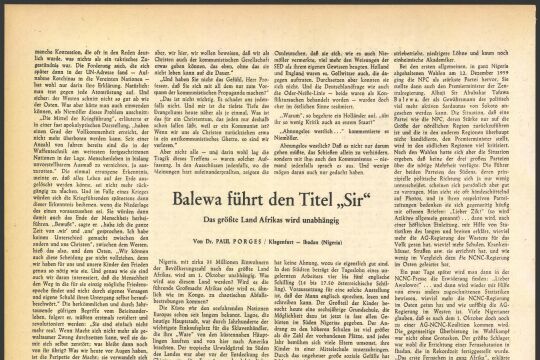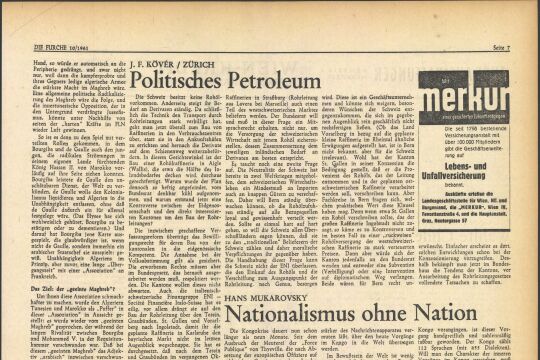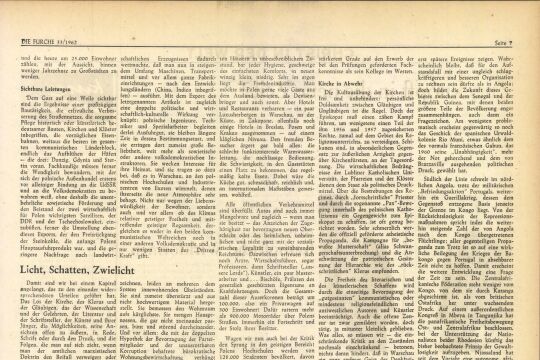Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Christen bestimmen mit
Am 9. Oktober wird mit der Unabhängigkeitserklärung Ugandas das fünfte der vordem britischen Protektoratsgebiete im schwarzen Afrika ein selbständiger Staat werden, fünf Jahre nach dem aus der einstigen, Goldküste hervorgegangenen Ghana (1957), Nigeria (1960), Sierra Leone und Tan-ganjika (1961). Mit dem letzteren zusammen wird Uganda der zweite der „Nachfolgestaaten“ des als „Bri-tisch-Ostafrika“ bekannten Länderverbandes sein, von denen zur Zeit nur noch die Insel Sansibar (auch sie auf dem Weg zur Umwandlung in eine Art konstitutioneller Monarchie) und das mit dem Erbe des Mau-Mau, der Siedlerfrage und stärkeren regionalen Gegensätzen belastete Kenya unter britischer Oberhoheit verbleiben. Mit einer Bevölkerungszahl von rund 6.5 Millionen Menschen auf einer Fläche, die mit 244.076 Quadratkilometern annähernd der der Bundesrepublik Deutschland (oder Ghanas) entspricht — davon allerdings ein Fünftel Seen- und Sumpfgebiet —, zahlt Uganda zu den dichtestbevölker-ten Ländern Afrikas, und sein alliähr-licher, natürlicher Bevölkerungszuwachs wird gleichfalls auf nicht weniger als drei Prozent geschätzt.
War die politische Entwicklung Ugandas zur Selbständigkeit durch das Fehlen eines schärferen Gegensatzes von Schwarzen und Weißen erleichtert, von denen kaum 10.000 im Land leben, besitzt Uganda doch seine inneren Probleme eigener Art. Die Welt vernahm von ihnen erstmals, als der einheimische Herrscher des südlichen der vier Landesteile, des im Protektoratsvertrag als Königreich anerkannten Buganda, Mutesa IL, sich den einheitsstaatlichen Bestrebungen der Kolonialregierung widersetzte und deshalb 1953 für die Dauer von zwei Jahren zwangsweise ins Exil gehen mußte. Tatsächlich hat ja vor allem der „Separatismus“ Bugandas, dessen traditionelles Notabeln-Parlament zuletzt Ende 1960 eine allerdings wirkungslos gebliebene „Unabhängigkeitserklärung“ abgab, die Entwicklung Gesamtugandas zur Selbständigkeit verzögert. Es scheint heute aber, daß dies nicht zum Nachteil geschehen ist.
Die „Bugandafrage“ war übrigens nur ein, wenngleich der augenfälligste Teil des sich aus der völkischen, sozialen und Wirtschaftsstruktur des Landes ergebenden Problems. Etwa die Hälfte der Bevölkerung, namentlich in der Süd- und Westprovinz, zählt — wie die schwarzen Afrikaner im ganzen Süden des Kontinents und auch westlich von Uganda — zu den Bantusprachen sprechenden Völkern, während die Nord- und Ostprovinz wie der südliche Sudan und Westkenya vorwiegend von n i 1 o t i-sehen Völkerschaften besiedelt sind. Sind diese lediglich in Dorf- und Sippenverbänden organisiert, wie dies bei nomadischen und halbnomadischen Völkerschaften der Fall ist, bestehen in den südlichen Landesteilen seit beinahe 500 Jahren organisierte, einheimische Staatswesen, deren Feudalstruktur sich durch die“ Überlagerung der ansässigen, Bodenbau treibenden Negerbevölkerung durch eingewanderte Viehzüchtervölker erklärt. So umfaßt auch die Westprovinz von Uganda die drei einheimischen, im Protektoratsvertrag (mit geringeren Privilegien als das mächtige Buganda) anerkannten Fürstentümer Toro. An-kole und Bunyoro. Zwischen diesem letzeren und Buganda besteht übrigens der Streitfall um sechs, bei der Grenzziehung durch die Protektoratsmacht Buganda einverleibten Bezirke, von denen jedenfalls zwei mehrheitlich von Banyoro bewohnt sind, und die die Bunyoro nun vergeblich zurückforderte, während Buganda sie durch eine verstärkte Einwanderung „gandaisieren“ wollte. Erst bei der letzten Ugandakonferenz in London konnte diese Streitfrage dadurch neutralisiert weren, daß diese beiden der sechs „lost counties“ der Autorität der Zentralregierung unterstellt werden.
Auch eine solche Lösung wäre freilich noch vor kurzem unmöglich gewesen, da Buganda sich seit jeher gegen eine Einschränkung seiner Autonomie durch die Zentralregierung sehr zur Wehr setzte, was übrigens angesichts der Entmachtung des Aschantiherrschers durch Nkrumah an der Goldküste durchaus verständlich war. Ähnlich war ja auch Buganda all Zentrum des Baumwoll- und Kaffeebaues und Sitz der wichtigsten Industrien das reichste und wirtschaftlich gesündeste Kernstück des Landes.
Erst 1961 gelang es der Protektoratsverwaltung, die Abhaltung allgemeiner Wahlen in ganz Uganda durchzusetzen. Die dem Kabaka von Buganda loyale Oberschichte rief zum Boykott dieser Wahlen auf, die sie nicht hatte verhindern können. Die Folge war aber, daß die „Demokratische Partei“ unter der Führung von Benedicto Kiwanuka mit einer geringen Zahl abgegebener Stimmen sämtliche in Buganda vergebenen Sitze zum Nationalparlament erringen und damit die absolute Mehrheit erreichen konnte. Der fortschrittlich-katholische Rechtsanwalt Kiwanuka (selbst ein Ganda) wurde damit, wiewohl er nicht die an Stimmen stärkste Partei des Landes führte, Ministerpräsident der ersten (halbautonomen) afrikanischen Regierung Gesamtugandas. Dies führte dazu, daß die konservativen (überwiegend anglikanischen) Kreise der autonomen Bugandaregierung die Nachwahl in dieser Provinz mit allem Gewicht mit der Parole „Kabaka yekka“ („Der Bugandaherrscher allein“) führten und ihre so benannte Partei erwartungsgemäß 15 der 20 auf Buganda entfallenden Mandate erringen konnte, so daß Kiwanuka seine parlamentarische Mehrheit wiederum verlor. Als Führer der stärksten Partei des Landes, des „Nationalkongresses von Uganda“, trat damit der aus dem Norden stammende, protestantische Lehrer Milton Obote als Ministerpräsident an die Spitze der nunmehr autonomen Regierung, die Uganda zur Unabhängigkeit führt, und in der die Kabaka-Yekka-Partei ihr Partner im Rahmen einer „kleinen Koalition“ ist, die „Demokraten“ da-gegen die Opposition bilden. Völkisch gesehen, Ji.atte so die, Spaltung der Bantu die Niloten des Nordens zur politisch bestimmenden Kraft des Landes werden lassen.
Mit einer verhältnismäßig großen Anzahl von Afrikanern mit höherer Ausbildung, die nicht nur in Übersee, sondern auch an der seit 1953 bestehenden University of East Africa in Makerere (Kampala) studieren konnten, steht Uganda den Kaderproblemen seiner kommenden Unabhängigkeit besser gerüstet gegenüber als andere afrikanische Länder. Es konnte zum Beispiel schon zahlreiche Stellen seiner staatlichen Sanitätsverwaltung mit einheimischen Ärzten besetzen. Wie aber zum Beispiel Kiwanuka in diesem Sommer in seiner Rede auf dem „Kongreß für wirtschaftliche Entwicklung und Partnerschaft“ in Salzburg erwähnte, hat die Regierung im Vorjahr nichtsdestoweniger ein Notprogramm von 300 Überseestipendien beschließen müssen, um bestehende Lücken in absehbarer Zeit auffüllen zu können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!