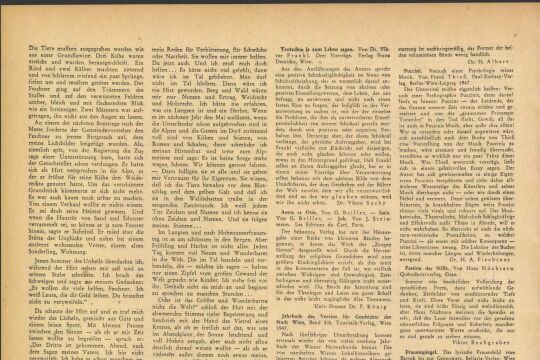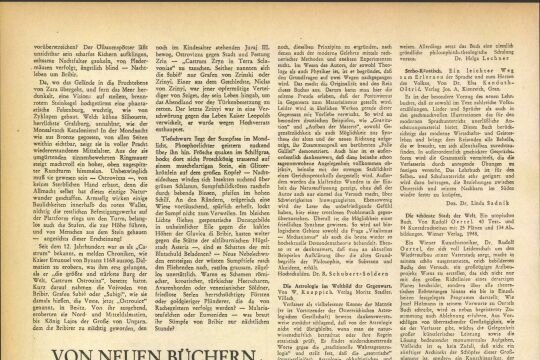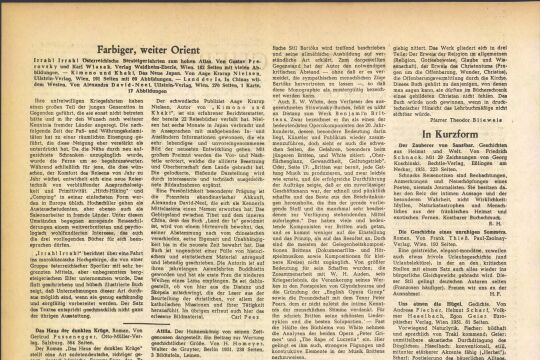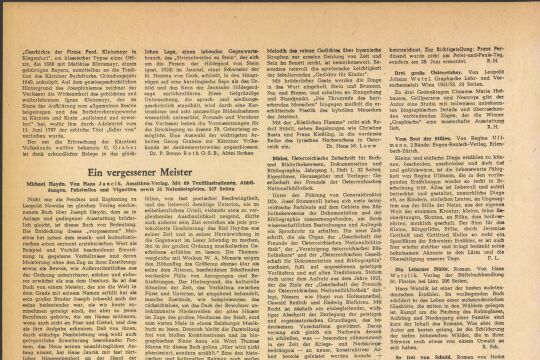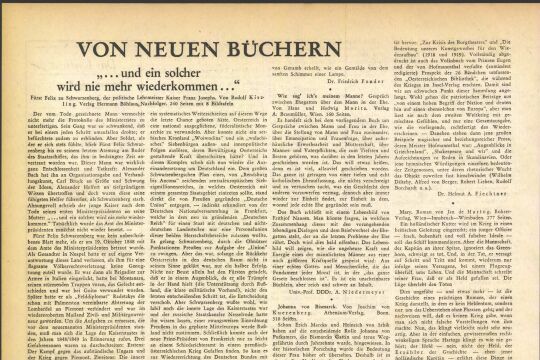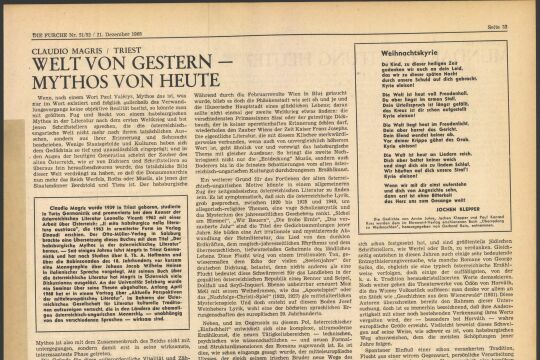Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein politischer Dichter
DAS STERNBILD. Gesammelte Werke von Josef Luitpold Stern. Im Europa-Verlar, Wien. 1965 65. Zehn Bücher In 5 Bänden au je zirka 460 Seiten. Preis pro Band S 150.—.
DAS STERNBILD. Gesammelte Werke von Josef Luitpold Stern. Im Europa-Verlar, Wien. 1965 65. Zehn Bücher In 5 Bänden au je zirka 460 Seiten. Preis pro Band S 150.—.
Nicht wie anderen Dichtem, Kul- turpolitikern und Publizisten ist es Josef Luitpold Stern gelungen, am Abend seines Lebens abgeklärt und über den Fronten stehend, noch einmal ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu treten. Zu seinem 80. Geburtstag, den er im April 1966 feiern konnte, war sein Werk und Wirken von der Parteien Haß und Gunst noch immer umstritten. Und nicht allein im großen Sieb aus schwarzroten Maschen blieb er hängen. Ein Bekenntnis zu ihm ist ein Wagnis, heute wie ehedem. Die Auguren reichen ihn als Roten Peter gerne weiter, und er selbst versteht sich trotz der vielen urösterreichischen Cha- raktenzüge nicht auf die konziliante Kunst des „Richtens“. Unter manchen Schwierigkeiten hat der Europa-Verlag eine für den Lesergebrauch akzeptable Gesamtausgabe der Werke zustandegebracht. Auch sie wird nicht imstande sein, das Urteil der Zeitgenossen auf einen halbwegs gemeinsamen Nenner zu bringen. Die Stellung zu Josef Luitpold Stern hängt nämlich von der Frage nach der Berechtigung einer politisch so stark engagierten Dichtung ab, daß sich der bloß ästhetische (oder wie bei Brecht snobistische) Genuß verbietet. Die Gegenwart, vor allem die junge Generation, aus bitterer Erfahrung distanziert und aus Bequemlichkeit ans politische Management gewöhnt, bevorzugt eindeutig eine Literatur, die sich zumindest voraussetzungslos gibt — auch wenn sie es nicht ist. Das missionarische Lebensgefühl ist in der linken Reichshälfte rapid dahingeschmolzen. Für fanatische Propagandisten hinwider ist heute das Dichterwort zu subtil. Die Wahltaktiker konsultieren lieber teure Psychologen und Statistiker. Die Soziologie ist akademisch geworden, und die Volksbildung gibt sich neutral. Wenig Platz also für Josef Luitpold Stern. Wenig Raum für den letzten politischen Dichter Österreichs in einer Welt Ohne politische Phantasie.
Daß man ihn unter solchen Umständen nicht völlig ins Museum verbannt, dankt der begnadete Volksbildner zum Teil den vielen Schülern, die an ihn große Erinnerungen knüpfen — zum Teil einer Lesergemeinde, die quer durch alle Weltanschauungen reicht und für die lyrische Aussage und die Menschlichkeit empfänglicher als für die Politik ist. Dazu kommt noch die Bedeutung, die Stern als eine Art Spiritual der sozialistischen Führungsgarnitur hatte und schließlich das organisatorische Verdienst um die Volkshochschulen und Büchereien der Stadt Wien.
Die Gesamtausgabe beginnt mit der frühan Lyrik und den lyrischen Selbstzeugnissen „Gesang vom kleinen Ich“. Der Wanderlehrer Luitpold zieht die Bilanzen seiner Tage. Ganz einfache Gedichte oft, Bilder aus dem Leben der Natur, der Liebe, der Arbeit. Darin das marxistische Ideal kommender Bildung und Weltbeglückung aufleuchtend. Doch hier noch ohne Pathos. Ein Buch Nachdichtungen „Babylonisches Entzük- ken“ trägt schon im Titel den Gestus des Aufklärichts. Luitpold Stern findet und entwickelt an diesen Versen seinen persönlichen, herb-ballades- ken Stil, er löst sich vom Lyrismus Heines und setzt den Rhythmus an die Stelle der Melodie. Spätestens gegen Ende dieses zweiten Buches fällt für den Leser die Entscheidung, ob er sich von diesem Stil ansprechen lassen will. „Herz im Eisen“ und „Schrei der Opfer“ gehen in Lyrik und Prosa hart mit der Tyrannei des ersten und zweiten Weltkrieges ins Gericht. Der Dichter war einer der wenigen, die sich 1914 gegen die poetische Begeisterung wandten. Ihm bedeutete Sozialismus Pazifismus. Tief enttäuscht wendet er sich in dieser Zeit von vielen Freunden — unter anderem dem von ihm entdeckten und geförderten Alfons Petzold — ab. Als Lyriker ahnt und entlarvt Luitpold die Barbarei. Als Politiker grüßt er heißen Herzens die Republik.
Der Nationalsozialismus treibt ihn in die Emigration. Seine Stimme tönt im Chor der verfolgten Juden. Ein österreichisches Schicksal wird, wie in so vielen Fällen dieser Jahre, durch Flucht und Leid und vor allem durch den Verlust der besten Mannesjahre für das kulturpolitische Wirken gezeichnet. In der „Rückkehr des Prometheus“ erreicht Luitpold Stern den Höhepunkt seines lyrischen Schaffens. Die Balladen, von denen das Kernstück 1927 erstmals erschien, wurden in mehreren Ausgaben um neue Stücke vermehrt. Sie umfassen in der Gesamtausgabe nun 117 Einzelgedichte. Der hymnische, psalmodierende Ton klingt feierlich und aufpeitschend zugleich. Das marxistische Sendungsbewußtsein ist zu religiöser Inbrunst gesteigert. Ein gewaltiger Revolutionsgesang!
Aber schon bricht sich die erhabene Hoffnung an ihrer Immanenz Die „Europäischen Tragödien“ zeigen den Dichter an den großen humanistischen Dramenvorwürfen, denen er nicht ganz gewachsen war. Der Schrei überschlägt sich. Die Stimme dreht durch.
Die vier letzten Bücher runden das menschliche und historische Bild. Die Anlage wird breit. Reden und Aufsätze von unterschiedlichem Niveau, zu verschiedenen kulturellen und politischen Anlässen, offenbaren an vielen Stellen eine überraschende Perspektive, eine Klarsicht der Persönlichkeit, ein pädagogisches Konzept, sprachliche Schönheit und dichterischen Schwung — sie zeigen aber auch journalistische Gemeinplätze, reine Tagesmeinungen, Zufälligkeiten und Subjektivitäten.
Eine Würdigung dieser Gesamtausgabe wäre unvollständig, er wähnte sie nicht auch die vielen Graphiken, die den Werken eine Art Lokalkolorit geben. Von Alfred Ku- bin bis Otto R. Schatz haben die Werke Luitpold Sterns eine Reihe namhafter Zeichner illustriert. Faksimiles von Gedichten, Titelblättern, Programmen und Briefen, Notenhandschriften der Komponisten, die zu Vertonungen vieler Gedichte inspiriert wurden, erleichtern dem Leser die Einfühlung in das geistige Milieu dieses Lebenswerkes. Die konservative Umschlaggestaltung und das modische Himmelblau des äußeren Gewandes passen wenig zu dem Charakter des Autors. Denn das „Sternbild“ meint nicht den ätherischen Kosmos einer sanften Nacht, sondern das Feuer künftiger Gestirne. Ein Dokument, noch in der Geistigkeit der Jahrhundertwende verwurzelt, ragt mit allen Schwächen und Vorzügen in die Gegenwart hinein. Daß es ein Bleibendes birgt, ohne in seiner Gesamtheit bleibend zu sein, muß allen Mißdeutungen zum Trotz nach rechts und links deutlich gesagt werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!