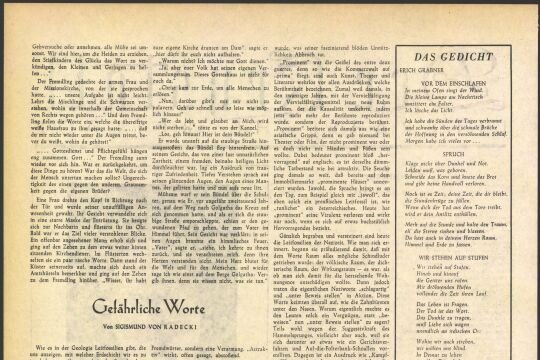Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Romands und Schwyzerdütsche
„Ceux d'outre-Sarine — die jenseits der Saane“, so heißen die französisch sprechenden Schweizer ihre Brüder schwyzerdütscher Zunge, dies zwar eher untereinander, während auf den Rednerkanzeln und in den Zeitungen die durchaus achtbaren Bezeichnungen „Confederes“ und „Compatriotes“ verwendet werden. Daß ein Grenzfluß zur Benennung herhalten muß, braucht man an und für sich nicht als sonderbar anzusehen. Die unterschiedliche Anwendung läßt aber vermuten, es gehe hier nicht eben darum, an eine geographische Tatsache zu erinnern.
Wirklich begann vor einigen Jahren ein satirisches Wochenblatt der Westschweiz, die geläufige Bezeichnung umdeutend, Deutschschweizerisches unter dem Titelkopf „Outre-Absinthe“ zu kommentieren. Darin steckt zunächst die Feststellung: Deutschschweizer sind Leute, die nicht Absinth trinken. Das verbotene Geträ' '; ist in der Westschweiz nämlich recht bekannt und ohne besondere Winkelzüge erhältlich. Wenn nun aber solch ein Titel dem „Romand“, dem Französisch sprechenden Schweizer, über Jahre hinaus am Platze und selbstverständlich erscheint, so besagt das recht viel .Es ist,mehr.und anderes als bloße brüderliche. Neckejei darin zu sehen: daraus sprechen ,e,nbKejt|mmte Art von Selbstbewußtsein, dazu Respektlosigkeit und ein Vorwurf. In den Kriegsjahren oder früher hätte eine solche Bezeichnung gar nicht erst entstehen können.
„WELSCHES MALAISE“
Zweifellos ist bei Deutschschweizern und Romands der gute Wille zum Zusammenleben vorhanden; ebenso zweifellos ist aber, daß es mit dem Zusammenleben nicht überall zum besten steht. Die Partner bagatellisieren dies nicht, sie dramatisieren es nicht, sondern vermeiden gewöhnlich einfach, die Rede darauf zu bringen. Versteht sich: um verwischt zu werden, ist die Sache zu ernsthaft, und sie zuzuspitzen, wäre niemandem dienlich. Es gibt ja weder im wirtschaftlichen leben noch in konfessionellen Belangen noch auch in der offiziellen Parteienpolitik zur Zeit Spannungen zwischen Deutsch und Welsch, so daß drei der wichtigsten Faktoren im Leben des Bundesstaates davon nicht berührt sind. Außerdem gründet die allgemeine Schweigsamkeit aber auch in mangelndem Verständnis, im Gefühl von Hilflosigkeit und in Unbehagen, und nur gelegentlich macht sich dergleichen Luft, indem etwa, wenn wieder einmal bei einer Abstimmung im einen oder anderen der welschen Kantone kaum ein Viertel der Stimmbürger sich an einem Urnengang beteiligt haben, die große Zeitung das Ergebnis mit einem Ausrufezeichen versieht, während der zur Vorsicht weniger gehaltene Provinzredakteur „Faule Welsche!“ darüberschreibt, oder „Wohin soll das noch führen?“, ohne aber nur irgendwie zu versuchen, der Sache auf den Grund zu kommen. Der ganze Komplex von Unstimmigkeiten ist registriert, mit einem Etikett beklebt, heißt „Das welsche Malaise“ (Unbehagen) und mehr oder Gründlicheres ist vorderhand nicht geleistet.
Leicht ließe sich dieses Unbehagen mit einem längeren Verzeichnis von Symptomen belegen. Hier eine kleine Auswahl:
Der Kommunismus ist in der Welschschweiz unverhältnismäßig viel stärker verbreitet als unter den Deutschschweizern.
„Ces messieurs de Berne“ - diese Redensart, nicht selten zu hören und, dem Tonfall nach, mit ..die sauberen Herren in Bern“ zu übersetzen, bringt einigermaßen reservierte Gefühle gegenüber eidgenössischen Verwaltungsstellen zum Ausdruck.
Als neulich an einem Parteitag die SP zur gewiß nicht unwichtigen Frage Stellung nahm, ob die schweizerische Armee mit Nuklearwaffen versehen werden sollte, und es ablehnte, so heiß zu essen wie gekocht wird, vielmehr vorläufig gar nicht selber zu kochen, da berichteten die nichtsozialistischen Blätter der Deutschschweiz davon sehr aufmerksam, die welschen dagegen in ein paar Zeilen — und ihrer etliche gar nichts
Der Romand, vor allem der junge, empfindet heute gewöhnlich die Wehrpflicht eher als Last und erledigt sie gern auf dem Weg des geringsten Widerstandes, sehr im Gegensatz zum unleugbar militärfreudigen Deutschschweizer. Bezeichnend dafür, daß es erhebliche Schwierigkeiten bietet, genügend welsche Offiziere und Unteroffiziere auszubilden.
Es ist auffällig, daß Westschweizer, die in den deutschen Sprachbereich einwandern, immer weniger Neigung zeigen, sich zu assimilieren, während die Einschmelzung im umgekehrten Fall leicht vor sich geht und auch seit jeher als selbstverständlich betrachtet wird.
SPRACHENPOLITIK - TERRITORIALITÄTS-Welch ..Haltung gegenüber seinen Confed,e,es | nimmt nun eigentlich der Deutschschweizer ein? Vernünftigerweise überlegt sich die Mehrzahl gar nicht, ob es da eine Haltung einzunehmen gelte: die andern- sind eben auch Schweizer, irgendwann und irgendwie zur Eidgenossenschaft geraten, wohnen im Welschland, sprechen französisch, sind etwas lebendiger und, wenn er sich an dort verbrachte Zeiten erinnert, doch ganz nette Leute. Wird aber das Denken angedreht, so nimmt er übel und findet ungehörig. Er nimmt das welsche Malaise übel, dessen Anzeichen, die ihm gerade begegnen, und dies einfach deshalb, weil er sich eben doch als älterer und stärkerer Bruder fühlt, der den jüngeren für ungezogen hält. Und als ungehörig empfindet er, wenn ihm der Welsche mit einem Superiori-tätsgefühl oder gar — -anspruch entgegentritt; davon zeugen häufige Klagen aus dem Bereich der Sprachgrenze, Klagen über ungerechtfertigte Dominanz von Romands in Verwaltung und Betrieben des Bundes, und — wie könnte es anders sein — Schulstreitigkeiten.
Im Berner „Bund“, einem der repräsentativsten Blätter, sind neuerdings Artikel über Artikel erschienen, die sich mit der Existenz einer französischen Schule in Bern befassen, darüber hinaus jedoch auch grundsätzlich zu Fragen deutsch-welscher Spannungen argumentieren. Die Schule ist privat, für Kinder von Diplomaten und welschen Beamten gedacht, und soll nun, als „Sonderfall“, unter Umständen neben kantonalen auch Bundesbeiträge erhalten. Darüber erklärte im Nationalrat der Justizminister, Bundesrat Feldmann: „Die kantonalbernerische Schulhoheit sollte keine unüberwindliche Schranke für den Sonderfall bilden, das Territorialprinzip der Sprachen sollte nicht rigoros interpretiert werden“, mahnend also, aus der Mücke nicht einen Elefanten zu machen.
Besagte Artikel stoßen aber heftig in ein anderes Horn. Es finden sich darin sehr instruktive Kernsätze:
„Das sogenannte Territorialitätsprinzip ist ein ungeschriebenes Grundgesetz unseres eidgenössischen Zusammenlebens. Es besagt, kein Sprachgebiet dürfe sich auf Kosten eines andern ausdehnen.“
„Eine französische Schule im deutschen Sprachgebiet schafft nicht Recht, sie schafft Unrecht!“
Wenn 'wir'das TetritoriaKrätsprinzip aufgeben, göfeenwiH -auch den Sprachfrieden auf.“
Daneben wird bewegte Klage geführt über das stetige Vordringen des Französischen auf Kosten des Deutschen (es ist leicht zu belegen), wird festgestellt, wie gering, verglichen mit jenem des Romand, das Sprachbewußtsein des Deutschschweizers sei, wird endlich vermutet, es sei
„die selbstbewußte Sprach- und Kulturpolitik Frankreichs“, welche hier die Romands zu einer falschen Abwehr nötige, und das welsche Malaise rühre wohl zu einem nicht geringen Teil vom wirtschaftlichen Uebergewicht der Deutschschweizer her.
Nichts hindert einen anzunehmen, daß solche Meinungen, an solcher Stelle vorgebracht, die Ueberzeugung vieler, wo nicht der meisten Deutschschweizer vermitteln.
DAS MISSVERSTÄNDNIS
Fragen des Zusammenlebens so zu erörtern, wie es zur Zeit in Bern geschieht, würde kaum einem Welschen einfallen; kaum einer würde darauf verfallen, seine Compatriotes über Schweizer Art und Tradition belehren zu wollen. Nicht allein sprachbewußt ist der Romand, sondern auch selbstbewußt. Daß die welsche Schweiz unter einem ökonomischen Uebergewicht der deutschen leide, läßt sich kaum beweisen, und daß sie gegen Sprach- und Kulturpolitik Frankreichs sich wehren müßte, darf im Ernst niemand behaupten; sie gehörte seit jeher zum französischen Kulturbereich, in aller Freiheit und ohne eine untergeordnete Rolle zu spielen.
Wichtig sind vielmehr die Tatsachen, daß bei den Welschen die Amerikanisierung des täglichen Lebens viel weiter fortgeschritten ist als in der deutschen Schweiz, daß seit dem Krieg auch ihre Lebensweise in beträchtlichem Maß auf die jüngeren Leute ausgerichtet ist, daß im allgemeinen die Landwirtschaft stärker rationalisiert wurde, daß die Leute viel eher als ihre deutschsprachigen Mitbürger bereit sind, mit der Zeit zu gehen, etwas zu riskieren, anstatt zunächst einmal abzuwarten und zu berechnen, was ihnen wieviel eintrage. Darum scheinen ihnen die Menschen d'outre-Sarine zu zahm, zu brav, zu schwerfällig, zu rückständig; von daher rührt ihr Ueberlegenheitsgefühl. Während der Deutschschweizer zum Glauben neigt, mit der Achtung vor dem Territorialitätsprinzip sei jeglicher Friede gewährleistet, während er für das welsche Malaise, wenn überhaupt. Erklärungen sucht, die seiner eigenen Denkweise naheliegen, geben für den Romand Lebensart und Zeitbewußtsein den Ausschlag.
Aus diesem Boden wuchs, in diesem Lichte versteht sich der eingangs zitierte Kalauer „Outre-Absinthe“. Von hier aus begreift sich auch das welsche Malaise besser: nicht als Unbehagen, sondern als Enttäuschung und Protest. So lange wird die politische Apathie andauern,' alsJnicht die'Spielformen de?1 politischen' Lebens, die seit Jahrzehnten eingeschliffenen, auf die veränderten Umstände ausgerichtet werden. Ob und in welchem Maße man in der deutschen Schweiz verstehen lernt, woran den Romands liegt, davon wird abhängen, wie sich die Dinge weiterentwickeln.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!