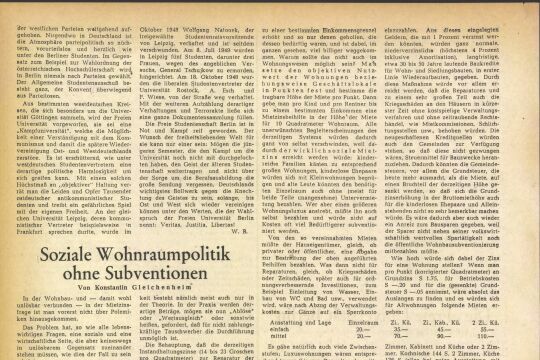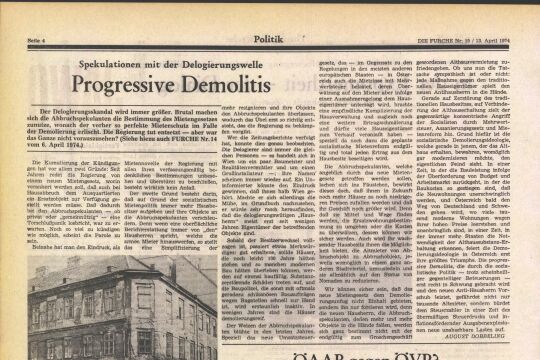Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Gegenreformation
Um die völlig verfahrene Wohnwirtschaft in Österreich behutsam wieder ins Geleise zu bringen, hatte die ÖVP-Regierung das Mietrechts-änderungsgesetz 1968 beschlossen. Gewiß haften dem Gesetz viele Schönheitsfehler an, aber der Grundgedanke war richtig: Das diffizilste Problem auf dem Althaussektor ist nämlich die Tatsache, daß sich Mieten und Instandhaltungskosten diametral auseinanderentwickelt haben; während die Mieten noch immer auf dem nominalen Niveau von 1914 eingefroren blieben, sind die Preise der Bauwirtschaft und der Baunebengewerbe schon seit 1938 explosionsartig hinaufgeschnellt, weit überproportional zur generellen Steigerung der Lebenshaltungskosten.
Aus dieser Diskrepanz ergibt sich heute bei jeder Hausreparatur eine plötzliche Vervielfachung der Hauptmietzinse in solchem Ausmaß, daß es für die einkommensschwächeren Schichten, insbesondere für die Pensionisten, oft problematisch wird, die Miete, die bis dahin eine quantite negligeable war, zu bezahlen. Daß hier unbedingt etwas geschehen müsse, um solche schlagartige, übermäßige Belastungen auszuschalten, war allen Sachkundigen seit langem klar.
Diese Zinserhöhungen erfolgen auf Grund des ominösen Paragraph 7 des Mietengesetzes, der dementsprechend unpopulär ist. Daher finden auch Slogans wie „Schafft den Paragraph 7 ab; wie kommen die Mieter dazu, dem Hausherrn das Haus herzurichten?“ immer enthusiastische Zustimmung.
Althaus, Bewohnerin: Der „graue Markt“
Auf der anderen Seite sieht aber auch das Mietengesetz vor, daß der Hauseigentümer jene Reparaturkosten, die das Niveau der fünfjährigen Mietzinsreserve zuzüglich des Hauptmietzinses der nächsten zehn Jahre — also der Zinseinnahmen von 15 Jahren — übersteigen, auf die Mieter überwälzen kann. Das Gesetz geht dabei von der Überlegung aus, daß dem Hauseigentümer, dem Einnahmen aus seinem Besitz versagt sind, auf der anderen Seite nicht zugemutet werden kann, Verluste zu tragen, die er auf Grund der Gesetzeslage nicht vermeiden kann und die er aus anderweitigen Einkünften zur Verfügung stellen müßte.
Der Zorn der Mieter entlädt sich naturgemäß auf den Hauseigentümer oder den Verwalter; sie sind es ja, die die Zinserhöhung beantragen müssen. Gerechterweise muß man allerdings zugestehen, daß es nicht ihr Verschulden ist: Was sollen sie wirklich machen, wenn heute Reparaturen zwanzig- oder dreißigmal so teuer als in der Vorkriegszeit sind? Die eigentlich Schuldigen sind die Initiatoren der Inflation, die freilich den Volkszorn geschickt auf andere Häupter zu lenken verstehen.
Die ÖVP-Regierung war bestrebt gewesen, die Einnahmen des Hauses, die für Reparaturen zur Verfügung gestellt werden müssen, zu vermehren, ohne eine generelle Mietenerhöhung riskieren zu müssen.
Um dieses Kunststück zuwege zu bringen, machte sie sich die Tatsache zunutze, daß sich infolge des Mietenstopps ein grauer Markt bei Neuvermietungen herausgebildet hat: Es wurden bekanntlich Ablösen gefordert, die sich Vormieter, Verwalter und Hauseigentümer teilten.
Durch Freigabe der Zinsbildung bei Neuvermietung sollten diese „schwarzen“ Gelder — zumindest ihr auf den Hauseigentümer entfallender Teil — weitgehend der Mietzinsreserve zugeführt werden. In der Praxis bedeutet das schon heute, daß in Häusern, in denen einige Wohnungen zu frei vereinbarten Mieten vergeben sind, das Paragraph-7-Gespenst bereits ziemlich gebannt ist.
Diesen Fortschritt wollen die Sozialisten nun wieder rückgängig machen: Bei Neuvermietungen soll — die an sich seltenen Großwohnungen ausgenommen — künftig nur noch das Doppelte des „Friedenszinses“ gefordert werden dürfen. Dies aber bedeutet nichts anderes, als die alte Paragraph-7-Misere überall im vollen und angesichts der Inflation sogar noch in immer stärkerem Maße Wiederaufleben zu lassen.
Dennoch wird die geplante Mietenreform großspurig als Entschärfung des Paragraph 7 propagiert. Dies deshalb, weil die Obergrenze des zulässigen Vielfachen des Mietzinses mit dem Zwölffachen des „Friedenszinses“ — also des noch heute gültigen Hauptmietzinses aus dem Jahr 1914 — limitiert und eine Subvention jenen Altmietern aus Steuermitteln gewährt werden soll, deren Zins auf mehr als das Sechsfache des Friedenszinses steigt.
Solche Bestimmungen klingen theoretisch sehr erfreulich, werfen aber in der Praxis eine Unzahl von Problemen auf: Angesichts der munter weiter trabenden Inflation werden die beiden genannten Obergrenzen bei Reparaturen immer schneller und immer häufiger erreicht werden. Auf unsere ohnehin schon zerrütteten Staatsfinanzen, die durch die Neubaufinanzierung schwer belastet sind, kommen unabsehbare zusätzliche Lasten nun auch auf dem Althaussektor zu. Zweifellos werden zwecks Entlastung des Budgets die Obergrenzen sehr bald nach oben gerückt werden müssen; schließlich hat sich ja auch der subventionierte Neubau für die Wohnungswerber im Lauf der Jahre sprunghaft verteuert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!