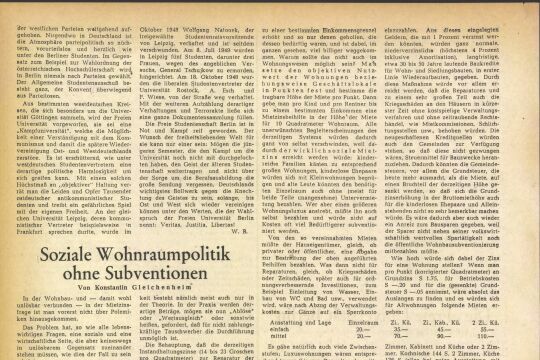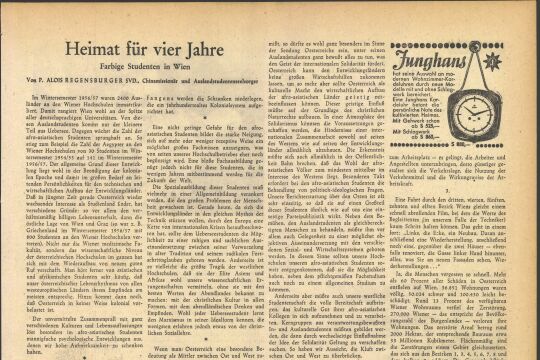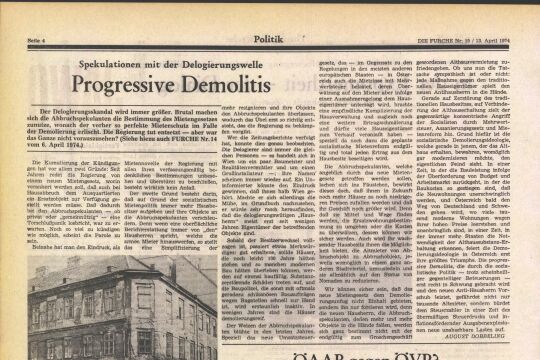Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Genosse Hausbesitzer will höhere Mieten
„Die Wohnung ist keine Ware.“ Dieses gut gemeinte Schlagwort, mit dem die Sozialisten durch Jahrzehnte alle Bestrebungen zur Neuordnung des Mietrechts abgeblockt haben, hat in der Praxis bereits zu verheerenden Auswirkungen geführt: Wertvoller Althausbestand ist dem Verfall preisgegeben, Bodenspekulanten treiben ihr Unwesen und für die Mehrzahl der Mieter sind die alles andere als sozial.
„Die Wohnung ist keine Ware.“ Dieses gut gemeinte Schlagwort, mit dem die Sozialisten durch Jahrzehnte alle Bestrebungen zur Neuordnung des Mietrechts abgeblockt haben, hat in der Praxis bereits zu verheerenden Auswirkungen geführt: Wertvoller Althausbestand ist dem Verfall preisgegeben, Bodenspekulanten treiben ihr Unwesen und für die Mehrzahl der Mieter sind die alles andere als sozial.
Wenn Sozialisten heute darüber nachdenken, welche Wohnungsmieten den Österreichern zugemutet werden können, dann tun sie das auch im Bewußtsein, daß die Stadt Wien mit rund 200.000 Gemeindewohnungen der Nation gewaltigster Hausherr ist. Um mehr als eine halbe Milliarde Schilling muß der Hausherr Wien pro Jahr mehr für die Gemeindebauten ausgeben, als aus den 200.000 Wohnungen an Einnahmen zu erzielen ist.
Wie für jeden „ausbeuterischen Zinsgeier“ steht nun auch die Gemeinde Wien vor der recht nüchternen Alternative: Entweder man 'schießt weiterhin Millionensummen aus dem Steuertopf in den Budgetposten „Gemeindewohnungen“ (ohne damit auch nur annähernd verhindern zu können, daß einst wertvolle Bausubstanz dem Verrotten überlassen bleibt) oder man ordnet den Mieten-Dschungel neu.
Es muß etwas geschehen, darin sind sich alle einig: die privaten Hausbesitzer, die vielen älteren Menschen noch aus der SP-Bropaganda der Zwischenkriegszeit als der Inbegriff des Klassenfeindes in Erinnerung sind, ebenso wie die Gemeinde Wien.
Hauptursache des seit fast drei Jahrzehnten andauernden Mieten-Chaos ist es, daß die gesetzlich niedrig gehaltenen Mieten heute noch aufgrund jenes Mietzinses zu ermitteln sind, der für den jeweiligen Mietgegenstand am 1. August 1914 vereinbart war. Das bedeutet, daß für die Berechnung des Quadratmeter-Preises die alte Kronen-Währung herangezogen und ein Quadratmeter mit einer Krone gleichgesetzt wird.
Bis 1951 wurde eine Krone mit 27 bzw. 30 Groschen gleichgesetzt. Mit der Zinsstopp-Regelung von 1951 lautete die bis heute gültige Gleichung 1 Krone = 1 Schilling. Zum Ausgleich für die damit eingetretene faktische Erhöhung der Mieten wurde 1951 auch die Wohnungbeihilfe von 30 Schilling pro Monat eingeführt.
Zur Verwirrung auf dem Mietensektor trägt aber bei, daß heute die Mehrzahl der Mieter in Wahrheit viel mehr als einen Schilling je Quadratmeter und Monat zu berappen hat. Die berühmten Zimmer-Kuchl-Ka-binett-Wohnungen um 30 Schilling pro Monat gibt es schon noch, aber die Ausnahmen sind auch in diesem Bereich zur Regel geworden:
• Der bereits legendäre § 7 des Mietengesetzes ermöglicht es, wenn die „zur ordnungsgemäßen Erhaltung des. Miethauses erforderlichen Auslagen“ die Einnahmen übersteigen, durch ein gerichtliches Verfahren eine Erhöhung der Mietzinse zu erreichen. Fritz Hahn (ÖVP), Zweiter Landtagspräsident von Wien, schätzt die Zahl der bereits nach § 7 erhöhten Mietzinse auf etwa 170.000 allein in Wien. Josef Windisch, Obmann der SPÖ-nahen Wiener Mietervereinigung, schätzt sogar, daß zwei Drittel aller Wiener Mieter einen nach § 7 erhöhten Mietzins zu zahlen haben.
• Dafür, daß der Regelfall der Friedenszins-Mieten zum Ausnahmefall wurde, ist auch die Mietrechtsreform von 1968 mitverantwortlich: Damals wurde im Nationalrat gegen die Stimmen der oppositionellen SPÖ beschlossen, daß bei einer Neuvermietung der Mietzins frei vereinbart werden kann.
Daß die Mieten-Szene heute alles andere als ein soziales Gesicht trägt, scheint auch sämtlichen Beteiligten klar zu sein. Die panische Angst, daß die Wohnung zur Ware werden könnte, hat dazu geführt, daß heute die Wohnungskosten in ganz und gar unsozialer und ungerechter Weise auf die Bevölkerung verteilt sind:
• Alte, oft alleinstehende Leute mit unterdurchschnittlichem Einkommen wurden in den letzten Jahren oft in voller Wucht von §-7-Erhöhungen getroffen. Solcherart wurden Friedenszinse nach Angabe des ÖVP-So-zialsprechers Walter Schwimmer (er ist auch Obmann des Mieter-, Siedler-und Wohnungseigentümerbundes) auf den bis zu 35fachen (!) Wert erhöht. Staatliche Mietzinsbeihilfen haben da den Effekt des Tropfens auf den heißen Stein; Mietern mit geringem Einkommen bleibt oft nur das Räumen der Wohnung als letzte Alternative.
• Junge Leute, die einen Haushalt gründen, müssen heute schon damit rechnen, daß für sie nur frei vereinbarte Mieten in Frage kommen. Mit Wohnungsmiete und Betriebskosten sind junge Familien häufig in der Höhe eines Drittels ihres Gesamteinkommens belastet.
• Auf der anderen Seite gibt es dann aber doch noch tausende Mieter (nicht nur die berühmte „Hofratswitwe“, die noch drei Zimmer an Studenten weitervermietet), die große Altbauwohnungen zum Friedenszins besitzen und außerdem, weil ihr Haus gut „in Schuß“ ist, die Chance haben, nicht so bald mit dem § 7 Bekanntschaft zu machen.
Leider ist es in den letzten Jahren nur bei leeren Ankündigungen geblieben. In seiner Regierungserklärung vom 5. November 1975 etwa erklärte Bundeskanzler Bruno Kreis-ky: „Die Bundesregierung wird die Mietrechtsreform weiterführen.“ Auch Justizminister Christian Broda hat am 24. April 1976 der Mietervereinigung zugesagt, der Gesetzentwurf werde zur „Halbzeit der Gesetzgebungsperiode parlamentsreif gemacht werden“. Es war nicht der Fall.
Nun erst scheinen die Reformpläne doch in die Zielgerade zu kommen: Zunächst servierte Justizminister
Broda einen Vorschlag, der die berüchtigten §-7-Verfahren durch ein neues Ansparsystem überflüssig mache sollte. Plausibel ist daran der Grundgedanke, daß mit den jetzigen §-7-Verfahren hohe Kreditkosten verbunden sind. Spart man die Summe an, kann man wenigstens die Kreditzinsen vermeiden.
Gegen diesen Broda-Vorschlag gibt es aber vehemente Widerstände in allen Parteien: Weil er auf Freiwilligkeit beruht, aber die Mehrheit der Mieter eine Minderheit zum Sparen zwingen könnte (SPÖ-Windisch); weü er auf eine Vorwegnahme der §-7-Erhöhung hinauskommt (ÖVP-Schwimmer); weil schließlich die Aussicht besteht, daß ein zentral gelenkter Fonds über die angesparten Gelder verfügen würde.
Wesentlich näher kommen einander dagegen die Positionen der von Windisch geführten Mietervereinigung und der Volkspartei: Eine Erhöhung im Vergleich zum Friedenszins nimmt man als gegeben an, doch ist der Friedenszins ja heute bereits die Ausnahme. Die ÖVP ist laut Schwimmer dafür, daß für Neuvermietungen die freien Mietzinsvereinbarungen aufrecht bleiben, allerdings mit richterlichen Mäßigungsrecht. Zu einer neuen Mietzinsbildung soll es auch kommen, wenn eine Wohnung an die nächste Generation übertragen wird. Nur Witwen bzw. Witwer sollen vom verstorbenen Eheteil noch den alten Friedenszins übernehmen dürfen.
Auch Josef Windisch ist für eine neue Mietzinsregelung: „Der Mietzins soll ausreichen, um die Erhaltung eines erhaltungswürdigen Hauses zu ermöglichen, weü auch der Mieter daran interessiert ist, daß ihm sein Obdach erhalten bleibt.“
Einig scheint sich die Mietervereinigung mit der ÖVP auch dahingehend zu sein, daß es für die Neuberechnung der Mietzinse mehrere Qualitätskategorien geben soll; Windisch kann sich vorstellen, „daß es zwischen drei und fünf Kategorien gibt“. Denkbar ist freilich, daß die neuen Mieten so bemessen werden, daß die Gemeinde Wien ihr Auslangen findet, die meist älteren Häuser der „Privaten“ aber auch damit nicht gerettet werden können.
Brisant wird die Sache dort, wo sie an gesellschaftspolitische Demarkationslinien stößt. Eine solche Linie ist die Frage, ob ein Hausbesitzer aus der Vermietung der Wohnungen einen Gewinn ziehen soll und darf. Windisch ist hier der Meinung, daß der Mietzins zur Gänze der Erhaltung des Hauses dienen muß: „Ein Haus ist neben Gold immer noch die beste Kapitalanlage.“ Ein kleines Trostpflaster hält er parat: Die Verwaltungsgebühren könnten von vier Schilling pro Quadratmeter und Jahr auf einheitlich 900 Schilling pro Jahr erhöht werden - ein kleines Taschengeld für die Hausherren sozusagen.
Eine solche Regelung würde freilich dazu führen, daß dereinst nur noch Gemeinden, Versicherungen, Banken und sonstige Institutionen Häuser besitzen und Wohnungen vermieten. Daß dann auch die Abän-gigkeit der Bürger von staatlichen Stellen und Institutionen zunimmt, ist keine Greuelpropaganda, sondern Realität.
Dem steht der Vorschlag der ÖVP gegenüber, von den Mieten sollen etwa 75 Prozent der Erhaltung des Hauses dienen, der Rest sei der Ertrag des Hausbesitzers. Vermutlich ließe sich über diesen Aufteilungsschlüssel reden. Ein gewisser Anreiz für den Hausbesitzer, die Wohnungen zu vermieten, das Haus zu erhalten und gut zu betreuen, scheint aber doch am Platz zu sein. Die Nachteile einer städtischen Lebensform, in der es kaum noch private Hausbesitzer gibt, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Es sind schon genügend Hausherrn g'storben...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!