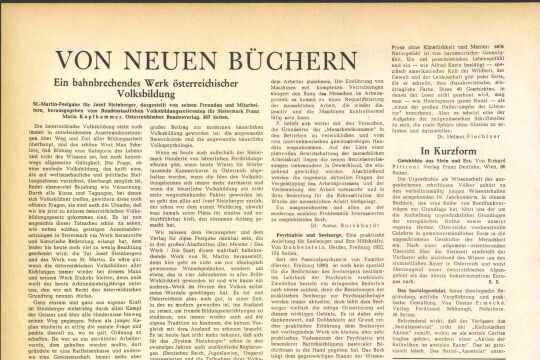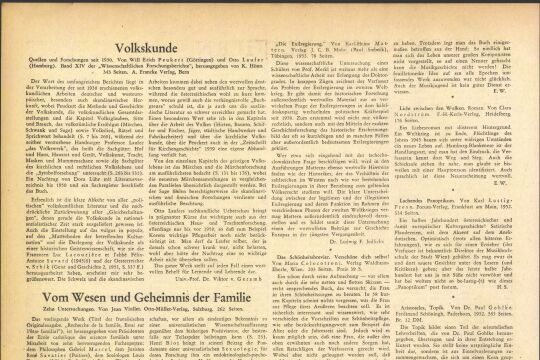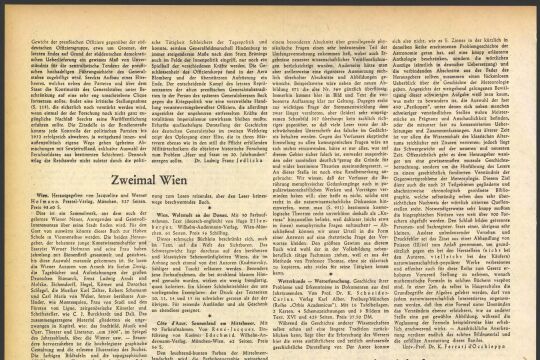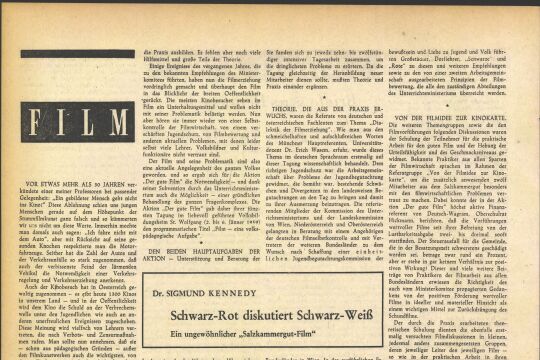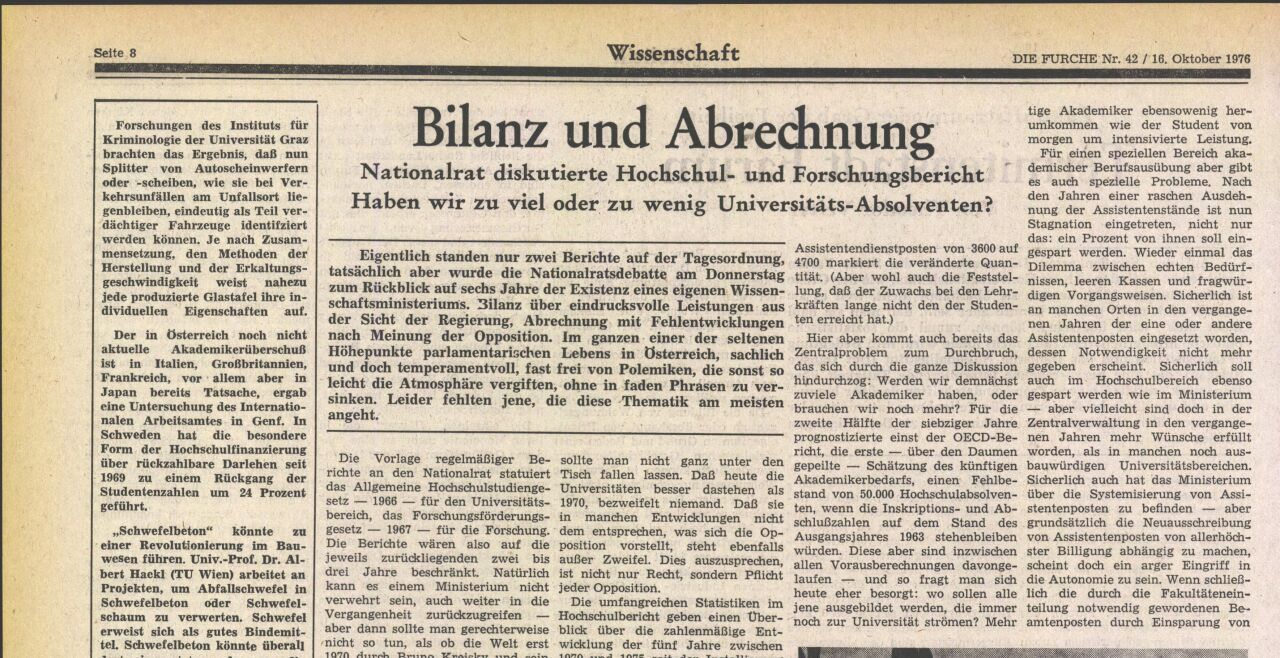
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die meßbare Magie
„Die Theaterwissenschaft ist in die Jahre gekommen. Was ihr nicht geschadet hat. Im Gegenteil. Denn mit den guten Weinen teilen die Wissenschaften die Eigenschaft, daß ihr jGebrauchswert' mit zunehmendem Alter wächst.“ Mit diesen optimistischen Worten beginnt Professor Klaus Lazarowicz, Vorstand des Instituts für Theaterwissenschaft, ein in der Reihe „Münchner Universi-tätsschrifteh“ erschienenes kleines Heft „Theaterwissenschaft heute“. Ein paar Seiten weiter trifft er dann die nüchterne Feststellung, daß „die praktische Ausbildung des akademischen Theater-Nachwuchses immer noch völlig unzureichend“ ist — um mit dem resignierenden Hinweis zu schließen, „daß vor einem Studium der Theaterwissenschaft angesichts des auf dem Theatermarkt herrschenden katastrophalen Mißverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage nur mit allem Nachdruck gewarnt werden kann“.
Wie erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch zwischen der kulturpolitischen Bedeutung einer Wissenschaft, die heute nur an drei deutschen Universitäten: in München, Köln und FU-Berlin — außerdem an der Universität Wien — als Hauptfach studiert werden kann, und den in Wahrheit miserablen Zukunftsaussichten für studierte Theaterleute? Ist das schmale Band: Dramaturgie, Regie, Kritik, auf dem der akademische Theater-Nachwurchs sich eines Tages zu bewegen hat, angesichts ständig schrumpfender Kul-tur-Etate ohnehin in Gefahr, zu reißen? Liegt's also schlicht und einfach an den „Verhältnissen“, wenn die Theaterwissenschaft sich in ihrem eigenen Bezugsfeld ins Abseits gedrängt sieht? Oder war die Nabelschnur zwischen Wissenschaft und Praxis des Theaters in wechselnden Zeitläufen nicht immer fest und stabil genug?
Die Theaterwissenschaft, die hier in München unter Professor Arthur Kutscher zu Rang und Namen gelangte, ist, wie die meisten geisteswissenschaftlichen „Kleinen Fächer“, ein überaus forschungsintensives Terrain: Hier — und nicht in der möglichst rentablen Heranbildung möglichst vieler graduierter Theatermacher — liegt seine eigentliche unverzichtbare Bedeutung. Während die Theaterwissenschaftler der ersten Stunden sich aus naheliegenden Gründen vor allem mit der Historie des Theaters, mit der Erschließung von geschichtlichen Quellen und Denkmälern befaßten, setzten sich in den letzten 30 Jahren immer mehr hautnahe Forschungsziele und eine methodische Disziplinierung des Fachs durch. Damit wurde auch das polare Spannungsverhältniszwischen
Schauspielern und Zuschauern für die Wissenschaft (wieder) entdeckt.
Exakt auf diesem Gebiet liegt ein Forschungsprojekt „Kommunikationsvorgänge beim darstellenden Spiel“, das Anfang 1976 am Münchner Institut für Theaterwissenschaft systematisch in Angriff genommen wurde. Ausgangspunkt der Forschungen ist eine Dissertation von Heribert Schälzky, Assistent am Institut, die auf monatelangen Produzenten-und Rezipientenbefragungen fußt.
Was sich im Wortlaut des Forschungskonzeptes wie Fachchinesisch liest, läßt sich leicht in Erfahrungen und Erlebnisse übersetzen, die jeder Schauspieler, jeder Theaterbesucher kennt: Die Darsteller der Bühne „denken sich was dabei“, wenn sie spielen, und sie fühlen genau, ob und wie sie damit im Parkett „ankommen“. Die Zuschauer ihrerseits „reagieren“: positiv oder negativ, spontan oder reserviert, je nach individuellem Temperament.
Ziel und Zweck des neuen Forschungsprojekts ist also, mit den Mitteln der Wissenschaft zu eruieren, unter welchen Bedingungen eine Verständigung zwischen Darstellern und Zuschauern optimal funktioniert, und dabei auch festzustellen, ob sie scheitert und woran sie scheitert. Dieses zunächst vage Hin und Her soll systematisch erfaßt werden.
Hiezu betont Professor Lazarowicz: „Wir arbeiten bei unserem Forschungsprojekt, das in seiner Art in Europa einzigartig ist, ausschließlich mt soziologischen Methoden: Beide Seiten, Darsteller und Zuschauer, werden befragt oder gemessen.“
Hiezu bedient man sich dreier Wege der Datenerfassung: • Mit Hilfe von Gruppen wird ein Polaritäts-Profil oder Eindrucksdifferential erstellt. Fragebogen werden einmal vor der Aufführung (zur Ermittlung der Erwartungen des Zuschauers) und einmal nach der Aufführung (zur Einholung seines Urteils über das szenische Produkt) ausgegeben und wieder eingesammelt. Auch die Schauspieler erhalten das gleiche Merkmals-Profil zweimal hintereinander, um ihre Intentionen (vor der Aufführung) und ihre Beurteilung des eigenen Produkts (nach der Aufführung) mitzuteilen. Auf diese Weise liegen nach Ende einer Vorstellung vier verschiedene Antwort-Komplexe aus vier verschiedenen Perspektiven zum jeweiligen szenischen Gegenstand vor.
•Bei elektrophysiologischen Tests werden die Versuchspersonen im Zuschauerraum jeweils an Elektroden angeschlossen, sei es zur Kontrolle der Atemtätigkeit, zur Herstellung eines EKG oder zur Ermittlung des Psychogalvanischen Hautreflexes (PGR), bei dem die Oberflächenspannung der Haut gemessen wird, die sich je nach psychischer Aktivierung des Zuschauers ändert.
•Mit Hilfe des Program-Analyzers, einer amerikanischen Erfindung, die ursprünglich für Hörfunk-Tests verwendet und später auch zu Film-Analysen eingesetzt wurde, ist eine weitere Möglichkeit der Messung von Publikumsreaktionen gegeben: Die Zuschauer drücken Zustimmung oder Ablehnung in einzelnen Phasen des theatralen Prozesses durch Bedienung jeweils einer von zwei Tasten eines Aufzeichnungsgerätes aus.
„Zur Praktizierung der verschiedenen Methoden machen wir öffentliche Aufführungen auf der Studiobühne, die jedermann besuchen kann — wobei erwünschte Serienproduktionen gewisse Unsicherheits-faktoren selbstverständlich heruntersetzen: Bis jetzt brachten wir's zweimal zu je sieben Aufführungen desselben Stücks.
Grundsätzlich müssen wir hier Wert darauf legen, uns nicht auf ungeheuren Aufwand zu versteifen, sondern Stücke mit wenigen Personen und verhältnismäßig einfacher Dekoration auszusuchen. Die Fülle der Informationen, die bei jeder Aufführung von der Bühne ausgehen, ist so groß (es wird gesprochen, gestikuliert, gelaufen, getanzt), daß es zweckmäßig erscheint, die Summe der ausgesendeten Zeichen bei der für eine Untersuchung ausgewählten Inszenierung möglichst klein zu halten. Generell muß unser Test-Verfahren eines Tages zwar an jeder Aufführung praktikabel sein — wir wollen schließlich aus der Retorte heraus und ein ganz normales Publikum testen. Für Forschungszwecke aber müssen wir uns einstweilen auf solche Stücke beschränken, deren Zeichensprache sich in relativ engen Grenzen hält.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!