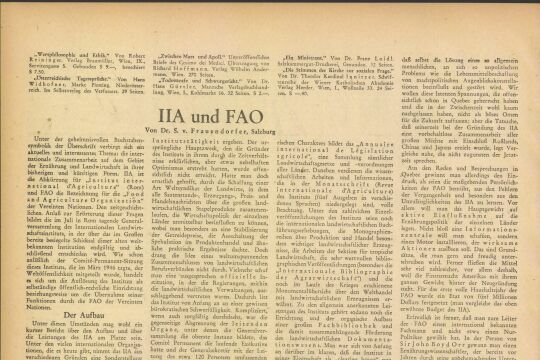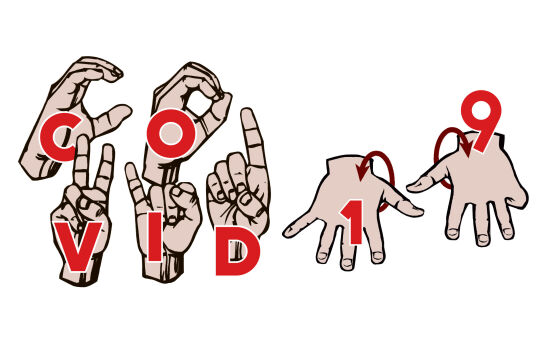Zum Welternährungstag am 16. Oktober ist die Bilanz im Kampf gegen den Hunger miserabel: 1,2 Milliarden Menschen leiden an Hunger und Unterernährung – mehr als jemals zuvor.
In Guatemala verhungern Menschen, obwohl es ausreichend Lebensmittel gibt. Hunderttausende Familien sind vom Hungertod bedroht, die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren – fast ausschließlich Indígenas der verschiedenen Maya-Völker – ist bereits chronisch unterernährt. „Es gibt genügend Lebensmittel, aber die Betroffenen haben nicht das Geld, um sie zu kaufen“, sagt Alvaro Colom, der Präsident des mittelamerikanischen Landes. Deswegen hat er die Weltgemeinschaft um Lebensmittelhilfe gebeten und den Hungernotstand ausgerufen. Als Ursache der Krise nennt Colom eine Dürre im Osten des Landes, die große Teile der Mais- und Bohnenernte vernichtet habe.
Doch die Erklärung des Präsidenten greift zu kurz und lässt vor allem seine Rolle am tödlichen Desaster außen vor. Die Dürre mag die Lebensmittelversorgung erschweren, die tatsächlichen Ursachen für den Hunger in Guatemala liegen jedoch nicht in den ausgetrockneten Ackerböden des Landes, sondern in einer völlig fehlgeleiteten Politik.
Das bestätigt auch Olivier de Schutter. Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung war vergangenen Monat auf Erkundungsreise in Guatemala. Von der FURCHE bei einer Pressekonferenz in Wien darauf angesprochen, beschreibt er die dortige Ernährungssituation nahe dem „worst-case-scenario“, also vor dem völligen Kollaps.
Reiche Eliten für Hungerkrise verantwortlich
Dafür verantwortlich sind laut de Schutter „strukturelle Ursachen“: Das Land hat zwar ausgefeilte Anti-Hunger-Gesetze und die Präsidentengattin leitet ein soziales Superministerium, zu dessen medialen Aushängeschildern ein Vorzeigeprogramm zur Hunger- und Armutsbekämpfung gehört – diese Pläne und Programme finden ihren Niederschlag aber nur auf dem Papier, bemängelt de Schutter. Und das ist bekanntlich geduldig, während die Menschen verhungern.
Oliver de Schutter spannt den Bogen an Verantwortlichen für die Hungerkrise aber noch weiter: Guatemala hat die niedrigste Steuerrate in Südamerika, sagt er; dadurch fehle jedoch das Geld für staatliche Sozialprogramme, ergo, so de Schutter, sind die „reichen Eliten des Landes für diese Hungerkrise verantwortlich“. Und noch etwas stößt dem „Recht auf Nahrung“-Anwalt der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit Guatemala bitter auf: Die dortige Regierung hat trotz zahlreicher Anzeichen für eine kommende Hungerkrise über Wochen hinweg nicht reagiert – bis völlig ausgezehrte Kinder in die Spitäler eingeliefert wurden und dort den Hungertod gestorben sind.
Anderer Kontinent, gleiches Thema, anderes Land, gleiches politisches Versagen, Hungertote da wie dort: Das Welternährungsprogramm WFP hat um die Bereitstellung zusätzlicher Gelder gebeten, um Hilfen für fast vier Millionen Hungernde in Kenia finanzieren zu können. Nach dem nahezu vollständigen Ausfall der Regenzeit und der vierten schlechten Ernte in Folge stehen die „Alarmzeichen auf Rot“, meldet das WFP: „Die Menschen hungern, mehr und mehr Kinder sind unterernährt, das Vieh stirbt.“
So wie in Guatemala ist die Hungerkrise aber auch in Kenia nicht unerwartet gekommen. Bereits im Vorjahr haben nationale und internationale Beobachter gewarnt – doch die Politik war mit dem Machterhalt im Anschluss an die Unruhen nach den Präsidentenwahlen beschäftigt.
Das sei auch der Grund dafür, dass Kenia als eines der am höchsten entwickelten Länder in Sub-Sahara-Afrika nach wie vor von ausländischer Lebensmittelhilfe abhängig sei, meint der Lebensmittelsicherheit-Experte James Nyoro in einem Gespräch mit der Financial Times vom letzten Wochenende: „Jedes Mal, wenn eine Hungerkrise kommt, erklären wir sie als nationale Katastrophe – als ob wir nicht gewusst hätten, dass sie kommt.“ Für Nyoro ist dieser Fatalismus unverständlich, denn „Kenia hat keinen Mangel an Ideen, Studien oder technisch qualifiziertem Personal.“ Woran es aber fehle, „ist der politische gute Wille“.
Mit dieser Schlussfolgerung stößt der Kenianer in das gleiche Horn wie das Experten-Panel bei der bereits genannten Pressekonferenz zum Thema „Ernährungssicherheit in Zeiten der Krise“. In Wien wie in Nairobi steht die Politik am Pranger, wenn es um die Schuldzuweisung für Hungerkatastrophen geht. Der generelle Vorwurf lautet, dass die Politik die Lebensmittelversorgung in den letzten Jahrzehnten zu wenig im Blick gehabt habe. Die Überproduktion in der nördlichen Hemisphäre hat die prekäre Ernährungssituation im Süden aus der Wahrnehmung verschwinden lassen. Dass der Anteil der Landwirtschaft an der globalen Entwicklungszusammenarbeit nur mehr fünf Prozent ausmacht, ist ein deutlicher Beweis dafür. In den 1980er Jahren waren es noch 17 Prozent. Zu diesem Wert will die „Food and Agriculture Organization“ (FAO) der Vereinten Nationen so schnell wie möglich zurückkommen. Doch mit den Zielvorgaben der FAO hat es so sein Problem: Sie werden nicht erreicht. 1996 hatte sich die FAO das Ziel gesetzt, die Zahl der Hungernden bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Das Gegenteil ist eingetreten. Anstatt weniger, gibt es heute mehr hungernde Menschen auf der Welt.
30 Länder in einer Ernährungskrise
2009 wird die Zahl der an Hunger und Unterernährung leidenden Menschen um weitere 105 Millionen auf weltweit 1,2 Milliarden steigen – das heißt, einer von sechs Menschen auf der Erde muss hungern. Seit Juli befinden sich 30 Länder in einer Ernährungskrise, davon 20 Länder in Afrika und zehn in Asien sowie dem Nahen Osten.
Um das Schlimmste zu verhindern, hat der G8-Gipfel im italienischen L’Aquila 20 Milliarden US-Dollar zugesagt, um die Nahrungsmittelproduktion anzukurbeln. Doch wer soll dieses Geld wie und an wen verteilen? Das sind die Fragen, um deren Antworten diese Woche bei Konferenzen des „Committee on World Food Security“ in Rom gerungen wird. Der ursprüngliche Plan, dass ein Trust Fonds unter Weltbank-Ägide die 20 Milliarden übernimmt, hat eine Gegenwehr von Entwicklungsländern ausgelöst – und von FIAN, dem FoodFirst Informations- und Aktions-Netzwerk, das sich als internationale Menschenrechtsorganisation dafür einsetzt, damit alle Menschen ohne Hunger leben können. Gertrude Klaffenböck von FIAN Österreich fordert die Etablierung demokratischer Strukturen und die Einbindung von Kleinbauern-Vertretern und anderen Partner aus dem Süden bei der Verteilung der 20 Milliarden Dollar – damit „nicht weiterer Schaden angerichtet wird“.
Und UN-Ernährungs-Anwalt Olivier de Schutter assistiert: Er warnt davor, jetzt den Fokus nur auf die Erhöhung der Lebensmittelproduktion zu legen. Nicht zuletzt die Folgen für die Klimaerwärmung wären fatal. De Schutter fordert stattdessen, Bildung und Investitionen bei den Kleinbauern zu erhöhen, die Einkommen der Ärmsten zu steigern und ein besonderes Augenmerk auf die Verteilung zu legen. Damit nicht anderswo das Gleiche passiert wie derzeit in Guatemala: Dass Menschen verhungern, obwohl es ausreichend Lebensmittel gibt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!