"Der Zauber der Zwecklosigkeit"
Angesichts der wachsenden Funktionalisierung und Ökonomisierung des Lebens plädiert der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther für eine Rettung des Spiels.
Angesichts der wachsenden Funktionalisierung und Ökonomisierung des Lebens plädiert der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther für eine Rettung des Spiels.
Im Buch "Rettet das Spiel!" wirbt der Neurobiologe Gerald Hüther (mit dem Philosophen Christoph Quarch) dafür, dem Ernst des Lebens spielerisch zu begegnen. Im Interview erklärt er, warum.
DIE FURCHE: Sie wollen das "Spiel" retten. Doch was macht aus Ihrer Sicht eigentlich sein Wesen aus?
Gerald Hüther: Das Erste wäre die Zweckfreiheit. Sobald das Spiel für irgend etwas instrumentalisiert wird -etwa zum Geldverdienen - ist es kein Spiel mehr. Das Zweite ist, dass man mit anderen gemeinsam spielt, dass es also zu einer Begegnung kommt, ohne den anderen zu benutzen. Drittens hat jedes Spiel einen Raum, in dem es stattfindet: Dazu gehören Regeln oder richtige Spielräume. Und schließlich besteht der Zauber des Spiels darin, dass sich in ihm etwas zeigt: etwa wie jemand auf eine Situation reagiert oder -so hätten die alten Griechen gesagt -wem die Götter hold sind. Es geht also nicht um etwas Funktionales, sondern um eine Betätigung, in der sich etwas entwickelt.
DIE FURCHE: Wobei Sie meist den engen Zusammenhang zwischen Spielen und Lernen betonen
Hüther: Ja, denn das Spiel ist ja nicht erst erfunden worden mit der Herstellung von Spielzeug oder Gesellschaftsspielen, sondern alle Menschen -und nebenbei gesagt auch alle lernfähigen Tiere - eignen sich das Wissen dieser Welt an, indem sie spielerisch erproben, was geht. Das fängt mit dem spielerischen Erkunden des eigenen Körpers an und erlebt seine finale Stufe, indem Jugendliche ausprobieren, wie weit man bei den Eltern gehen kann und wie belastbar die Beziehung ist.
DIE FURCHE: Nicht nur Sie, auch der US-Psychologe Fred Donaldson ist fasziniert vom "ursprünglichen Spiel" und sieht hier Parallelen zwischen Kindern und Tieren. Was halten Sie von seinem Konzept des "Original Play"?
Hüther: Ich kenne es nicht genau, bin aber immer sehr skeptisch, wenn etwas als Methode verkauft wird. Es wäre ja die Perversion des Spiels per se, wenn ich eine Methode einführe, mit deren Hilfe ich das Spiel zu einem Zweck gestalte. Worum es gehen muss, ist vielmehr die Haltung von Lehrern, Eltern und Kindern.
DIE FURCHE: Bei "Original Play" heißt es, dass das ursprüngliche Spiel der Kinder "kein Gewinnen und Verlieren" kenne. Aber gehört Wettbewerb nicht zum Spiel? Hüther: Nein, man sieht nur an diesem Beispiel, wie sich der Charakter des Spielens im Lauf der Zeit verändert hat. Bei den Olympischen Spielen ging es etwa ursprünglich gar nicht darum, wer den Diskus am weitesten wirft, sondern, bei welchem Mitspieler sich sozusagen "das Göttliche offenbart". Der wurde dann vom Publikum als Sieger gewählt, es gab auch keinen Zweit- und Drittplatzierten. Die Weite war also nur Teil des Gesamtkunstwerks. Doch wir sind mittlerweile in einer Wettbewerbsund Leistungsgesellschaft, in der schon die Kinder darauf vorbereitet werden, sich darin zurechtzufinden. Das wäre nicht so schlimm, wenn die Regeln auch beinhalten, dass man sich nach dem Spiel wieder in die Arme nimmt und mit dem freuen kann, der gewonnen hat. Aber meist geht es darum, besser sein zu wollen als der andere.
DIE FURCHE: Als Teil dieses zeitgenössischen "Spiels" sehen Sie auch die Frühförderung, die den Kindern die Zeit zum freien Spiel raube. Warum ist das so schlimm?
Hüther: Weil sich die Kinder daran gewöhnen, immer funktionieren zu müssen. Sie werden dann zwar brave Pflichterfüller, hatten aber leider nicht genügend Zeit, um im freien Spiel Kreativität und Fantasie zu entwickeln. Das ist schon an sich schlimm. Doch dazu kommt noch, dass in den nächsten Jahren so ziemlich alles, was wir bisher für typisch menschliche Fähigkeiten gehalten haben, von Maschinen übernommen wird. Am Ende bleiben nur zwei Dinge übrig: Das erste ist der Wille -also die Intentionalität; und das zweite die Kreativität, genauer die Ko-Kreativität, also das gemeinsame Überlegen, wie wir das, was wir wollen, auch umsetzen und uns dabei als gestaltende Subjekte erleben können. Beides kann man im Spiel einüben -aber nicht dadurch, dass man bloß Objekt von Belehrungen ist oder durch Förderprogramme geschleust wird.
DIE FURCHE: Kommen wir noch zu einem Aspekt, der viele Eltern punkto "Spielen" am meisten beschäftigt: nämlich die Tendenz, dass Kinder kaum von ihren Handy- oder Tablet-Spielen wegzubekommen sind Hüther: Das ist tatsächlich eine riesige Herausforderung, weil man als Elternpaar nicht flächendeckende Entwicklungen aufhalten kann. Das Problem beginnt dann, wenn man diese digitalen Geräte, die ja im Grunde nur Werkzeuge sind, zur "Affektkontrolle" missbraucht und nicht mehr ausreichend lernt, auf andere Art mit Langeweile, Frust oder einem ungestillten Bedürfnis umzugehen.
DIE FURCHE: Was sollten Eltern tun, deren Kinder digital abgleiten?
Hüther: Mein erster Tipp wäre: Suchen Sie sich von Anfang an andere Eltern, die ähnliche Vorstellungen haben, sodass die Kinder nicht Freunden ausgesetzt sind, deren Eltern es völlig anders machen. Und zweitens: Suchen Sie nach Wegen, dem Kind auf lebenspraktische Weise zu zeigen, wie man seine Gefühle ausleben kann. Man kann ihnen etwas vorlesen, eine Geschichte erzählen, sie an der Hand nehmen und mit ihnen rausgehen oder sie fragen, ob sie statt einem Ballerspiel nicht lieber ein Baumhaus bauen wollen. Aber darauf müssten auch die Eltern Lust haben, sonst geht es nicht...
DIE FURCHE: Außerdem müsste es in der Nähe geeignete Bäume geben, was in Städten selten der Fall ist...
Hüther: Das sind Ausreden! Selbst in den Städten finden sich noch brachliegende Stellen.
DIE FURCHE: Und was ist mit klassischen Spielplätzen?
Hüther: Die bringen nur denen etwas, die sie errichten, erzeugen zudem eine Illusion von Sicherheit und sind auch gar keine richtigen Spielgeräte, weil klar vorgegeben ist, was man darauf machen kann. Ein Stück Urwald, in dem es krumm gewachsene Bäume und dichte Sträucher gibt, wäre viel besser. Man müsste halt einen Bürgermeister wählen, der etwas mehr Wert auf solche Dinge legt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


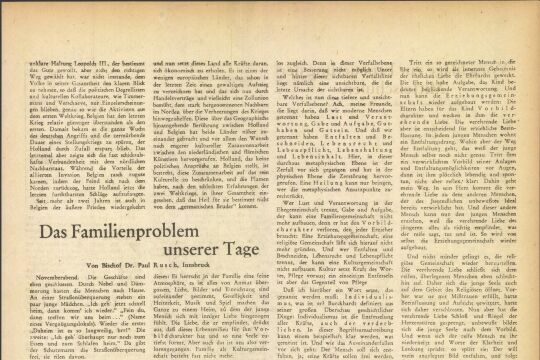
































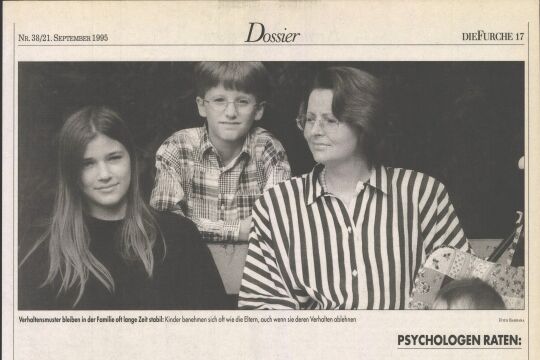













.png)














































