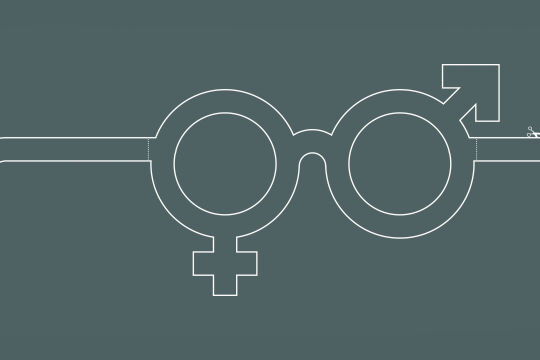Bachmannpreis: Die Lust an der Vielfalt
Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur untermauerten eindrucksvoll die Bedeutung von Literatur. Der Schaukampf-Charakter des Bewerbs inszeniert das Lesen und Bewerten von Texten als weit entfernt von verstaubter Singulärtätigkeit.
Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur untermauerten eindrucksvoll die Bedeutung von Literatur. Der Schaukampf-Charakter des Bewerbs inszeniert das Lesen und Bewerten von Texten als weit entfernt von verstaubter Singulärtätigkeit.
Man kommt nicht umhin festzustellen (wie wahrscheinlich jeder Artikel dieses Jahr über den Bachmannpreis): Dieses Jahr ist alles anders. Das allein ist allerdings schon bemerkenswert und erfreulich, wollte der ORF die „Tage der deutschsprachigen Literatur“ doch kurzerhand völlig ambitionslos einfach absagen. Dabei muss man wirklich kein großer Visionär sein, um zu erkennen, dass ein Format, das auf dem Lesen und Bewerten von Texten beruht, sich leicht medial (wenn auch nicht verlustfrei) anders umsetzen lässt.
Dankenswerterweise hat sich ein Großteil der Jury dagegengestemmt und darauf hingewiesen, dass gerade der Bachmannpreis die Ausgangslage habe, ins Fernsehen verlegt zu werden. Dabei geht natürlich Flair verloren, doch ein Medienwechsel ist auch immer eine Chance: Zum einen erkennt man, was den Reiz denn überhaupt ausgemacht hat, zum anderen können sich mit der veränderten Situation auch neue Stärken ausbilden und Schwächen eventuell korrigiert werden.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Der Bachmannpreis lebt von seinem Format: Das Ambiente und die Kommunikationssituation fördern ein bestimmtes Sprechen über die Literatur. Die Autorinnen und Autoren werden in eine Arena geschickt, in der sie sich zu beweisen haben, die Kritikerinnen und Kritiker nehmen auf einer Richterbank Platz, während das Publikum an vorderster Front mit dabei ist, den Angstschweiß riecht und sich an möglichst bissigen Urteilen erfreut.
Kräftemessen der Juroren
Der Bachmannpreis war noch nie nur ein Wettbewerb der Lesenden, sondern immer schon ein großes Stück weit auch ein Sich-Messen der Jurymitglieder, die sich zunehmend mit pointierten Bemerkungen gegenseitig zu übertreffen suchen. Aber was heißt zunehmend, vermutlich war das schon immer so, immerhin war es Marcel Reich-Ranicki, der den Preis zum ersten Mal mitveranstaltete und der bis heute der bekannteste und wohl beliebteste deutschsprachige Literaturkritiker geblieben ist, nicht wegen seiner differenzierten, sondern wegen seiner klaren, keinen Widerspruch duldenden und laut vorgetragenen Richtsprüche.
Dieser öffentlich gefochtene Schaukampf hat natürlich seinen Reiz, und die um Aufmerksamkeit ringende Literatur kann es gebrauchen, nicht nur als verstaubte Singulärtätigkeit inszeniert zu werden. Genau darin besteht aber auch eine große Chance: Die Struktur des Bachmannpreises gibt nämlich mehr her, als nur als Wettlesen interpretiert zu werden. Literatur trägt viele verschiedene Lesarten in sich, und wie kann man das besser vermitteln als durch das gemeinsame Sprechen über Texte, die alle auch kennen, wo der eigene Rezeptionsprozess und die eigene Rezeptionserfahrung unmittelbar mit mehreren anderen abgeglichen werden können?
Der Bachmannpreis war noch nie nur ein Wettbewerb der Lesenden, sondern immer schon auch ein Sich-Messen der Jurymitglieder.
Das größte Aha-Erlebnis hat man ja nicht, wenn ein Juror die eigene Meinung vertritt, sondern wenn man sieht, welche anderen Perspektiven ein Text eröffnet, mit welchen unterschiedlichen Instrumenten und Sensoren man sich einem Text nähern kann und welche Lust in dieser Vielfalt liegt. Die Juroren könnten Literaturvermittler sein, wo sie häufig als Richter auftreten. Ob sich das durch die totale physische Vereinzelung von Autoren und Juroren verbessert?
Die technische und dramaturgische Umsetzung ist gut geglückt. Es zeigt sich aber schnell: Das Format ist weniger entscheidend als Charakter und Literaturverständnis der Jurymitglieder. Das schlägt sich an Lesungstag 1 zum ersten Mal so richtig bei der Lesung von Carolina Schutti nieder. In der Diskussion ging es schnell weniger um den Text, sondern um die Art der Kritik, das veränderte Format und den Umgang mit unterschiedlichen Literaturverständnissen.
Das geht gerade bei den Neo-Juroren Brigitte Schwens-Harrant und Philipp Tingler hörbar auseinander. Tingler kann mit dem Text gar nichts anfangen und gerät in Rage, weil seine Mitjuroren nicht seiner Meinung sind: „Wollt ihr nicht merken, dass das ein total konventionelles Textmodell ist!“ Dem setzen vor allem Schwens-Harrant und Insa Wilke formale und interpretatorische Analysen entgegen.
Neubesetzung bringt Dynamik
Das diesjährige Format und die Distanz, die es erzwingt, führen bei manchen Juroren zu einer erfreulichen Konzentration auf den Text. Insgesamt aber verändert die digitale Version nur das Kommunikationsverhalten der Jurymitglieder untereinander, nicht aber das Wertungsverhalten, das sich, wie jedes Jahr, zwischen den Polen der sachlichen Offenlegung von Wertungskriterien auf der einen und der knallharten Selbstprofilierungswut auf der anderen Seite bewegt, weniger in einer Pendelbewegung als einem wilden Hin-und-her-Hüpfen. Am meisten Bewegung ins Wertungsverhalten hat daher nicht die Virtualisierung gebracht, sondern tatsächlich die Neubesetzung der frei gewordenen Jurorensitze.
Mehr als alle anderen ging Brigitte Schwens-Harrant analytisch in den Text, legte verschiedene Ebenen frei und erklärte Textstrategien. Tingler warf zwar immer wieder interessante theoretische Fragen auf, gefiel sich aber hauptsächlich in der polternden Rolle des Kritikers der Kritik. Den allgemeinsten Blick warf Insa Wilke auf die Texte, Klaus Kastberger hingegen verstand sich als Antipode zu Tingler, Gomringer und Wiederstein blieben dieses Jahr etwas farblos.
Die Vermutung, dass sich die physische Distanz von Jury und Eingeladenen auf die Beißhemmung auswirkt, hat sich so nicht bestätigt. Tingler, der ob seines Kommunikationsstils medial viel Kritik einstecken musste, zeigt zwar fachlich Schwächen, die von ihm aufgeworfenen Grundsatzfragen brachten aber das Beste der Literaturkritik hervor, nämlich nicht nur willkürlich die eigenen Beobachtungen markig zu präsentieren, sondern Textdetails mit Reflexion auf Metaebene zu verbinden. So hat sich die diesjährige Jury als Literaturvermittlerin und nicht als literarische Richtbank verdient gemacht.
Die „einfühlende Leserin“
Die Preisvergabe war die spannendste seit Jahren, folgte aber den gleichen Gesetzen: Helga Schuberts Text ist wunderbar, durchgesetzt hat sich dennoch ein Text, der niemandem wehtut, und eine Kandidatin, der niemand den Sieg missgönnt. Dafür hätte die Kandidatin mit dem literarisch stärksten Text beinahe das Präauer’sche Schicksal der höchstgepriesenen Preislosigkeit ereilt. Am Ende gewann Brigitte Schwens-Harrants Kandidatin Laura Freudenthaler den 3satPreis, was zwar erfreulich ist, dem Text aber nicht gerecht wird.
Dass bei der virtuellen Preisüberreichung Petra Gruber von 3Sat Klaus Kastberger nannte, der Freudenthaler freilich in die Nähe von Ingeborg Bachmann gerückt und ihr eine große Karriere vorausgesagt hatte, aber eben nicht der einladende Juror war, während sie Schwens-Harrant unerwähnt ließ, ist wohl ebenso einem unbewussten Geschlechtergefälle zuzuschreiben wie mediale Bewertungen der Jurorinnen und Juroren, die männlichen Juroren eine analytische, weiblichen aber eine einfühlsame Lesart zuschreiben. Etwas schade war auch, dass Sharon Dodua Otoos wichtige Rede keinerlei Erwähnung mehr fand, während im Vergleich Clemens Setz’ letztjährige Rede während des ganzen Bewerbs omnipräsent war.
Die Autorin ist Senior Scientist am Innsbrucker Zeitungsarchiv, Institut für Germanistik, Universität Innsbruck.




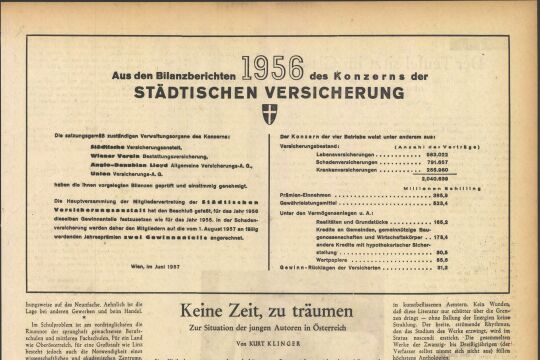



































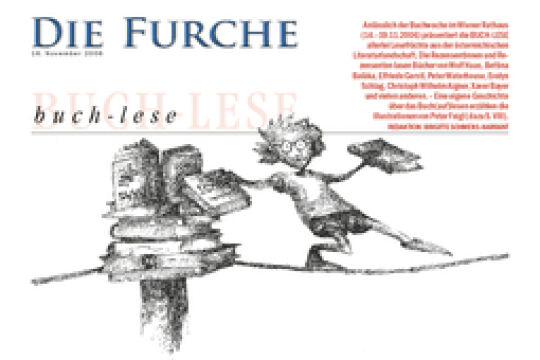



















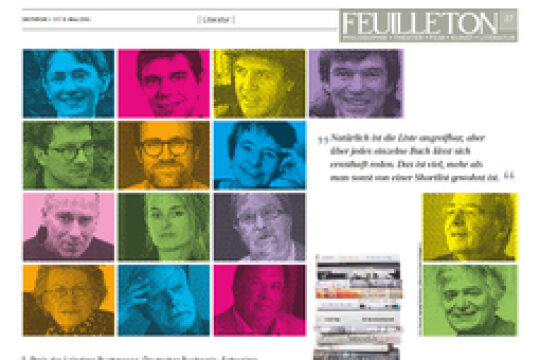
























.png)