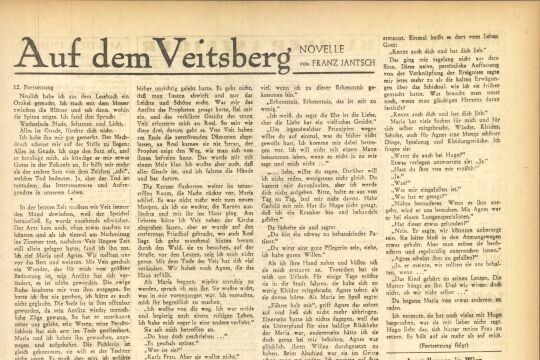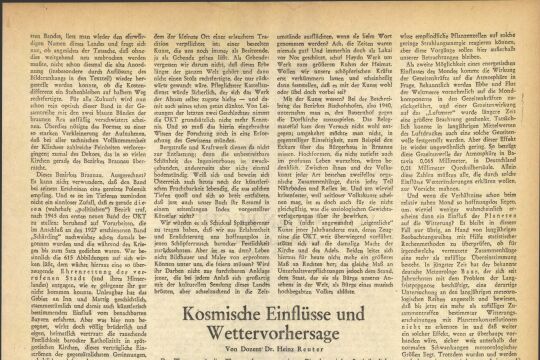Bachmann-Wettbewerb 2024
DISKURS
Karin Peschka: Der Bachmannpreis aus Sicht einer Autorin
Anfang Juli las sie bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Eine Rückblende der schriftstellerin Karin Peschka.
Anfang Juli las sie bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Eine Rückblende der schriftstellerin Karin Peschka.
Vier Wochen schönster Sommer polstern den Abstand zwischen den 41. Tagen der deutschsprachigen Literatur und dem Jetzt. Ich bin nach Eferding gefahren, um in meinem Elternhaus ein Zimmer auszuräumen, das wir über viele Jahre als Abstellkammer benutzt haben, und um diesen Text zu schreiben. Seit Freitag laufe ich mit Kopfhörern herum, höre mir der Reihe nach Lesungen und Jurydiskussionen an, halte nur inne, um die Videoporträts genau zu betrachten. Packe Notizblock, Bleistift und Smartphone wieder in die kleine Tasche, die ich mir umhänge, um die Hände frei zu haben.

Liebe Leserin, lieber Leser
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Schachteln schleppen, Bücher schlichten, Regale verschieben. Treppen rauf, Treppen runter. Wäre es nicht tatsächlich so, müsste man dieses Setting erfinden: Ich lausche den Stimmen, die einen Text vortragen, den anderen, die ihn bewerten, während ich sortiere und trenne, Platz schaffe in unserem alten Kinderzimmer, wo ich als Volksschülerin meine ersten Bücher gelesen habe.
Die Lesereihenfolge des diesjährigen Bewerbes drehe ich kurzerhand um und beginne mit Urs Mannhart. Als zwei Tage später die Mülltonne voll ist, bleiben übrig: ein leeres Zimmer und, da ich das Los gezogen hatte, den Reigen zu beginnen, meine eigene Lesung sowie die entsprechende Diskussion der Jury. Nervös geworden vor der Konfrontation mit mir selbst, zögere ich, gehe zum Fenster und schaue in den Abend, bevor ich mich den letzten Videos zuwende.
Was weiß ich noch von dieser knappen Stunde im Fernsehstudio? Vom Lesen, dass es schön war. Von der Jury? Religionsbegründung, der Silberlöffel als Tipp zur Abwehr wilder Hunde, ein einfacher Text, der mit einfachen Sätzen eine einfache Geschichte erzählt, ein Achtel zu viel, dann wieder zu wenig. Ich erinnere mich an die Ruhe davor, an das seltsam zornige Aufplustern danach, dem Abfallen der Anspannung geschuldet. Taha, mein Freund, lotste mich weg vom Funkhaus.
Während dort Björn Treber las, habe ich – wie sagt man? – habe ich mir Luft verschafft, schwitzend unter dem Fernseh-Make-up, habe, auf einem Felsbrocken sitzend, mit Ludwig telefoniert, dem Lektor meines neuen Buches. Bin dabei einem Marienkäfer in die Flugbahn geraten, er taumelte gegen meinen Arm und verschwand im nächsten Strauch. Ich lachte. Es war vorbei. Ich hatte beim Bachmannpreis gelesen, hatte meine Sache gut gemacht, wie Ludwig, wie Taha, wie alle mir versicherten, wie ich es spürte, ganz unabhängig von dem, was gesagt oder nicht gesagt worden war.
Ablenkung und Ambivalenz
Diese dumme Anfälligkeit, Negatives zu behalten, dafür jede lobende Erwähnung abprallen zu lassen wie den hübschen kleinen Käfer. Generell ein Problem damit zu haben, konzentriert zuzuhören. Das war mir auch in Klagenfurt nicht möglich, die Ablenkung viel zu groß. Zudem lag in der Situation eine Ambivalenz, die ich von anderen Bewerben kannte. Man ist einander gewogen und doch in Konkurrenz. Läuft Gefahr, sich ungewollt über das Scheitern der Kolleginnen und Kollegen ein wenig zu freuen. Oder – an der Schönheit der fremden Texte gemessen – das eigene Versagen vorauszuahnen.
Ein wesentliches Merkmal der Tage der deutschsprachigen Literatur, wie der Bachmannpreis offiziell heißt und, wie ich finde, er genannt werden sollte, um auch dem Andenken Ingeborg Bachmanns ein wenig Luft zu verschaffen, ist die Beschwichtigung. Untrennbar gehört sie zu jedem Gespräch. Besonders im Vorfeld: Vergiss nicht, wichtig ist das Dabeisein. Es ist eine Show, ein Spiel, eine Chance. Die Teilnahme der Gewinn, nominiert zu sein eine Ehre. Hier widersprach ich, das Wort "Ehre" ist mir zu heikel, zu heroisch aufgeladen. Zumindest macht sich Klagenfurt gut im Lebenslauf, scherzte ich. Stimmt, war die durchaus ernstgemeinte Antwort.
Einige Wochen vor dem Bewerb überkam mich heftige Angst. Wieder und wieder las ich den Text, das erste Kapitel vom "Wiener Kindl". Jede Bewegung, jede Geste, die ich darin beschreibe, ist mir ein klares Bild. Jeder Satz von einer für mich zwingenden Logik, weil es zum Geheimnis des Schreibens gehört, dass es einen bezwingen kann.
Ich schlief zu wenig. Der Zweifel, eine weitere Untrennbarkeit. Malte mir Szenarien aus, in denen das "Wiener Kindl" von der Jury herablassend besprochen wurde, zur Freude jener, die Schlechtes hören wollen. Auch beim Boxen ist ein K. o. befriedigender als ein über die Runden gehender Kampf, für beide, für Publikum und Regie. Bald reichte es mir. Als ich beschloss, keine Angst mehr haben zu wollen, ließ sie sich abdrehen wie ein tropfender Wasserhahn.
Nach unserer Ankunft in Klagenfurt am 5. Juli machten wir uns auf den Weg zum Funkhaus, wo uns der Portier in den Garten schickte – sofort wurde ich in das Geschehen hineingezogen, willkommen geheißen, betreut, informiert, geleitet. Wir saßen im Studio alphabetisch gereiht, ich zwischen Ferdinand Schmalz und der Jetlag-müden Maxi Obexer. Von der Eröffnungsrede des Jury-Sprechers lenkte mich eine dicke Fliege ab, ein im überweißen Raum deutlich sichtbarer, herumschwirrender schwarzer Fleck.
Am Ende dieses ersten Abends besaß ich "Das Floß der Medusa" mit einer Widmung Franzobels und das Los, am nächsten Tag um zehn Uhr lesen zu müssen. Zu dürfen, korrigierte man mich. Dann hast du's hinter dir, sagte jemand. Ich bin kein Morgenmensch, sagte ich. Ein Gewitter zog über die Stadt, spät gingen wir schlafen.
Der Zauber war verflogen
Früh standen wir am nächsten Tag auf. Eine halbe Stunde vor dem Auftritt wurde man im Funkhaus erwartet, dort fast liebevoll umsorgt, ohne Hektik, sehr angenehm. Geschminkt, frisiert und bereit nahm ich den Platz in der Mitte des Studios ein, atmete tief, setzte meine Lesebrille auf und las. Wir lasen. Ein Blätterrauschen nach jeder Seite, wir blätterten synchron. Das hatte, und ja, jetzt schreibe ich es doch, das hatte einen Hauch Magie.
Als die Jury begann, meinen Text zu besprechen, war mit dem von Hubert Winkels eingebrachten Stichwort der "Religionsbegründung" der Zauber verflogen. Aber, dachte ich, wenn es ein Dogma gibt, dann jenes der Freiheit der Interpretation. Was werden sie sich noch herausnehmen, was hineinlegen? Zwischen mir und der Jury wurden Kameras herumgeschoben. Die da vorn und wir, Publikum, Autorin, hinten.
Durch die Videoperspektive fällt mir dieser Umstand jetzt noch stärker auf als damals. Die Trennung ist doch eindeutig, die ist regiegewollt, oder? Zitat aus den Statuten 2017, Punkt 8, mit allen Unterlagen für die Teilnahme zugesendet am 28. März: "Jede/r AutorIn liest bis zu maximal 25 Minuten. Auf jede Lesung folgt eine Diskussion der Jury. In diese Diskussion kann der/die betreffende AutorIn eingreifen und zur Kritik der Jury Stellung nehmen. Dem/der AutorIn steht auch das Schlusswort zu."
Dazu wäre eine Aufforderung hilfreich gewesen, ein Blick des Moderators, ich hätte ein Schlusswort gewusst, war darauf gefasst. Aber, Applaus, vorbei. Die Jury wandte sich ab und dem Nächsten zu. Der Begriff überrumpelt fällt mir ein. Ich schlage Rumpeln nach im etymologischen Wörterbuch, iterative lautmalende Bildungen, und das lasse ich jetzt so stehen.
Einordnen, aussortieren, wegräumen
So oder so: Peschka wurde wohlwollend besprochen, hieß es später, auch wenn es sich nicht so anfühlte. Nachdem ich mir die Diskussion nun ein zweites Mal, oder eigentlich zum ersten Mal wirklich angehört habe, kann ich vieles vom Gesagten einordnen, aussortieren, wegräumen. Es geht nicht darum, verstanden worden zu sein oder geliebt zu werden. Es geht darum: Das ist der Text, so wurde er geschrieben, seine Einfachheit ist dem einen Kunst, dem anderen ein Makel. Was ich mit dieser Erkenntnis mache, oder diese Erkenntnis aus mir, wird sich weisen.
Letztlich war für mich nach meiner Lesung alles gut gegangen. Den Rest des Bewerbs nutzte ich dazu, Familie und Freundeskreis darauf vorzubereiten, dass ich nichts gewinnen würde, davon war ich überzeugt, ohne damit zu hadern. Und hielt am Ende den Publikumspreis in den Händen, sehr zu meinem Erstaunen und meinem Glück. Diese Auszeichnung nehme ich gerne und dankbar an.
Letztlich waren die Tage der deutschsprachigen Literatur eine Zeit intensiver Konfrontation. Von der Einreichung über Einladung, Vorbereitung und Teilnahme, von der hautnahen Begegnung mit Lesenden, Kritisierenden, Schreibenden bis zur Reflexion in den Wochen danach. So gesehen, stimmt es doch: Die Teilnahme hat viel gebracht.
Nachtrag: Die Häme fand woanders statt, ein wenig Häme findet immer statt, oft nicht mehr als eine Bonmot-Schlacht auf 140 Zeichen. Wirklich geärgert habe ich mich nur über das Literaturcafe-Moderationsduo, das sich ausführlich über die Bezeichnung "Kindl" mokierte. Sinngemäß: Die Autorin sollte wissen, dass Amazon den Begriff Kindle für seinen E-Book-Reader verwendet. Das sei irritierend. Gegenfrage: Darf man sich ein Wort wegnehmen lassen? Von einem Konzern? Ich denke doch: Nein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!