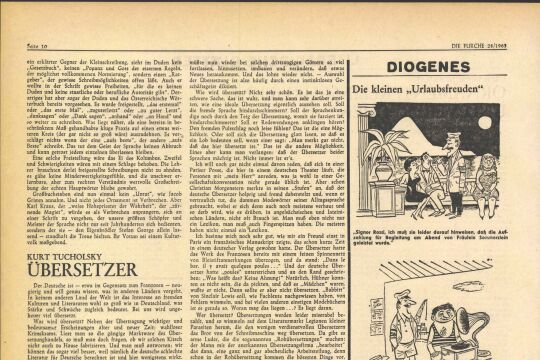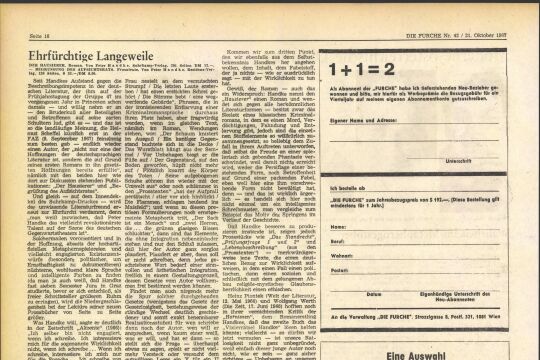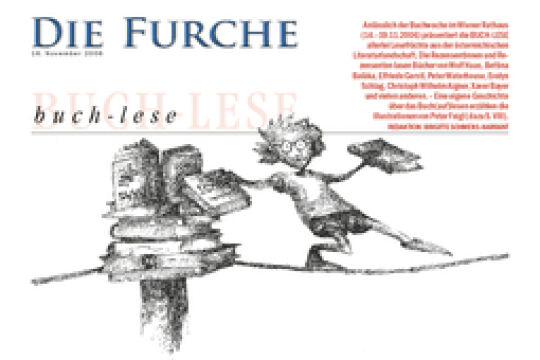Die "31. Tage der deutschsprachigen Literatur" in Klagenfurt.
Am Wörthersee liegt Klagenfurt. Wie passend. Ein Zauberberg ist Klagenfurt, alljährlich im Juni. Vier Tage lang trifft sich hier der Literaturbetrieb. Ein Familientreffen, ein Kasperltheater, ein Drama in fünf Akten (mit emotionellen Höhepunkten, Entgleisungen und einigen Tränen am Ende), eine Parallelwelt oder ein "Gesamtkunstwerk" (Hanns-Josef Ortheil in seiner Eröffnungsrede): die Tage der deutschsprachigen Literatur haben von all dem etwas.
Man hat sich gern oder auch nicht: man kennt sich, küsst Wangen, klopft Schultern, isst und trinkt und radelt an den See. Wer will, kann schon beim Frühstückskaffee über Literatur parlieren. Und nachts noch beim Wein. Auch jener Autor, den man hie und da an die Wand gelehnt sieht, schmal und grau und ohne Begleitung des Verlages, den er nicht hat, gehört dazu - in diesen Tagen, die besondere sind. Auf wirbelsäulenunfreundlichen Biertischbänken dicht gedrängt das Publikum: Schüler neben Pensionisten neben Verlagsmenschen neben Journalisten neben Autoren. Zweieinhalb Tage lang nichts als zuhören: eine halbe Stunde Lesung, eine halbe Stunde Diskussion, eine halbe Stunde Lesung, eine halbe Stunde Diskussion, eine halbe Stunde Lesung, eine halbe Stunde Diskussion …
Wie groß ein Palmdieb ist
Nein, das wird nicht fad. Denn hier lässt sich vieles lernen, weit über die Literatur hinaus. Wer aufmerksam zugehört hat, weiß jetzt, was ein Geigerzähler ist - und dass man besser nur erklärt, was man wirklich weiß. Wie groß ein Palmdieb ist. Dass es für einen Misanthropen keinen besseren Ort als eine Raumkapsel gibt. Dass nichts so wichtig ist wie Muntermachersätze zur richtigen Zeit - und dass man den eigenen Text nicht zerlesen sollte.
Wer den Autor in sich erwachen spürt, dem seien diese Tage wärmstens empfohlen. In dieser öffentlichen Werkstatt wird seziert, was das Zeug hält - oder eben nicht hält. Wer hier war, wird sich in Zukunft um jeden veröffentlichten Satz sorgen sollen. Der scharfe Blick der Kritiker bleibt bei falschen Konjunktiven hängen und spießt schlechte Bilder auf. Die Schuld für schlechte Sprache den Figuren in die Schuhe schieben, gilt nicht. Und als Autor zu behaupten, von Erzählperspektive keine Ahnung zu haben, ist ein arger Fauxpas.
Auch lesen sich die Tage hier wie ein unterhaltsamer und kostenloser Kurzkurs in Germanistik. Viel erfährt man über alten und neuen Realismus, psychologische Erzählungen und ihre Stimmigkeit, klassische Novellen und deren Falken, über die Dramaturgie apokalyptischer Rede und dass die Apokalypse auch fröhlich sein kann. Man hört von der Schwierigkeit auch der Experten mit der Frage: Sound oder Stoff - worauf kommt es an? Immer wieder das Ausloten der Frage nach der Angemessenheit zwischen Sprache und Sujet. Ein berührendes Thema allein macht noch keine lesenswerte Prosa. Wie also formt sich ein noch so interessanter Stoff zu anspruchsvoller Literatur?
Über Form und Stilistik lässt sich vieles sagen: Dass Personenkonstellationen plausibel und konsequent sein müssen. Dass es nicht genügt, wenn eine Geschichte auf eine Pointe zufährt, darin restlos aufgeht - und das dann alles war. Dass ein Text ohne Metaphorik langweilig, dass aber Metaphernsalat keineswegs schmackhaft ist. Dass Brüche stören, aber auch fehlen können. Und hinein in all das Wissenswerte fallen Sätze, die jedes Schülerherz höher schlagen lassen müssten: "Ihre Erläuterungen machen mir den Text fast schon wieder unsympathisch." (Ijoma A. Mangold zu Martin Ebel)
Die Messer der Kritik schneiden und schneiden. Da wird ein großes Thema kleingekocht, sind Texte mutlos und flau, fehlen originelle Gedanken und Formulierungen. Da scheint das Vokabular der Eheberatung entlehnt oder dem gymnasialen Schulaufsatz. Da ist ein Text vollkommen misslungen, hat kein Tempo, "nichts, wo er mich interessieren würde" oder klingt gar wie eine frei erfundene Gute-Nacht-Geschichte mit der Stimme aus der "Sendung mit der Maus". Da bringt jede Seite mehr nichts mehr: es ist einfach nur länger. Da entspricht die Gefühlsimpotenz der Figur der stilistischen Impotenz des Autors, oder in einem Text stört die Sexualisierung, weil sie das einzige ist, was den Kritiker an diesem Text interessiert. Spätestens hier stutzt die Zuhörerin: Ist das nun eine Aussage über den Text - oder nicht vielmehr über den Kritiker? Diese Frage stellt sich öfter.
Seite mehr ist nicht mehr
So unterschiedlich die Erwartungen der einzelnen Juroren an Literatur sind, so unterschiedlich fällt auch die Einschätzung aus. Während der eine überrascht ist, wie gut ihm ein Text gefallen hat, jedoch nicht sagen kann, wie dieser Text überhaupt funktioniert, hat der andere "selten eine verquastere Philosophie des Schweigens gehört". Während die eine einen Text als Jungmädchenliteratur entlarvt und dabei an "sprachlicher Erstickungsnot" leidet und sich eine andere darüber wundert, dass ein lyrisches Talent an so etwas Freude haben kann, "denn eigentlich langweilt mich dieser Text", ist der andere von der Erzählperspektive desselben Textes hellauf begeistert.
Selten sind die Juroren einer Meinung. Umso überraschender das einhellige Lob für den Text von Lutz Seiler, der dann auch folgerichtig mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wird. Stilistisches Niveau, wie es wenige Texte in diesem Bewerb erreichen, gesteht der strenge Karl Corino der Prosa Turksib zu. Corinos Gegenspielerin Iris Radisch lobt den weiten Bedeutungshof. Der Text begeistert superlativisch, vor allem André Vladimir Heiz: dieser Text produziere durch das Erzählen Sinn. Der Sprung aus der städtischen Gegenwartsliteratur, der für die Lektüre dieses Textes notwendig ist, lohnt sich, hält Daniela Strigl fest und nennt den Text ein "gefundenes Fressen für die Kritiker". Ein Text, der die "hermeneutische Geilheit" (Klaus Nüchtern) der Kritiker befriedigt? Ein Text jedenfalls, der sprachlich überzeugt und nach der ersten Lektüre keineswegs ausgelesen ist.
Kritiker finden ihr Fressen
Was aber lernt man in Klagenfurt noch? Dass Juroren ihre Grenzen haben. Nun, das wusste man, hier aber erlebt man es live. Auch die Form der Selbstrelativierung, die Iris Radisch ausspricht, erscheint zur Genüge bekannt, wenngleich fragwürdig: "Ob es nun stimmt oder nicht, wir müssen uns hier für kompetent erklären." Wenn Ratlosigkeit sich breit macht, etwa nach dem atemlosen, multimedialen und ziemlich zeitgeistigen Auftritt von Jörg Albrecht, ist es ein leichtes, die Ratlosigkeit auf den Text oder seinen Vortrag zu schieben. Die Geschwindigkeit, in der gelesen wurde, zeige, der Text wolle gar nicht verstanden werden, meint Mangold, und Corino: "Der Text zielt auf die Niederschlagung der Jury." Man kann sich auch mit Schmäh aus der Affäre ziehen: Der Text habe ihn wachgequatscht, feixt Klaus Nüchtern, also gehe das in Ordnung. Alles in allem scheint wenig Mühe aufgeboten, sich dem Text zu nähern.
Noch fassungsloser freilich sitzt das erwartungsvolle Publikum, als am Freitagabend plötzlich die Diskussion abbricht, nein: ausbleibt. Nach dem medienwirksamen Auftritt von PeterLicht, der sein Gesicht nicht vom Fernsehen übertragen lässt und beim Vorlesen das Publikum auf seiner Seite hat, und nach den euphorischen Stellungnahmen einiger ihrer Kollegen bleiben drei Kritiker (Karl Corino, Ilma Rakusa, Ursula März) wohl aufgrund der Stimmung im Publikum still. Erst am nächsten Tag äußert Corino seinen Unmut über den "Affenzirkus". Mit einer Orgie der Akklamation sei da eine Banalisierung des Todes begrüßt worden, argumentiert Corino moralisierend. Das Publikum reagiert, indem es PeterLicht den Publikumspreis zuspricht.
Was lernt man noch? Dass sich die deutschsprachige Literatur erfreulich vielfältig darstellt. Die in diesem Jahr gelesenen Texte dokumentieren allerdings nicht nur eine große Bandbreite an Machart und Thematik, sondern auch höchst unterschiedliche literarische Qualität. Warum freilich manche Texte mit dem Samthandschuh kritisiert werden und andere mit dem Messer, das bleibt ein Geheimnis.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!