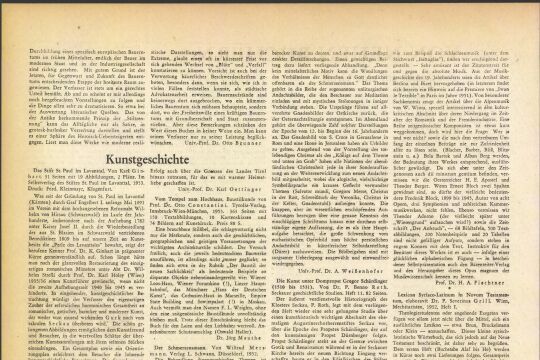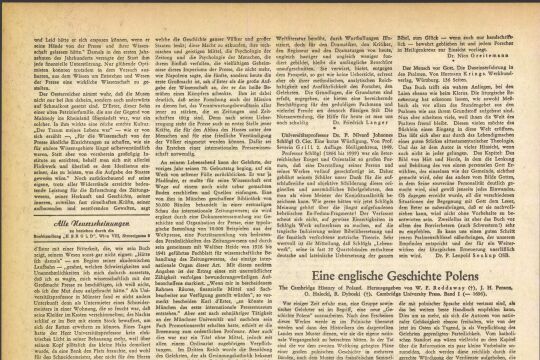Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das gefährliche Gewerbe des Kritisierens
Die Empfindlichkeit und das Mißtrauen, das die deutsche literarische Kritik begleiten, ja das geradezu neurasthenische Verhalten der Betroffenen und der Öffentlichkeit gegenüber der Kritik ist vor allem auf die mangelnde literarische Tradition, die Anerkennung der Literatur als einer „Wirklichkeit“ im Leben der Nation zurückzuführen, wie sie wiederholt Hofmannsthal beklagt hat, indem er immer wieder auf das Beispiel Frankreichs verwies. Über diese deutsche Malaise waren sich kritische Geister wie Goethe und Adam Müller, Nietzsche und Fontane, E. R. Cur-tius, Tucholsky, Musil und Sieburg einig, der einmal schrieb: „Was die Rolle der Literaturkritik betrifft, so sind in unserem Bereich kaum noch Illusionen erlaubt.“
Die Empfindlichkeit und das Mißtrauen, das die deutsche literarische Kritik begleiten, ja das geradezu neurasthenische Verhalten der Betroffenen und der Öffentlichkeit gegenüber der Kritik ist vor allem auf die mangelnde literarische Tradition, die Anerkennung der Literatur als einer „Wirklichkeit“ im Leben der Nation zurückzuführen, wie sie wiederholt Hofmannsthal beklagt hat, indem er immer wieder auf das Beispiel Frankreichs verwies. Über diese deutsche Malaise waren sich kritische Geister wie Goethe und Adam Müller, Nietzsche und Fontane, E. R. Cur-tius, Tucholsky, Musil und Sieburg einig, der einmal schrieb: „Was die Rolle der Literaturkritik betrifft, so sind in unserem Bereich kaum noch Illusionen erlaubt.“
Die deutsche Literaturkritik hat Klassiker von Weltformat (Lessing, Schiller, Heine, Schlegel, Curtius und andere). Aber heute beherrschen das Feld Amateure, Schriftsteller im Nebenberuf, Literaten, die auf Querverbindungen angewiesen sind — und Sonntagsjäger. Auf anderen Gebieten der Kunstkritik, etwa dem der Musik, des Theaters, des Balletts, der bildenden Kunst, wo fast ausschließlich Fachleute tätig sind und wo jedes Fehlurteü zumindest einen empfindlichen Prestigeverlust in der Öffentlichkeit bedeutet, ja die materielle Existenz des Schreibers gefährden würde, gibt es diesen unverbindlichen Dilettantismus kaum. Der Schaden, welcher der Literatur (und dem Leser) zugefügt wird, kommt also nicht von den „strengen“ Kritikern (das literarische Gewerbe war und ist immer gefährlich), und nicht durch jene Eigenschaften, die man dem Kritiker zum Vorwurf macht, wie einseitiges Engagement, ästhetischer Dogmatismus, Schulmeistere! und Besserwisserei. Denn jede echte Kritik ist auch Polemik. Was aber vom Kritiker vor allem verlangt werden kann, ist die Fundiertheit seines Urteils, Deutlichkeit und Klarheit der Aussage. Im Positiven wie im Negativen soll er womöglich auch das Exemplarische des Falles klarmachen. Dabei ist es selbstverständlich, daß er auch berühmten und anerkannten Autoren nichts durchgehen läßt. Marcel Reich-Ranidct, Jahrgang 1920, seit 1929 in Berlin lebend, 1938 nach Polen deportiert, von 1940—43 im Warschauer Ghetto lebend, war nach Kriegsende zunächst in Warschau literarisch tätig und übersiedelte 1954 in die Bundesrepublik. Er hat mehrere Bücher und Anthologien veröffentlicht, war Gastprofessor in den USA und ist seit 1960 ständiger Literaturkritiker der Wochenzeitung „Die Zeit“. Hier sind die meisten der im vorliegenden Band gesammelten „Verrisse“ erschienen, 19 an der Zahl, 18 aus seiner Feder, der letzte gilt ihm selbst und stammt von Peter Handke, der Reich-Ranicki als den unwichtigsten, am wenigsten anregenden, dabei als den am meisten selbstgerechten deutschen Literaturkritiker seit langem bezeichnet. Aber das ist des 27jährigen Herrn Handkes Meinung... Jedenfalls zeugt es von Humor, daß Reich-Ranicki auch diesen Verriss in seine Sammlung aufgenommen hat. Bereits die Überschriften der einzelnen Essays — denn um solche handelt es sich — weisen die Richtung der Kritik. Der Roman „Efraim“ von Alfred Andersen wird unter dem Titel „Sentimentalität und Gewissensbisse“, Horst Bieneks „Die Zelle“ unter „Selbsterlebtes aus zweiter Hand“, verrissen. Günther Bichs letzte Prosastücke werden mit „Vorsichhinblödeln“ gekennzeichnet, Anna Seghers „Das Vertrauen“ dokumentiert den „Bankrott einer Erzählerin“, „Trotzki im Exil“ von Peter Weiss ist nicht mehr als „Die zerredete Revolution“, und in Dieter Wellershoffs „Die Schattengrenze“ herrscht „feierliche Undeutlichkedt.“ Handke meint — und wirft es Reich-Ranicki vor — daß er Natürlichkeit, Durchsichtigkeit und Klarheit verlange und damit der Zustimmung des so verächtlichen „Durchschnittslesers“ sicher sei. Dieser Kritiker rede nur in Kernsätzen, die am Kern des jeweiligen Gegenstandes vorbeigehen. — Das nun kann der endes-unterzeichnete Rezensent nicht finden. Reich-Ranicki sagt, im Gegenteil, vieles, was sonst niemand zu sagen sich traut, und wer klar und verständlich zu formulieren versteht, ist noch lange kein amusischer Spießer. Was sagte doch Sartre einmal von seinen Epigonen? „Unklar denken und nicht schreiben können ist noch kein Existentialismus!“ Es gibt deutsche Autoren, die, noch bevor sie 50 sind, von ihrem Mythos leben. Sie flüchten ins Unkontrollierbare und entziehen sich so jeder Verantwortung. „Nicht etwa, daß Eich zu jenen Dichtern gehört (vielleicht aber doch), die ihre Gewässer trüben, damit sie tief erscheinen — das besorgen die Interpreten —, aber der Verdacht läßt sich nicht von der Hand weisen, daß hier eine vollkommene Leere getarnt und garniert werden soll.“ Eine andere Beobachtung macht Reich-Ranickri bei der Lektüre von Peter Härtlings „Familienfest“: An der fortwährend überhöhten, der umständlich-feierlichen, der feierlich-poetischen Sprache geht diese Prosa zugrunde. Auch mit dem innig-schlichten Adel der Seele, der sich in Rolf Hagelstanges „Altherrensommer“ manifestiert, hat R.-R. keine Sympathie. Die Zitate sind umwerfend. (Denn Reich-Rand ckd belegt fast jedes seiner Werturteile, vor allem jedes negative, mit Beispielen.)
Eine andere Modetorheit, die er anprangert, sind die plötzlichen Zeitsprünge, die überraschenden Rückblenden und Antizipationen, allerlei Montagen und Veschachtelungen, die keineswegs künstlerisch notwendig sind und die „heute nur noch von der einfältigsten Landbevölkerung für ein hochmodernes Ausdrucksmittel gehalten werden“, wie in Herbuxgers „Die Messe“ oder in Dieter Wellershoffs „Die Schattengrenze“. Ein weiteres Charakteristikum neuer deutscher Literatur ist der Rückzug ins Infantile und Pubertäre (Hier steht Reinhard Lettau nur als einer für viele). Am schlechtesten kommt die arme Anna Seghers mit „Das Vertrauen“ weg, ein Buch, das R.-R. nicht nur langweilig und geschmacklos, sondern auch verlogen und obszön nennt: in der Liebe der alternden Frau zu dem bösen Stalin. —
Ebenso widerwärtig ist ihm, daß in Düsseldorf zur Eröffnung des neuen Schauspielhauses, das die reichste Stadt der redchen Bundesrepublik 40 Millionen Mark gekostet hat, ein Stück gespielt wird, das die Weltrevolution rühmt und die Hinrichtung eben jener Gesellschaft fordert, die im Parkett sitzt (Aber das gab es schon einmal bei der Premiere der „Dreigroschenoper“ vor 40 Jahren!). Im Ganzen ist dieses neue Stück von Peter Weiss mit dem Titel „Trotzki im Exil“ eine rasche und billige Montage, flüchtig und unseriös. Für den Normalverbraucher ein dramatisierter Leitartikel; der Fachmann, der den Marxismus, seine führenden Köpfe und seine Literatur kennt, ist entsetzt über die Oberflächlichkeit des Autors Peter Weiss und dessen ärgerliche Fahrlässigkeit. Auch damit, daß man aus dem einst mächtigen und gefürchteten Stalin einen lächerlichen Popanz und Kretin macht, ist R.-R. nicht einverstanden. Das füge, so meint er, nicht dem Kommunismus, wohl aber dem politischen Theater in der Bundesrepublik Schaden zu.
Man sieht, auch politisch ist R.-R unabhängig, ein Einzelgänger, von dem, wie über Erasmus, gesagt werden konnte: „Est homo pro se.“
LAUTER VERRISSE. Mit einem einleitenden Essay. Von Marcel Reich-Ranicki. Piper-Verlag. 188 Seiten. DM 7.—.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!