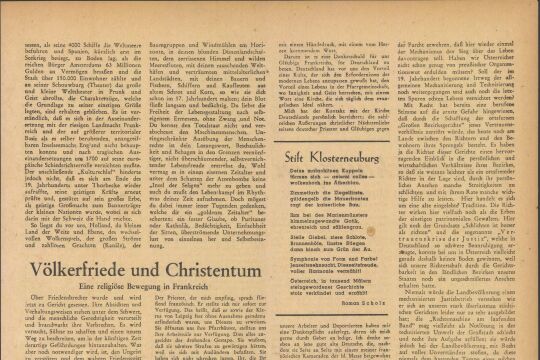Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Volksverbundene“ Justiz
Der Ruf nach einer „volksverbundenen“ Justiz ist zum Schlagwort aller jener geworden, die sich von Berufs wegen zum Thema der Rechtspflege zu äußern pflegen. Gemeint wird damit offenbar, daß die Entscheidungen der Gerichte, in erster Linie der Strafjustiz, von dem als bestehend vorausgesetzten natürlichen Rechtsempfinden des Nichtjuristen als gerecht anerkannt werden sollen. Dieses Rechtsbewußtsein des Volkes wird in der Tat im Strafrecht geradezu vorausgesetzt: wie wäre es sonst zu vertreten, daß selbst die nachweisbare Unkenntnis eines Strafgesetzes keinen Rechtfertigungsgrund darstellt? Oder wie wäre sonst die Durchbrechung des Grundsatzes: Keine Strafe, die nicht schon zur Zeit der Tat gesetzlich angedroht war — im Kriegsverbrechergesetz und anderwärts zu recht- fertigen?
Insbesondere erwartet man diese Übereinstimmung vom Rechtsbewußtsein des Volkes und zu treffender gerichtlicher Entscheidung von einer entsprechenden Auswahl der zum Richteramt Berufenen, so daß der Urteilspruch zugleich die Stimme des Volkes sei, wobei die Stimme des Volkes freilich keineswegs mit einer durch tendenziöse Berichterstattung künstlich geschaffenen sogenannten öffentlichen Meinung gleichgesetzt werden darf.
Eine der Forderungen, die in diesem Zusammenhang laut werden, ist die, nach bevorzugter Heranziehung solcher Richter, die „aus dem Volke“, das heißt dem Arbeiter- und Bauernstände, kommen. Nun ist das Bildungsmonopol eine unbestreitbare Tatsache, ebenso ist sicher, daß bisher nichts Ernstliches zu seiner Durchbrechung geschehen ist. Indessen kann das Problem der sogenannten Klassenjustiz heute als durch die Verhältnisse überholt angesehen werden, und die Gefahr wird vielmehr darin erblickt, daß die „Paragraphen“ die Oberhand über Gerechtigkeit und Menschlichkeit gewinnen könnten. Gegen diese Gefahr schützt freilich erfahrungsgemäß die soziale Herkunft nicht: der Herr Amtrat, dessen Vater am Schraubstock stand, ist nicht selten ein größerer Bürokrat als sein Gerichtsvorstand, der aus einer Akademikerfamilie kommt. Die Versuchung haftet am Beruf, nicht am Elternhaus.
Ein alter Justizsekretär schlug einmal flüsternd vor, jeden Riditeramtskandidaten ein paar Monate lang einzu sperren, „damit er dann später weiß, was er tut!“ Nur ist es halt leider ein Unterschied, ob man im Ernst oder nur „zur Probe“ sitzt.
Um eine Verbindung zwischen „Juristen“ und „Volk“' herzustellen, hat man auf dem europäischen Kontinent seit dem vergangenen Jahrhundert auf verschiedene "Weise versucht, die „Laien“ an der Rechtsprechung zu beteiligen. Zunächst in der Form der Geschwornengerichte, deren Wesen in der Trennung der richterlichen Funktionen besteht: Verhandlungsleitung und Strafbemessung durch Juristen, Entscheidung der Schuldfrage durch ein Laienkollegium. Der schwerwiegendste Nachteil dieses Systems besteht darin, daß der Wahrspruch der Geschworenen praktisch unanfechtbar ist und somit die Gefahr einer gewissen Willkür droht. Eine Gefahr, die um so ernster ist, je mehr die Entscheidung des Gerichtes im Schatten heiß umkämpf- ter Tagesfragen steht. Wie alle Tugenden, bedarf auch die Unparteilichkeit der ständigen Übung und Pflege. Wie alle Tugenden, bedarf sie auch eines gewissen Schutzes gegen Versuchungen. Die Geschworenengerichte sind aus dem angelsächsischen Kulturkreis übernommen worden. Nicht — zuminde- stens nicht in die Praxis — sind aber übernommen worden die scharfen und rigoros angewandten Bestimmungen des englischen Gewohnheitsrechts über „Contempt of Court“ (Mißachtung des Gerichtes), die folgende Hauptbestände umfassen: einmal jede dem Gericht als solchem Ärgernis gebende Veröffentlichung (publication of matter scandalizing the Court), zum Beispiel in grob verletzender Weise gehaltene Kritik der richterlichen Verhandlungsführung, ferner aber „jede auf Obstruktion der Justiz oder Einmischung in das Gerichtsverfahren berechnende Handlung oder Schrift“, das heißt nach der Judikatur schon jeder Gerichtssaalbericht, der in tendenziöser Weise der Entscheidung vorgreift und damit einen unzulässigen Versuch darstellt, sich von der Zuhörertribüne aus in das Verfahren einjfuschalten . Und es ist in England nicht so leicht, sich auf „Vernachlässigung der pflichtgemäßen Obsorge“ durch den „Sitzredakteur“ herauszureden!
Mit anderen Worten: Ein Staat, der eifersüchtig über Ehre und Unbeeinflußbarkeit seiner Richter wacht, eine Justiz, die nicht zögert, ihre Machtmittel rücksichtslos zur Wahrung ihrer hohen Stellung einzusetzen, haben die Geschworenengerichte nicht zu fürchten. Eine schwächliche Justiz, die darauf bedacht ist,, „nicht aufzufallen“ und sich „irgendwie durchzuwinden", wird unzulässiger Beeinflussung mit oder ohne Beteiligung von Laien an der Rechtsprechung erliegen.
Die gewiß nicht abzuleugnende Neigung des „Laien“, sich bei der Urteilsfindung stärker von Gefühlsmomenten als von logischen Erwägungen leiten zu lassen, hat zu einer gewissen Bevorzugung der Schöffengerichte in manchen europäischen Staaten, darunter auch Österreich, geführt, bei denen lediglich die Verhandlungsleitung dem Berufsrichter obliegt, während Schuldspruch und Strafbemessung auf Grund eines Mehrheitsbeschlusses eines aus Juristen und Laien bestehenden Kollegiums erfolgt, in dem die letzteren zahlenmäßig überwiegen. Wer jemals an den Beratungen eines Schöffensenats teilgenommen hat, wird freilich bestätigen müssen, daß es zu den allergrößten Seltenheiten gehört, daß der Berufsjurist von den Laienrichtern überstimmt wird. E as um so mehr, als es für den ersteren geradezu als Ehrensache gilt, sich mit seiner Meinung bei den Schöffen durchzusetzen. Wertlos ist darum die Teilnahme der Laien nicht. Zwingt sie doch den Berufsrichter ständig zur Selbstprüfung, besonders im Hinblick auf jene Gefühlsmomente, die gerade bei der Strafbemessung eine so bedeutsame Rolle spielen. Das Vorhandensein von Laienrichtern trägt sicherlich dazu bei, dem Angeklagten die
~ .jof
Audi das österreichische Strafrecht verbietet die Einmischung der Presse.
Beklemmung zu nehmen, in das Getriebe einer gefühllosen Urteilsmaschine geraten zu sein, und führt daher zu einer Stärkung des Vertrauens in die Rechtsprechung überhaupt, die auch der Stellung des Berufsrichters zugute kommt.
Seltsam genug ist dagegen die radikalste Form der Rechtsprechung in Strafsachen durch Nichtjuristen dem europäischen Kontinent völlig fremd geblieben: die Ausübung der Strafjustiz durch Laien schlechthin, wobei der Jurist lediglich auf Ersuchen des Laienrichters als Berater, ohne jede Entscheidungsgewalt, in Erscheinung tritt. Und doch ist dieses System in England, das im ganzen Staatsgebiet nur etwa 50 beamtete Strafjuristen beschäftigt (zuzüglich weniger Richter des Obersten Gerichtshofes, die teilweise in Strafsachen arbeiten), soweit verbreitet, daß nach einer Statistik aus dem Jahre 1938 98,9 Prozent aller Verurteilten von solchen Niederen Gerichtshöfen verurteilt wurden, die grundsätzlich mit Laien besetzt werden. Von allen 940 Gerichtshöfen dieser Art (Courts of Summary Jurisdiction) sind nun mit Juristen besetzt lediglich die Polizeigerichte eines Teils von London und einiger größerer Provinzstädte. Das System der Laien gerichtsbarkeit in dieser Form ist in England so populär, daß Gemeinden, die an sich das Recht gehabt hätten, beamtete Juristen als Richter zu beantragen, von diesem Rechte keinen Gebrauch gemacht haben. Bezeichnend ist auch, daß in solchen Fällen, in denen das englische Prozeßrecht dem Angeklagten die Wahl zwischen Schwurgericht und dem nicht juristisch vorgebildeten „Magistrate" läßt, der Angeklagte meistens dem Laienrichter den Vorzug gibt. Endlich sei noch erwähnt, daß gegen Urteile der „Magistrates“ nur in einem von je 800 Fällen an das Höhere Gericht appelliert und nur in einem von fünf Fällen das Urteil des „Magistrate“ aufgehoben wird.
Während die konservative Partei indessen die Einführung einer Abart des Schöffengerichtes für die Zukunft erwägt, hat sich ein Unterausschuß der Haldane Society (ein der Labour Party angeschlossener Bund sozialistischer Juristen) mit Entschiedenheit für die Beibehaltung des bisherigen Systems unter der Bedingung gewisser Verbesserungen ausgesprochen. (The Justice of the Peace, Today and Tomorrow, London 1946.) Die Hauptbeschwerdepunkte sind die faktische, wenn auch nicht immer beabsichtigte Bevorzugung konservativ-bürgerlicher Kreise bei der Ernennung, ferner die Tatsache, daß die Beratung des Richters durch den „Clerk of the Court“, den juristisch vorgebildeten Sekretär des Gerichtes (meistens ein Anwalt), nicht in öffentlicher Sitzung enteilt wird. Weitere Vorschläge zielen auf eine Entschädigung des Laienrichters für Zeitverlust und Verdienstentgang und auf Einführung eines obligatorisdien Studienkurses in Strafprozeß und den Elementen des materiellen Strafrechtes.
Ist das oben geschilderte System nachahmenswert? Wenn man bedenkt, daß in Österreich einem gegenüber 193 8 verdoppelten Aktenanfall ein um 50 Prozent verminderter Richterstand gegenübersteht, wenn man sich die Folgen dieses Zustandes vergegenwärtigt: jahrelange Untersuchungshaften, Aktenberge, die nie abgetragen werden usw., hat das englische System etwas Bestechendes. Auf der anderen Seite aber darf nicht vergessen werden, daß die Einschaltung von Laien in die Strafjustiz nach englischem Muster nicht möglich wäre, ohne zugleich unser gesamtes Strafrecht und Strafprozeßrecht, das auf die Handhabung durch Berufs juristen Zuges c'hnitten ist, völlig umzugestalten. Während unser Strafprozeß dem verhandelnden Richter die Last der Beweiserhebung aufbürdet und der Staatsanwalt — mit dem englischen Prosecutor zu vergleichen — beinahe als Statist erscheint, ist der englische Richter ein Schiedsrichter zwischen zwei streitenden Parteien, die ihm — wie in einem Zivilprozeß — Beweis und Gegenbeweis vorführen, er entscheidet den Falf ohne vorheriges Aktenstudium, nur auf Grund der im Kreuzverhör der Parteien zustande gekommenen Zeugenaussagen, und bleibt bis zum Urteil nahezu passiv. Auch an die Begründung des Urteils werden keineswegs die strengen Anforderungen des § 270, Z. 7, der österreichischen Strafprqgeßordnung gestellt. Daß sich mit dem englischen Strafprozeßrecht gut arbeiten läßt, daß der Angeklagte alle Chancen des fair play genießt, ist von österreichischen Juristen oft genug anerkannt worden. Ob seine Vorteile groß genug sind, um mit der ganzen bisherigen Tradition der österreichischen Strafjustiz zu brechen, ist eine Frage, die hier nicht entschieden werden soll.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!