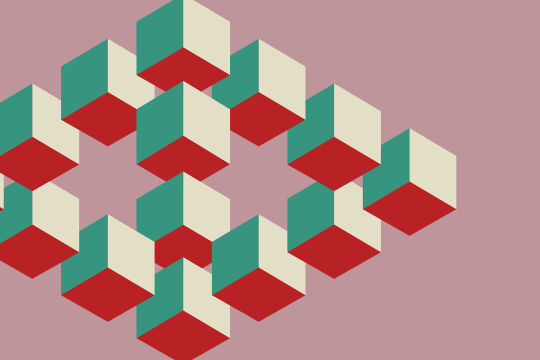Liebe und andere Erschütterungen
Paul kann weder hören noch sehen, aber er spürt Vibrationen - und die Zuneigung seiner Familie. Wie leben Eltern mit schwerkranken Kindern? Was hilft ihnen, was behindert sie? Ein Besuch zum Kinderhospiztag am 10. Februar.
Paul kann weder hören noch sehen, aber er spürt Vibrationen - und die Zuneigung seiner Familie. Wie leben Eltern mit schwerkranken Kindern? Was hilft ihnen, was behindert sie? Ein Besuch zum Kinderhospiztag am 10. Februar.
Die Welt sieht heute wie verzaubert aus. Auf die Gehsteige und Gärten der Siedlung am Rande des Wienerwaldes hat sich eine dünne Schneedecke gelegt und das Alltagsrauschen unter sich begraben. Nur der Liesingbach plätschert leise vor sich hin. Sonst ist alles ruhig hier.
Auch im Wohnzimmer von Familie F. ist es ungewöhnlich still. Kein Kindergekreische, kein Gejohle, kein Gebrülle, auch keine herumliegenden Bausteine, Autos oder Puppen. Nur manchmal ein leises, schnarrendes Seufzen oder Grunzen. Es kommt aus dem Gitterbett, das direkt neben dem großen Esstisch steht. Unter einem hellblauen Himmel und einem Mobile aus Plüschbären liegt ein schmächtiger Körper, umgeben von stützenden Stillkissen: Er ist 80 Zentimeter lang und sieben Kilo leicht. Gesunde Kinder wiegen das oft schon nach wenigen Monaten, doch Paul wird bald zwei Jahre alt. Anfang April 2013 wurde er in einem Wiener Spital geboren - als Sohn einer damals noch minderjährigen, drogenkranken Mutter.
Frau F. ist seine Pflegemutter, aber für die 54-Jährige macht das keinen Unterschied. "Er ist mein Sohn, auch wenn ich ihn nicht zur Welt gebracht habe", sagt sie und richtet für den Besuch Kaffee und Wasser. Mit am Tisch sitzt Martina Kronberger-Vollnhofer, Kinderärztin sowie Leiterin des mobilen Wiener Kinderhospizes MOMO (siehe unten). Sie ist gekommen, um mit Frau F. allfällige Fragen zu klären: Welche Verordnungen sind gerade nötig? Wie gut greifen die Therapien? Soll diese oder jene Operation gemacht werden - oder doch nicht? Alles Fragen, die sich nicht in fünf Minuten besprechen lassen, die aber bei schwerst behinderten Kindern an der Tagesordnung stehen.
Straffer Tagesrhythmus
Kaum etwas an Pauls Körper funktioniert so, wie es sollte: Er kann weder hören noch sehen, er kann sich nicht umdrehen und seine Beine nicht bewegen. Um die Häufigkeit epileptischer Anfälle zu reduzieren, erhält er über eine Magensonde eine fettreiche und zuckerfreie Diät. Alle fünf Stunden rinnt sie 60 Minuten lang über eine Ernährungspumpe in seinen Bauch, dazwischen erhält er über seine Sonde Tee. All das prägt den Tagesrhythmus von Frau F. - wie auch das spezielle Lagern gegen Wundliegen, das regelmäßige Wickeln und diverse Therapien: Jede Woche kommen eine Sehfrühförderin und eine Hörfrühförderin vorbei sowie eine Krankenschwester der mobilen Kinderkrankenpflege MOKI-Wien, um die Magensonde zu reinigen; einmal pro Woche muss Paul schließlich zur speziellen Physiotherapie ins AKH, um die hohe Muskelspannung zu reduzieren. Ob seine ausgekegelte Hüfte demnächst operiert werden soll, muss noch mit Orthopäden diskutiert werden.
Viele Familien zerbrechen an einer solchen Herausforderung. Familie F. hat sie bewusst angenommen. Paul ist zwei Monate alt, als Frau F. und ihr Mann ihn vorerst als Krisenpflegekind bei sich aufnehmen. Beide verfügen über langjährige Erfahrung im pädagogischen und psychologischen Bereich, sie sind damals bereits leibliche Eltern zweier erwachsener Töchter und eines halbwüchsigen Sohnes sowie Pflegeeltern zweier Buben von vier und 17 Jahren. Eigentlich soll Paul bald fix bei anderen Pflegeeltern unterkommen, doch nach und nach zeigt sich, dass der Drogenmissbrauch wesentliche Verschaltungen im Gehirn beeinträchtigt hat und die Behinderungen schwerer sind als befürchtet: "Normale" Pflegeeltern würden damit überfordert sein, und auch ein Pflegeheim mit einem Betreuungsverhältnis von 1:12 scheidet aus: "Wenn Paul Bedürfnisse hat, steigert er nicht die Lautstärke, sondern hört irgendwann auf", sagt Frau F. Also beschließt die Familie, ihn zu behalten.
Aufopferung? Bestimmung!
Nicht alle im Verwandten- und Freundeskreis haben das verstanden. Doch für Frau F. gab und gibt es keine Alternative: "Der Paul hat es geschickt geschafft, in kürzester Zeit in unsere Herzen zu gelangen", sagt sie, nimmt ihn aus dem Gitterbett und drückt ihn zu sich an die Brust. "Er gibt mir auch unglaublich viel zurück." Mit Aufopferung habe das alles nichts zu tun, eher mit Bestimmung - auch wenn dazu das ganze Leben umgekrempelt werden muss.
Erst vergangenen Dezember ist die Familie vom 14. Bezirk hierher nach Wien-Liesing gezogen, in ein barrierefreies Haus aus den 1960er-Jahren mit den Schlafzimmern im Erdgeschoß. Wenn alles gut geht, schläft Paul in seinem eigenen Gitterbett im Zimmer der Eltern, wenn es ihm schlecht geht, legt ihn seine Mutter zu sich auf den Bauch. "Er spürt die Erschütterungen und Vibrationen, wenn ich atme", erzählt sie. "Und dann beruhigt und entkrampft er sich." Spürend, tastend, streichelnd: So kommuniziert sie mit ihrem blinden und tauben Sohn.
All das hat Frau F. gelernt, vieles Andere weiß sie aus beruflicher Erfahrung. Doch mit den Behörden hat auch sie zu kämpfen. Finanziell kommt die Familie noch über die Runden: Für Pflegestufe 7 erhält sie monatlich 1500 Euro Pflegegeld. Größere Anschaffungen werden aber schwierig: Irgendwann wird der momentane Kinderwagen für Paul zu klein werden und durch eine Extraanfertigung ersetzt werden müssen. Kostenpunkt: bis zu 3000 Euro. Sich all das rechtzeitig organisieren zu müssen, ist das eigentliche Problem. "Immer muss man 27 Wege gehen - oder auch das Rad neu erfinden", erzählt Frau F. Wie etwa den Flaschenhalter, den sie auf der fahrbaren Sitzschale montiert hat, um mit Paul auch während der Sondierung mobil zu sein. Was es also bräuchte, wäre eine Stelle, an die sich Eltern schwerstbehinderter Kinder jederzeit einfach und unbürokratisch wenden können - und die umfassendes Case-Management betreibt.
Lebensgefahr bei Durchfall
Das mobile Kinderhospiz MOMO leistet im Großraum Wien diesen Dienst - und organisiert für betroffene Familien medizinische Versorgung, pflegerische Betreuung durch MOKI-Wien, psychosoziale Beratung sowie seelsorgerische Begleitung. Auch ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen entlasten die Eltern oder kümmern sich gezielt um Geschwister. Wie wichtig ein persönlicher Ansprechpartner ist, hat Frau F. erst rund um Weihnachten erlebt. Ein Durchfall hätte beinah dazu geführt, dass Paul gestorben wäre. "Der Monitor hat unglaubliche Dinge angezeigt, dauernd hat es gepiepst" erzählt Frau F. und drückt das Kind noch fester an sich. Irgendwann um 23 Uhr hat sie Martina Kronberger-Vollnhofer angerufen. "Eine unglaubliche Ressource", sagt Frau F.
Vielleicht kommt es schon morgen wieder zu einer solch lebensbedrohlichen Krise. Vielleicht lebt der kleine Paul aber noch jahrzehntelang, hier, in diesem Haus neben dem leise plätschernden Liesingbach. Über all das zerbricht sich Frau F. nicht den Kopf. "Ich mache mir die Sorgen von heute und nicht die von in 20 Jahren", sagt sie. Nur über eines ärgert sie sich maßlos: Wenn Menschen sie fragen, warum sie sich das antue - und zu definieren beginnen, was lebenswertes Leben sei. "Paul hat es ins Leben geschafft", erklärt Frau F. "Und jetzt haben wir als Gesellschaft die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er es so gut wie möglich leben kann."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


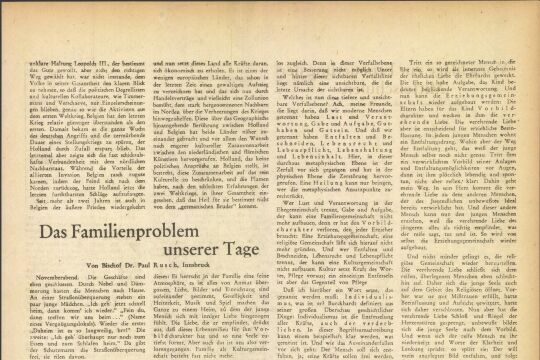








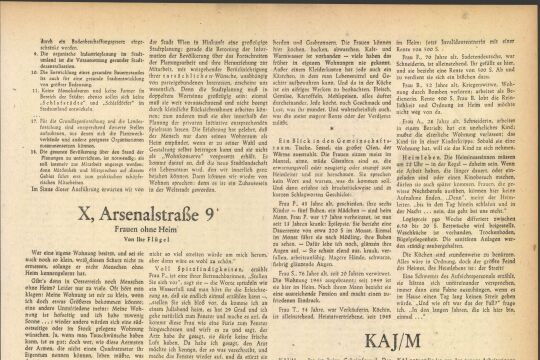









































































.jpg)