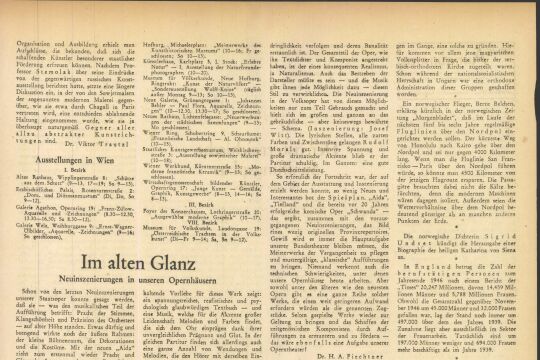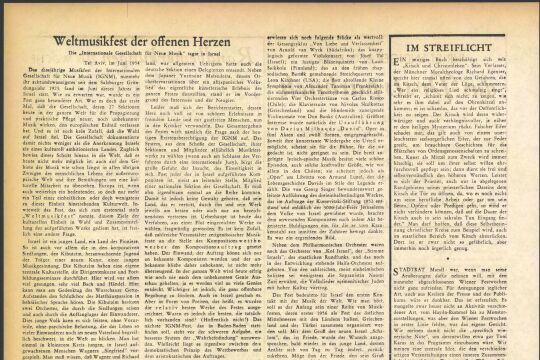Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Räuber-Oper in neuer Fassung
An der neuen Version von Giselher K1 e b e s Oper „Die Räuber“, zum Saisonende am Staatstheater Kassel erstmalig und mit Erfolg erprobt, spiegelt sich in mehrfachem Sinne das Wirken der Zeit. Vor genau fünf Jahren ging im Düsseldorfer Hause der Deutschen Oper am Rhein die Uraufführung in Szene — so lange mühte man sich also um eine Nachspielbühne; die gleiche Spanne benötigte det Komponist, um seinem Opus Gestalt zu geben. Ob die Neufassung nach einer Bühne strebte oder das Haus sich von der Chance der zweiten Uraufführung eines bereits als gültig ausgewiesenen Werkes verlocken ließ, ist nicht näher bekannt, aber für den symptomatischen Vorgang auch ohne Bedeutung. Als solchen möchte ich bezeichnen: die Annäherung von kultureller Realität — zu der auch das Aufnahmevermögen eines gutwilligen Publikums gerechnet sei — an den Stratosphärenflug kompositorischer Ideen. Für eine solche Entwicklung sind fünf Jahre eine nur kurze Frist...
Schon anläßlich der Hamburger Stra-winsky-Ehrung war zu registrieren, wie nahe sich die Musik-Moderne und das Parkett gekommen sind, doch da war Tanz im Spiel, ein listiger Mittler seit je. Von einer vergleichbaren Begeisterung konnte in Kassel zwar nicht die Rede sein, aber von einem gespannten Zuhören und bejahender Aufnahme durchaus. In der Rheinmetropole hatten junge Besucher von der Galerie aus Protest erhoben — das übliche widerspruchsvolle Bild bei solchen Gelegenheiten. Klebes Werk ist, auch noch in der Überarbeitung, auf einen gegenwärtigen Status der neuen Musik gegründet; das heißt: auf den Stilbereich nach Webern. Der Komponist hat aber nichts weniger getan als Weberns Partikel nur eben in die Großform übertragen: er schuf sich sein eigenes Zellensystem, in dem neben der sogenannten Wiener Schule vor allem — Klebe präsent ist. Zwölftonstruktur, musikdramatisch aktiviert wie bei Dallapiccola, Bergsche Espressivo, Webem-sche Autonomie des Einzeltons — das alles wirkte prägend auf den überaus beredten Instrumentalsatz und die vokale Linie ein. Doch Klebes Eigenes: das ist die Steigerung des Gedanklichen, auch des Gedanklich-Konstruktiven, bis es in eine neue Qualität umschlägt — die des frei flutenden Ausdrucks, des Gesanges. Wie sich die neue Musik mehr und mehr von den seriellen Fesseln befreit, um wieder Klangereignis zu werden, so gibt Klebe dem Gesang sein Recht. Die zweite Ausgabe seiner „Räuber“-Partitur dient einzig diesem Zweck. Chornummern und der Tenorpart des Karl sind stimmlichem Vermögen angeglichen, Arioses trat an die Stelle von Rezitativen.
Heute darf Klebe revidieren, weil er jene Sicherheit gewonnen hat, die ihn vor Glätte bewahrt. Der Zuwachs an Können wird honoriert: Rolf Liebermann erteilte ihm den Auftrag, eine Oper fürs hauseigene Hamburger Ensemble und damit fürs Repertoire zu schreiben. Als repertoirefähig haben sich jüngst die „Tödlichen Wünsche“ nach Balzac bei der Zweitinszenierung in Münster erwiesen, und auch den „Räubern“ dürfte der Weg jetzt bereitet sein.
Wie die Zeit vergeht — auch in dieser neu erlebten Oper selber. Die Katarakte der Handlung, wie Schillers unbändiggeniales Wort sie geformt, gerinnen in musikalischen Bildungen, die ihrerseits Räume umschließen, Zeiten umgrenzen. Wir betreten das Phantasiereich des Musiktheaters. Der junge Dirigent Theodor G r e s s — wenn nicht alles täuscht, von gleichartigem Temperament wie Klebe — und Regisseur Reinhold Schubert, der als Dramtaturg der Rhein-Oper dem Komponisten die Opernpfade ebnen half, waren in Kassel berufene Führer. Die zweite Uraufführung gewann nicht zuletzt von der realisierenden Leistung her ihren Rang — nun auch als ein Ereignis der Zeit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!