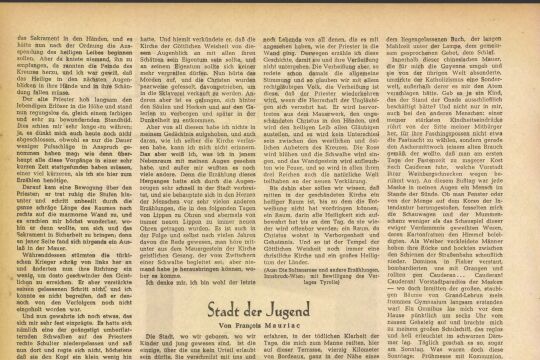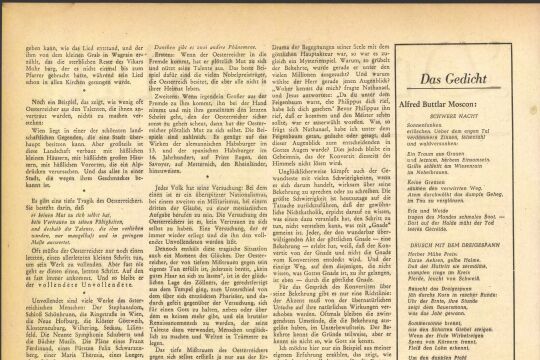Amélie Nothomb schrieb die Geschichte eines Kindes, das schon längst alles weiß.
Eine Erzählung wie ein Staubsauger: Der Leser wird gefressen und nach 160 Seiten ausgespuckt. Amélie Nothomb wurde als Kind eines belgischen Diplomaten in Japan geboren und schreibt seit zehn Jahren wie besessen. In Frankreich werden von ihren Büchern 400.000 Exemplare verkauft. "Metaphysik der Röhren" heißt das neueste. Ein sperriger, hochtrabender, vielleicht auch etwas abschreckender Titel, doch wird hier eine besondere Geschichte erzählt.
Unmerklich lenkt die Autorin den Denkprozess, lenkt den Leser nicht durch Einzelheiten zu sehr ab, lässt vieles im Verschwommenen. Unwichtig ist, wie die Personen aussehen. Wir müssen nicht jede Warze kennen. "Am Anfang war das Nichts", so beginnt der Roman, und das klingt bekannt.
Bis zum dritten Lebensjahr sind Kinder in Japan bekanntlich eine "ehrenwerte kindliche Existenz, seine Hoheit, das Kind". Dann setzt der Druck ein. Das Kind des Romans ist jedoch ein besonderes, eines, das weniger Geräusche von sich gibt als eine Zimmerpflanze. Amélie nimmt ihre Umgebung nur wahr, zeigt keine Regungen, verdaut nur, bis die Großmutter kommt und sie mit einem Stück weißer belgischer Schokolade erweckt. "Seit jenem Februar erinnere ich mich an alles. Wozu etwas behalten, woran man keine Freude gehabt hat? Die Erinnerung ist eine der unentbehrlichsten Verbündeten der Freude."
Amélie wird zu einem besonderen Kind, das etliche Sprachen liest, aber weiß, dass es nicht klug wäre, dies preiszugeben. Seine Altklugheit konterkariert das Verhalten der Erwachsenen, die dem Kindern immer mit den Fingern ans Gesicht wollen, ihm schillernde Karpfen schenken, weil sie glauben, ihm damit eine Freude zu machen und auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern wird altklug gesehen: "War die Männlichkeit etwas so Grandioses, dass man ihr eine Fahne und einen Monat widmete - noch dazu den lieblichen Monat, in dem die Azaleen blühen?"
Auch der Wertkodex der Japaner wird ad absurdum geführt: "Jemandem das Leben zu retten hieße, ihn durch die Verpflichtung übertriebener Dankbarkeit zu versklaven. Besser ihn sterben zu lassen, als ihm die Freiheit zu rauben." Bereits das sechste Wort, das Amélie lernt, heißt "Tod". "Der Tod war die Zimmerdecke. Wenn man die Decke besser kennt als sich selbst - das nennt man den Tod." Bei einem Badeunfall steht sie knapp davor, wird aber noch einmal gerettet, der Sturz in das Karpfenbecken ist der erste und einzige Suizidversuch. "Die Rettung ist ohnehin nur ein Aufschub. Eines Tages wird keine Fristverlängerung mehr möglich sein."
Das Ende der Phase, in der das Kind der Gott des Lebens ist, ist - zumindest in Japan - zugleich der Verlust des Vertrauens in die ewige Freundlichkeit der Welt. "Erst das Wachstum, dann der Verfall. Dazwischen ist nichts. Einen Zenit gibt es nicht; er ist eine Illusion. Und so gab es auch keinen Sommer. Es gab einen langen Frühling, ein dramatischer Anstieg der Säfte und der Begierden, doch sobald dieser Schub aussetzte, begann der Absturz."
Mit diesen Worten spuckt der Staubsauger der Erzählung den Leser auf der letzten Seite wieder aus und lässt ihn allein: Lies und stirb, scheint die Devise der Autorin. Was ist das Leben anderes, als die Zeit, sterben zu lernen. Wenn das abgehakt und die Lehre absolviert ist, wird der Rest fröhlicher. Frei nach Richard Wagners "Siegfried": "Leuchtende Liebe und lachender Tod". Robert Streibel
Metaphysik der Röhren
Roman von Amélie Nothomb, Diogenes Verlag, Zürich 2002, 160 Seiten, geb., e 17,40
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!