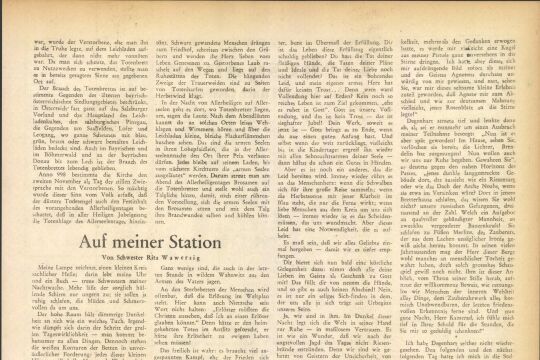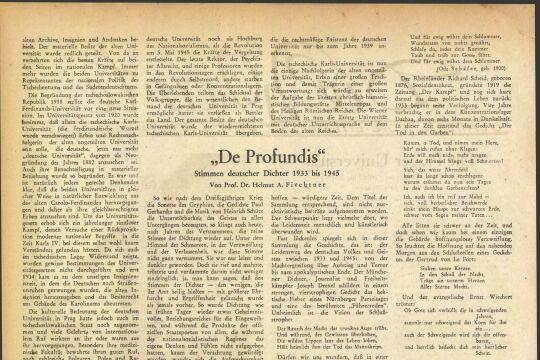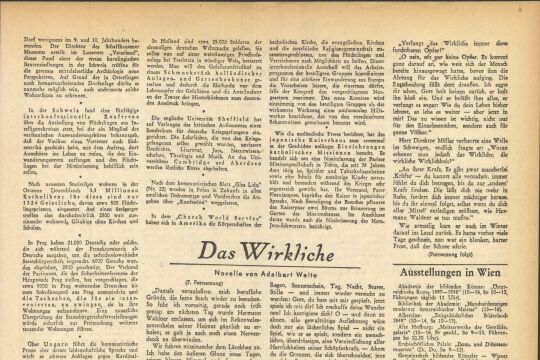Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Glück des Unglücklichen
Erst nach dem Tod von Giovanni Papini am 7. Juli 1956 erreichte uns der folgende Aufsatz des berühmten italienischen Dichters, den er kurz vor seinem Tod, geplagi von schwerer Krankheit, schrieb.
Manchmal wunder ich mich über jene, die meine Ruhe verwundert, meine Ruhe trotz des Elends, in das mich die Krankheit warf. Ich habe den Gebrauch der Beine, der Arme, der Hände verloren, ich bin fast blind und fast stumm, ich kann also weder gehen, noch die Hand eines Freundes drücken oder auch nur meinen Namen schreiben. Es ist mir nicht mehr möglich zu lesen, zu diktieren oder ein Gespräch zu führen.
Für einen, den der eigene rasche Schrift auf täglichen weiten Wanderungen ein Leben lang beglückte, für den leidenschaftlichen Leser, der, was er selbst verfaßte, stets eigenhändig niederschrieb — Briefe, Notizen, Gedanken, Artikel und Bücher — bedeutet das alles härteste Entsagung.
Aber es ist mir nicht wenig geblieben, sondern viel, sondern das beste.
Erscheinen mir Dinge und Menschen auch nur undeutlich und trüb, gleich Phantomen hinter aschgrauen Nebelschleiern, so bin ich doch nicht zu völliger Finsternis verdammt: ich vermag mich noch an dem festlichen Einbruch der Sonne zu freuen und an der Aura einer Lampe. Und wenn sie meinem rechten Auge ganz, ganz nahe sind, kann ich sogar die Farben der Blumen erkennen und die großen Züge eines Gesichts.
Ja, diese letzten Funken der schwindenden Sehkraft sind für den Mann, der seit zwanzig Jahren in der Angst vor der immerwährenden Nacht lebt, ein frohes Wunder.
Noch mehr: ich habe noch immer das Glück, den Worten eines Freundes lauschen zu können, der Lesung eines schönen Gedichtes oder einer schönen Geschichte, ich darf noch manchmal ein Lied hören oder eine jener Symphonien, die dem Herzen neue Wärme geben.
Und alles dieses ist nichts, verglichen mit den göttlichen Gaben, die der Herr mir sonst noch ließ: ich bewahrte, wenn auch unter täglichem Kampf, Glauben, Verstand und Erinnerung, Bildkraft und Phantasie, die Leidenschaft des Denkens und das innere Licht der Schau, ich bewahrte die Nähe der Meinen, die Neigung der Freunde, die Fähigkeit, auch Menschen zu lieben, die ich nie persönlich sah, und das Glück, von vielen geliebt zu werden, die mich nur durch meine Werke kennen. Auch vermag ich meine Gedanken und Gefühle — wenn auch mit quälender Langsamkeit — immer noch anderen mitzuteilen.
Könnte ich noch sehen, reden, schreiben, mich bewegen und hätfe dabei einen dumplen, wirren Geist, einen trägen, unfruchtbaren Versfand, eine kurze, lückenhafte Erinnerung, eine ohnmächtig erloschene Einbildungskraft, ein erstarrtes, gleichgültiges Herz — mein Elend wäre unendlich tiefer. Ich wäre dann eine tote Seele in einem nutzlos lebendigen Leib. Und was nützte mir eine heile Zunge, hätte ich nichts zu sagen? Immer trat ich für die Herrschaft des Geistes über die Maferie ein — was für ein arger Schwindler und Feigling war' ich, käme ich heule in der Stunde der Prüfung unter der Last der Leiden zu einem anderen Schluß!
Und da ich nun schon einmal beim Bekennen bin, so will ich's bis ins Unwahrscheinliche, ja Unglaubhafte treiben. Die wesentlichen Zeichen der Jugend sind drei: der Liebeswille, der Wissensdurst, der Angriffsgeist. Nun, trotz meines Alters und meiner Krankheit will ich lieben und geliebt werden, will ich stürmisch auf allen Gebieten des Wissens und der Kunst Neues erfahren, schreckt mich, geht es um die Verteidigung höchster Werte, weder Polemik noch Attacke!
Und darum — mag es auch irr und lächerlich scheinen — habe ich die Kühnheil, zu sagen, daß mich auch heute im großen Meer des Lebens noch die hohe Flut der Jugend trägt.
Uebersefzt von Hermen von Kleeborn
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!