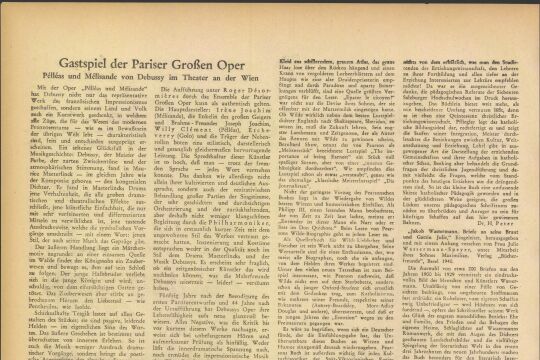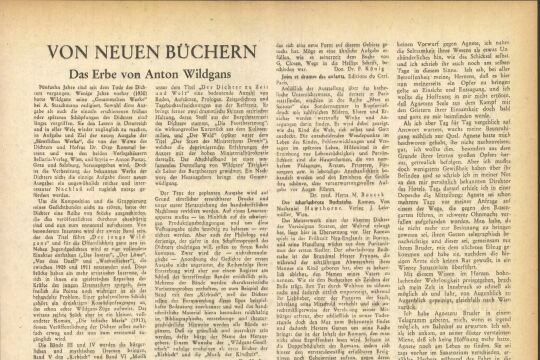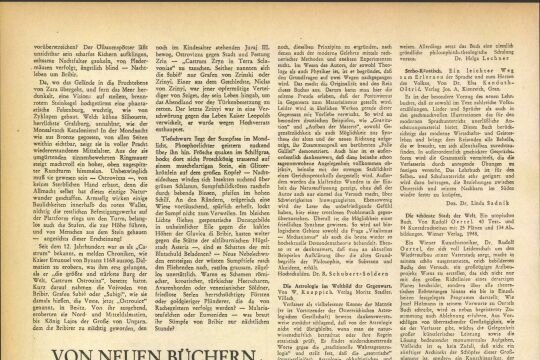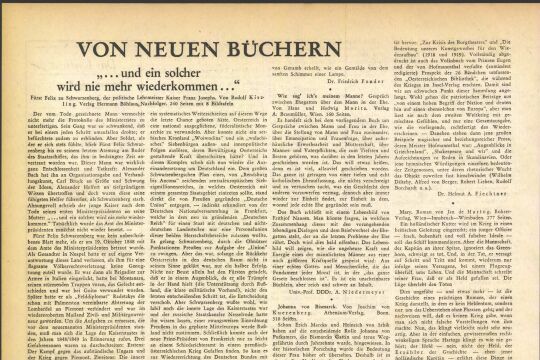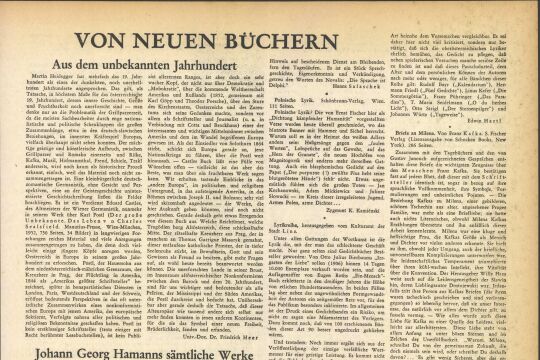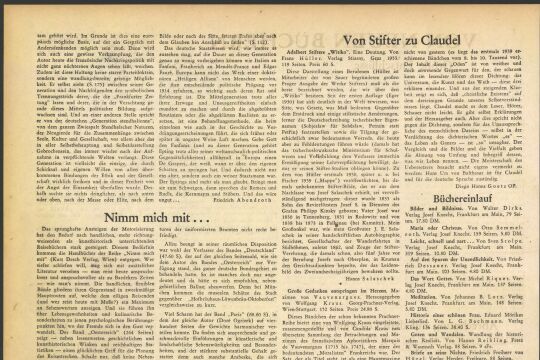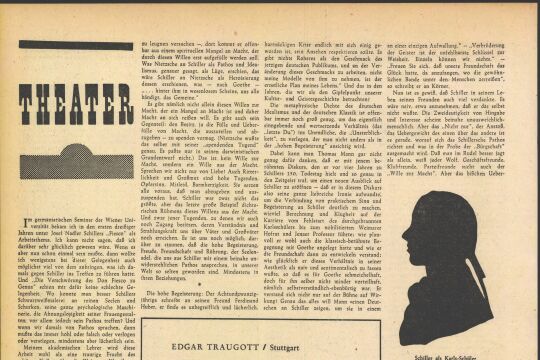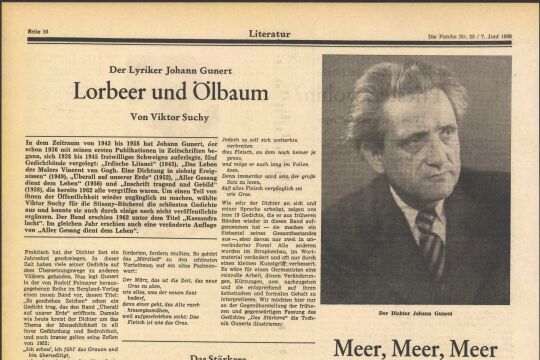Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Haben Schiller und Goethe gelebt?
Vor etwa 35 Jahren sprach der geistsprühende Egon Friedeil im Josefstädter Theater in einer Sonntagsmatinee über das süffisant formulierte Thema: „Haben Schiller und Goethe gelebt?“ Seine Antwort war natürlich: Nein! Sie haben bisher nur in den Hirnen der Wäsche-zettelklitterer und in den Angstträumen von Maturanten ein nebuloses Dasein geführt. Aber gelebt, wirklich gelebt und fortgelebt? Mag sein, daß die Gedenkjahre 1959 und 1955 die Schiller-Forschung „belebt“ haben, kurz: Schiller lebt wieder und hat gelebt, zwar nicht eben glücklich, schön und mit wallenden Locken, sondern — so sagt Emil Staiger in seinem neuen Buch — in erbittertem, lebenslänglichem Kampf gegen Erziehung, leibliche Not und Krankheit, in der „Fremde des Lebens“ (seiner äußeren Erfahrung) und seiner inneren Erfahrung: der Freiheit, das ist der Gewißheit seiner selbst. Von dieser seiner Freiheit und Größe und seinem Ich, deren dichterischen Niederschlag Staiger in Schillers Lyrik und Prosa, besonders aber in seiner eigentlichen Heimat, dem Theater, überzeugend nachweist, führt der Weg über Friedrich Schlegels Verliebtheit in das Subjekte und Interessante mitten hinab in den Zweifel und Ekel, die Angst und das Entsetzen unserer Heutigen; sie modern und verwesen zum Teil — Schiller lebt!
Im Nachwort zu seiner Dokumentation von Schillers Leben und Schaffen wirft der Herausgeber, Walter Hoyer, die Frage auf, warum denn eigentlich Schiller im Gegensatz zu Goethe niemals (von drei kurzen Hinweisen abgesehen) an eine Autobiographie gedacht habe. Die Antwort überzeugt: Goethe habe das Leben an sich ziehend entfaltet und daher Zeit und Umwelt im Spiegel seiner selbst beschrieben, Schiller dagegen habe das Leben seiner eigenen poetischen Bestimmung unterworfen (1795 an Goethe: „So viel ist indes gewiß, der Dichter ist der einzige wahre Mensch“) und es im Kampf gegen Zwang und Krankheit besiegt. Er „verbrannte sich gleichsam zum Werk als Erfüllung seines Lebens“. Daher seine Abneigung, sich biographisch zu betrachten. Hier hat die Literatur-forscbung in die Lücke zu springen und uns, wie im vorliegenden Buch, den Dichter und sein Werk in Briefen, Gesprächen und Zeugenaussagen menschlich näherzubringen. Strenge Auswahl ist selbstverständlich, denn wäre die Wiedergabe der uns bekannten Quellen (ohne Kommentar!) vollständig, so würde sie nicht einen, sondern fünfzehn Bände füllen!
Ja, das hat der selige Fontane eben selbst besorgt. Er schrieb, schrieb, schrieb, über sich und andere, über Leipzig und Berlin, über Zeit und Milieu, bis unsere
Tage richtig eine siebenundzwanzig-bändige (jeder Band pfundschwer!) Gesamtausgabe, die „Nymphenbur-ger“, beisammen hatten — nur noch vier Bände und zwei Teilbände stehen aus. Über diese Mammutausgabe wurde hier schon berichtet. Nun, im Anblick des zweiten autobiographischen Bandes, des Bandes XV der Gesamtausgabe, muß der Rezensent das etwas herbe seinerzeitige Urteil modifizieren; nicht etwa aus Pietät, weil am 12. Februar 1967 der Herausgeber, Kurt Schreiner, verstorben ist, sondern weil ein nicht weniger als 228 Seiten umfassender Anmerkungsteil, des Herausgebers letzte Tat, ein schier unerschöpfliches Material ausbreitet, das jeder künftigen Fontane-Forschung den Weg weist.
Lebt Stifter? Auch ihn haben ganze Jahrzehnte eingesargt — und heute wieder neu belebt. Dies gilt nicht nur für einzelne „Bunte Steine“, sondern auch für die beiden vorliegenden neuen Bände: die „Studien“, die trotz dem bescheidenen Titel zu den bedeutendsten Erzählungen des 19. Jahrhunderts zählen, und die böhmische Rosenberger-Chronik: den letzten der beiden Romane Stifters, „Witiko“, unbeschadet des liebenswürdigen Irrtums des Dichters: im historischen Roman (Scott!) seien die Geschichte (er meint die Ereignisse) die Hauptsache und die einzelnen Menschen Nebensache — straft ihn nicht sein dunkles Leben selbst „Lügen“? Anerkennenswert Fritz Kökels Nachworfr; und Magda Gerkens fachkundige Textbetreuung.
Vier der fünf bekannteren Wildgans-Dramen (nur „Liebe“ fehlt) werfen die Frage auf, ob sie beziehungsweise welche von ihnen „dauernder als Erz“ sein werden. Zur Zeit sind sie — im Gegensatz zu den dreißiger Jahren — nicht eben hoch im Kurs: sie sind zu „lyrisch“, sagen die Dramaturgen, „zu durchsichtig“ sagen die modernen Seelen- und Nasenbohrer und Dämonischen. Sie mögen einzig nur Gottfrieds Monolog „Zwei Züge fahren von A nach B“ aus dem Actus mysticus von „Armut“ nachlesen und mit dem Rezensenten sagen: Wffldgans hat gelebt und gelitten, er lebt und wird leben; samt seinen lyrischen Dramen!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!