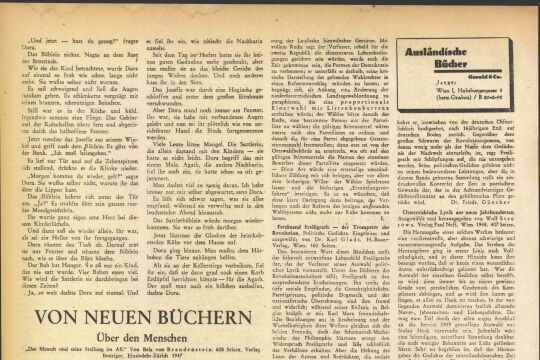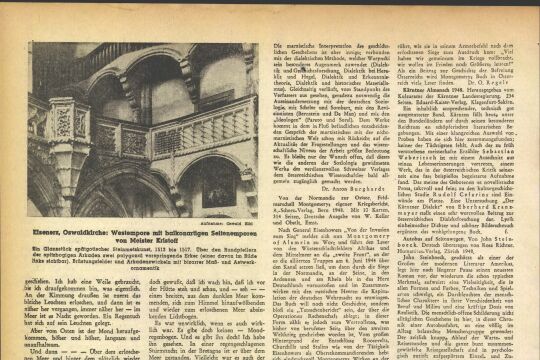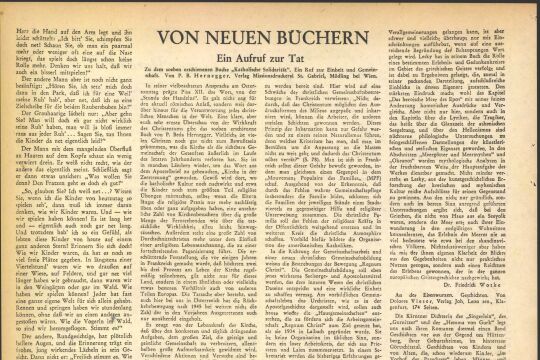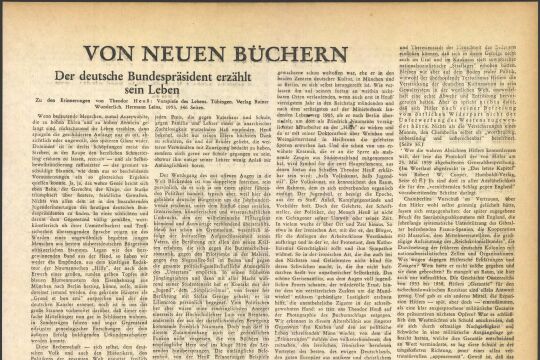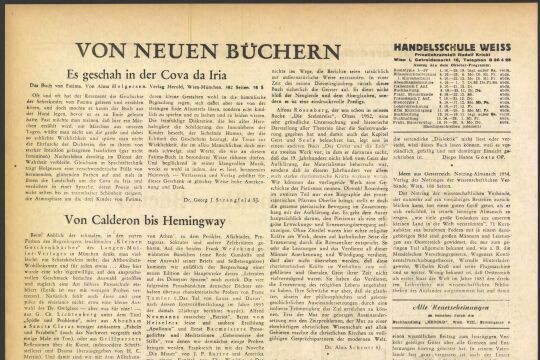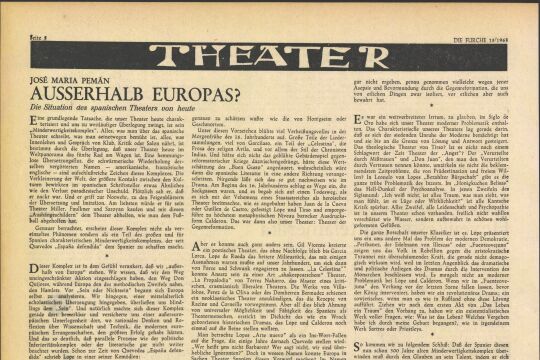Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Henri Millon de Montherlant
Monlherlcinf, der erst in seiner Reifezeit für das Theater zu schreiben begann, ist damit sofort zu unbestrittenem Ruhm gelangt. Sein Stil, der schon in seinen Romanen außerordentlich klar und kultiviert war, erreichte in den Dramen eine klassische Vollkommenheit, die ihn zu einem der besten zeitgenössischen Schriftsteller Frankreichs macht. Montherlants geistiger Werdegang aber, der seit zehn Jahren beharrlich Probleme des christlichen Gewissens streift, hat sich nicht so einfach entwickelt. Das Heldentum im Kriege, der Kampfgeist im Sport begeisterten ihn zuerst: dem nihilistischen Lafcadio von Gide, dem feigen „Zazou“ von Radiguet sowie den morbiden Jünglingen von Mauriac stellte Montherlant nach dem ersten Weltkrieg feste Charaktere entgegen, die nach Disziplin streben, von Gröfje schwärmen, vor der Aufopferung nicht zurückschrecken und dabei eine gewisse Verachtung der weiblichen Liebe nicht verhehlen. Dieses „spartanische“ Ideal entsprang keiner grausamen Weltanschauung. Mit den „Bestiaires“ (1925) jedoch bekundet Montherlant einen seltsamen „Stierkampfkult“, der sich bald zur heidnischen Mystik der männlichen Kraft entwickelt und das Mitleid verabscheut. Die bereits behandelten Themen — körperliche Disziplin, bewußte Annahme der Gefahr und des Todes, Liebesverachtung — tauchen wieder auf. Sie haben sich jetzt aber verhärtet und werden von einem protzigen Zynismus gefärbt, in dem man nicht einfach eine überspitzte Reaktion gegen den moralischen Defaitismus der, Nachkriegszeit erblicken darf.
Der montherlantsche Voluntarismus verbarg in der Tat eine labile Unentschlossenheif, die stark an Gide erinnert, und eine getarnte „Heaufologie“ ohne innere Synthese nagte an der schönen Fassade dieses „heroischen“ Ideals. „Eine katholische Erziehung, die Denker des antiken Roms, Spaniens und vor allem der Kult der Tauromachie“; das waren allzu heterogene Faktoren, und Montherlants Persönlichkeit konnte dabei zu keiner Einheit gelangen. Das Fehlen eines existentiellen Engagements bedeutete jedoch kein Versagen, kein Abdanken: Montherlants Unsfetigkeit pendelte zwischen Attitüden hin und her, denen es nicht an Größe fehlte.
1925 wird er in Albacefe bei einem Stierkampf schwer verwundet; eine lange Krankheit unterbricht seine Karriere und eine mehrmonatige Rekonvaleszenz führt ihn dann nach Nordafrika, wo er auf denselben „immoralistischen“ Pfaden wandelt, die Gide bekanntlich zwanzig Jahre früher begangen hatte. Diese Jahre bilden eine Periode des moralischen Zusammenbruches, in der er seinen Hedonismus, einen unheilbaren Egotismus auf die recht ekelhaften Figuren seines Romanzyklus „Les jeunes filles“ (1936—1939) überträgt. Dabei macht jeder Heroismus einem selbstgefälligen Dilettantismus, einem morbiden Bedürfnis nach raffinierten Emotionen, einer zur Schau gestellten Verachtung jedes „Pharisäismus“ und der fraulichen Werte sowie einem totalen Fehlen jeglichen Sündenbewußtseins Platz.
Montherlant hatte zwar ehrlich versucht, sich der katholischen Disziplin zu unterziehen. 1929 nimmt er in Solesmes an Exerzitien feil, 1930 pilgert er nach Rom. Diese christliche Episode scheint aber keine Folgen gezeitigt zu haben: die Mystik des „Service inutile“ (1935) mündet nämlich in eine hochmütige Ethik der „Qualität“ ein. Diese Herrenmoral blieb aber sehr problematisch, und er war sich dessen selbst bewußt, als er diese Periode seines Lebens mit affektierter Ironie beschloß: der montherlantsche Held ist nämlich damals eine paradoxale Mischung aus Vincent de Paul, I. Kant und Casanova. „Wer dies alles zugleich sein könnte, der würde sicher Gott Ehre machen“ schreibt er 1938, „er wäre ein ausgezeichnetes menschliches Musterbeispiel.“
Von dieser literarischen und menschlichen Vergangenheit gezeichnet, kommt Montherlant 1942 zum Theater. Seine Bühnenwerke hat er selbst in zwei Kategorien eingeteilt: die „profanen“ (Reine morfe, Fils de personne, Malatesta) und die „christlichen“ Stücke (Maifre de Santiago, La ville, Porf-Royai), die er unter die Patronanz der „aufosacramentales“ der spanischen Klassiker gestellt hat. Es sind ausschließlich Dramen: da er die Darstellung unerträglicher Geschehnisse als das Grundprinzip des Schauspiels betrachtet, gewährt er keiner anämischen Handlung auf seiner Bühne Einlaß. Durch die psychologische Gespanntheit und den übermenschlichen Charakter der Situationen, erinnert das montherlantsche „Neocorneillismus“ an den grausamen Realismus von Sartre und Camus, wogegen der spanische Rahmen die oft künstliche Atmosphäre der romantischen Dramen eines Hugo wachruft. Montherlants Hispanismus wirkt allerdings, im Gegensatz zu dem von Claudel, schmerzhaft übertrieben und obwohl seine christlichen Helden die hergebrachte Sprache der katholischen Asketik sprechen, sind sie eher verführerische Marionetten in den erstaunlich geübten Händen eines Zauberers, die ihnen dieselben pseudoheldenhaften Bekenntnisse in den Mund legt, wie früher den heidnischen Helden seiner Romane.
Durch die zwei bekanntesten seiner letzten Theaterstücke (Maifre de Santiago, Porf-Royal), hat Montherlant ausgesprochen im Rahmen des Katholizismus das Problem der persönlichen religiösen Berufung behandelt sowie die Konflikte, die sie im Schoß der Familie oder der Kirche auslöst. Ist die Handlung des erstgenannten, trotz des geschichtlichen Hintergrundes, erdichtet, so ist hingegen „Porf-Royal“, an dem er über zwanzig Jahre gearbeitet hat, die getreue Uebertragung auf die Bühne von echt historischen Ereignissen aus der jansenislischen Krise in Frankreich. Mit diesem religiösen Drama von unzweifellos hoher Geistigkeit nimmt Montherlant mit dem österreichischen Publikum zum erstenmal Fühlung. Es ist dies eine glückliche Fügung: denn es ist ihm gelungen, in diesem Werk aus einer theologischen Krise und einem kirchlichen Konflikt die echt menschliche Substanz herauszugestalten und somit ein neues „heiliges Experiment“ geschickt darzustellen.
Man darf aber dabei das Gesamischaffen Montherlants nicht vergessen und dessen komplexe Gedankengänge bagatellisieren, die „Port-Royal“ erst seine richtige Beleuchtung verleihen. Ein katholisches Theater? Montherlant, der „Katholik ohne Glauben“, würde höchstwahrscheinlich selbst daran zweifeln.
In einem Brief von 1947 erklärte er, daß der echte Jansenismus für ihn mehr „Zartheit in der Caritas“ als „religiöse Starrheit“ bedeute, und er berief sich auf Nietzsche, um die „wehmütige Milde“ der pascalschen Meditation über das Kreuz zu unterstreichen. Die sachliche Kritik erhebt gegen diese paradoxale Patronanz keinen Einspruch,
Am 3. Jänner 1956 findet im Burgtheater die deutsche Erstaufführung von Montherlants Drama „Port-Royal“ statt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!