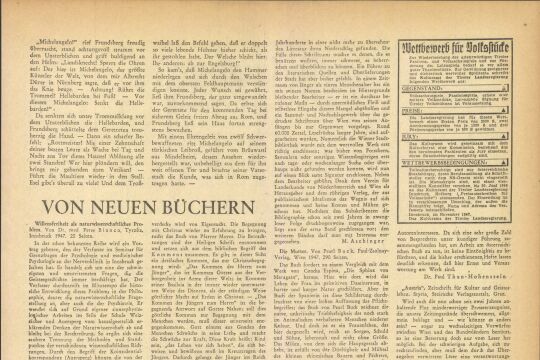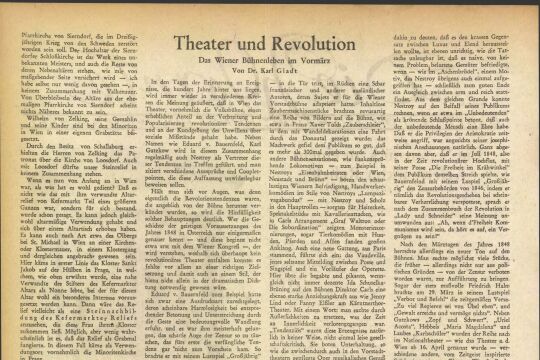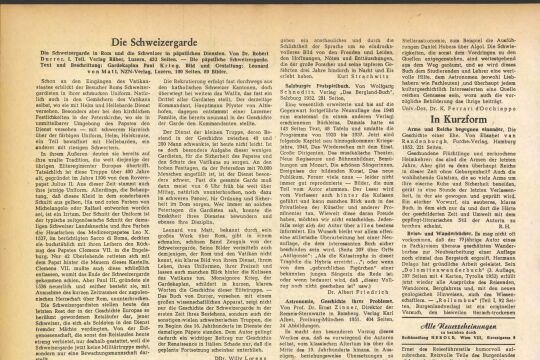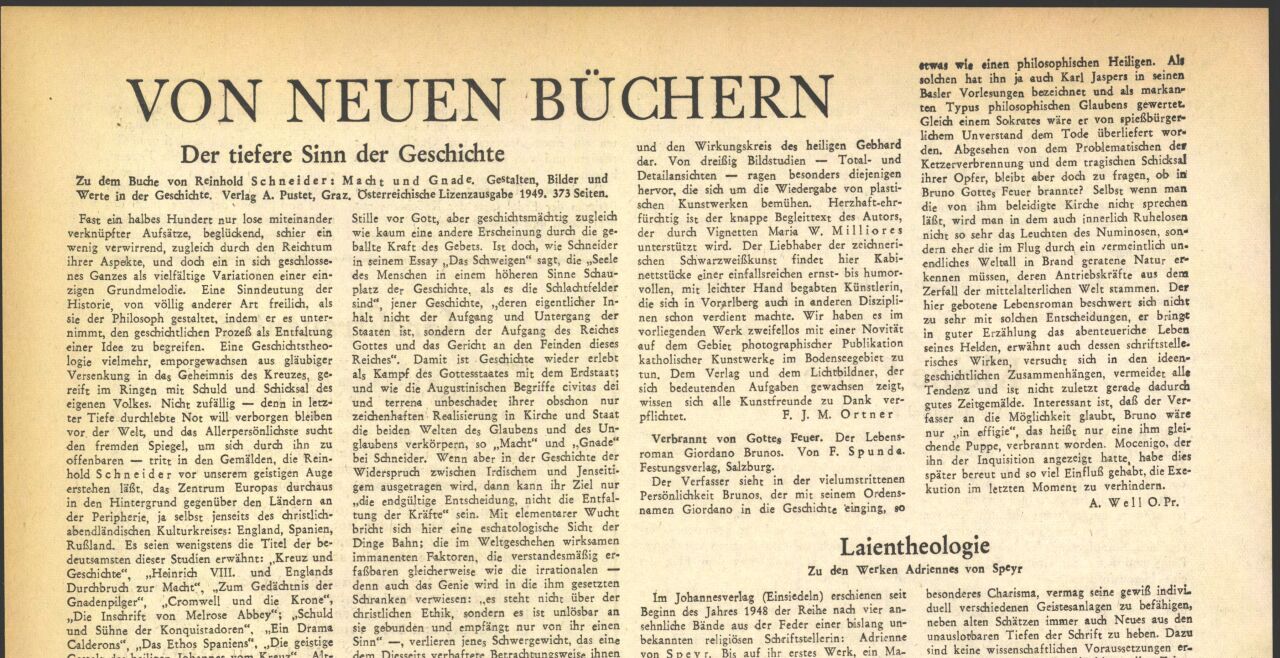
Im Johannesverlag (Einsiedeln) erschienen seit Beginn des Jahres 1948 der Reihe nach vier ansehnliche Bände aus der Feder einer bislang unbekannten religiösen Schriftstellerin: Adrienne von S p e y r. Bis auf ihr erstes Werk, ein Marienbuch: „Magd des Herrn“, nenne sie sie alle Betrachtungen. „Die Abschiedsreden“, Betrachtungen zu Kap. 13—17 des Johannes-Evangeliums, „Die Streitreden“, Betrachtungen zu Kap. 6—12 des Johannes-Evangeliums, und „Die Bergpredigt", Betrachtungen zu Kap. 5—7 des Matthäus-Evangeliums. Aber auch das zuerst genannte Marienbuch gründet in nichts anderem als in den sehr tiefdurchdachten und durchbetrachteten Stellen und Perikopen, die in den Schriften des Neuen Bundes über die Gottesmutter zu finden sind. Die Schreiberin ist praktische Ärztin in Basel. Sie stammt aus einem alten protestantischen Geschlechte der Stadt. Seit ihrer Jugend liest sie ständig die Hl. Schrift, nicht aus irgendeiner Frömmigkeit im Stil des traditionellen religiösen Lebens, sondern aus einem geheimen Suchen und aus der Erwartung, daß dieses Suchen in den Zeilen des Gotteswortes zu einer Erfüllung kommen müsse. So hat sie sich im Laufe der Jahre mit einem weiten und sehr geistigen Herzen buchstäblich in das Wort der Schrift bineingelesen. Krankheit, Studium, Ehe, Beruf und harte Schidcsalsschläge haben ihre von einer außergewöhnlichen Begabung getragene Aufnahmsfähigkeit nur noch erhöht. Im Jahre 1940 ist ihr jahrzehntelanges Suchen zu einem gewissen Abschluß gekommen: zur Konversion in die katholische Kirche.
Das zweifellos Bedeutsamste an Adrienne von Speyr ist die Tatsache, daß in ihr eine echte und e r n s t z u n e h m e n d e Laientheologin erstanden ist. Laientheologie ist immer noch für nicht wenige ein anstoßerregender Begriff. Wer aber etwa zu Zeiten eines Clemens von Alexandrien oder eines Tertullian gelebt hätte oder wenigstens vor der Etablierung deir mittelalterlichen Universitäten, dem wären Laien als Theologen keineswegs von vornherein als seltsame oder gar als verdächtige Erscheinungen in der Kirche vorgekommen. In der mittelalterlichen Universität ist von der Theologie der aristotelische Wissenschaftsbegriff rezipiert worden, und sie ist in die Reihe, ja sogar an die Spitze der anerkannten und aus historischen Gründen hauptsächlich von Klerikern betriebenen Wissenschaften getreten.
Wollte nun tatsächlich jemand in eine der theologischen Disziplinen eintreten, wie sie im Laufe der geschichtlichen Entwicklung entstanden, ohne die bereits erarbeiteten Erkenntnisse und Formulierungen zu beachten und zu benützen, dann wird er dem genannten Vorwurf schwerlich entgehen können. Nur auf einem Gebiet braucht und kann das nicht zutreffen, nämlich auf dem Gebiet der lebendigen Durchdringung des geoffenbarten Gotteswortes. Gewiß können auch hier wissenschaftliche Voraussetzungen, vor allem philologischer und historischer Art, von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein. Gewiß wird niemand ohne die Lenkung der Kirche, die bei einigen, nicht allzu vielen Stellen der Schrift den Sinn klar und eindeutig bestimmt hat, Vorgehen dürfen. Gewiß wird sich jeder Gläubige in allem und jedem dem Urteil der Kirche, der eigentlichen von Gott bestellten Auslegerin der Schrift, unterwerfen. Auch in der Frage, ob nicht vielleicht wahre Erkenntnisse hic et nunc als inopportun zurückgestellt werden müssen. Alle diese wichtigen Einschränkungen vorausgesetzt, kann niemand bestreiten, daß da geoffen- barte Gotteswort zunächst und unmittelbar an jeden Gläubigen gerichtet ist und nicht bloß an fachmäßig vor- und ausgebildete Theologen. Jeder Christ hat das Recht, ja auch die Pflicht, nach dem Sinn der Schrift zu fragen, und die Ergebnisse seines Suchens können ohne weiteres über das hinausgehen, was ihm bereits aus den Formulierungen der kirchlichen Symbole bekannt ist. Das jedem Christen eingegossene Glaubenslicht und die Kraft seiner Liebe, bisweilen auch ein besonderes Charisma, vermag seine gewiß indivL duell verschiedenen Geistesanlagen zu befähigen, neben alten Schätzen immer auch Neues aus den unauslorbaren Tiefen der Schrift zu heben. Dazu sind keine wissenschaftlichen Voraussetzungen erforderlich, dazu sind die Gläubigen aller Zeiten berufen. Und wer in das innere Leben „einfacher Gläubiger“, di in der Schrift zu lesen begonnen haben, hineinhorchen durfte, kann diese Tatsache aus immer wiederkehrender Erfahrung bestätigen. Gewiß, es wird Grade des Offenbarungsverständnisses geben, und man wird vielleicht erst dann von einer „Theologie" reden können, wenn mit dem Verstehen auch eine gewisse Ausdruckskraft gegeben ist. Aber Theologie ist es; denn auch die wissensdiaftliche Theologie kann zuallererst nichts anderes tun, als aus der Fülle der Quellen schöpfen. Vielleicht wird die Situation eine ander werden, wenn einmal eine katholische Bibeltheologie in allgemein anerkannter Weise die Grundformen des biblischen Denkens und Ausdrucks erarbeitet hat.
Adrienne von Speyr ist nun geradezu ein Paradigma echter Laientheologie. Sie liest in einem tiefen und vor allem gläubig-frommen Suchen die Schrift und beginnt sie paraphrasierend zu deuten. Diese Art ist in vielem der Methode der Väter ähnlich. Es geht da so wie bei Ausgrabungen immer: die großen Funde werden Zufall oder richtiger: Gnade sein. Aber noch ein weiterer Vergleich mit den Kirchenvätern ist möglich. Wie diesen eignet auch Adrienne von Speyr ein ganz selbstverständlich kirchlicher Sinn. Unaufdringlich zeigt es sich immer wieder, wie die Schreibe, rin dieser Betrachtungen in der lebendigen Glaubenswelt der Kirche daheim ist. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Art ihrer „Betrachtungen“. Betrachten ist ihr keine rein intellektuelle, bloß im „Objektiven“ sich haltende Angelegenheit, sondern schließt stets eine persönliche Stellungnahme mit ein. Betrachten fordert Beteiligung der Existenz. Wer gute Betrachtungen schreiben will, muß sie mit dem Ganzeinsatz seines Lebens schreiben. Und je diskreter dabei ein Appell an den Leser: Geh hin und tue, wie dir gesagt wurde! verbunden ist, desto eindringlicher werden solche Betrachtungen wirken. Eben das gilt alles in einem hervorragenden Maße von den Betrachtungen Adriennes von Speyr.
Das tiefste Anliegen Adriennes von Speyr scheint zu sein: den Geheimnissen des trintari- schen Lebens nachzuspüren. Mit diesem notwendig verbunden ist ein zweites Geheimnis, das auch bereits in der Väterzeit Gegenstand der schärfsten theologischen Auseinandersetzungen geworden ist: das gottmenschliche Innenleben Jesu. Hier ist es erst recht das Geschick der besonderen Einfühlungsgabe dieser Frau, die uns, getragen von einem demütigen Glauben, immer wieder neue Räume des Herzens unseres Herrn eröffnet. Und dies nicht jenseits des geoffenbarten Wortes in jener sattsam psychologisierenden Weise. Sie vermag Tiefen zu erschließen, zu denen die alltägliche Exegese selten oder nie Zugang gewinnt. Mit Recht hat jemand geschrieben, daß Adrienne von Speyr in ihren theologischen Betrachtungen dort beginnt, wo die landläufige Schrifterklärung lang aufgehört hat. Hier eröffnet sich uns einmal die Länge, Tiefe und Höhe des Wissens um die Liebe Christi. Endlich darf noch ein drittes nicht unerwähnt bleiben, worauf die Verfasserin in neuer und theologisch bedeutsamerweise besonders in ihrem Marienbuch hinweist: auf die wesenhaft Gott zugewandte und dabei über sich selbst verfügende personale Existenz des Menschen. Wer aufmerksam diese auch ein tiefes Schriftverstehen beweisende Marienbetrachtungen durcharbeitet, wird erkennen können, welch große anthropologische Konsequenzen sich aus einer Mariologie ergeben müssen, die ganz und gar im Wort der Schrift wurzelt. Zusammenfassend kann man nur sagen, daß diese Betrachtungen in vielem einer Schrifttheologie, wie sie ja von der Enzyklika „Divino afflante“ so sehr gewünscht wird, Wege weisen kann.
P. Dr, Leopold S o u k u p O. S. B., Abtei Seckaudes Mannes, ihr kommt es tu, die Arbeit unter den Nebenfrauen zu verteilen.
Daß in einer mehrere Frauen umfassenden Ehe eine von diesen Frauen den Ton angibt, gewissermaßen die Führung innehat, darf nicht verwundern, es ist zur Aufrechterhaltung der Ordnung notwendig und steht mit der allgemeinen polygynen Haltung nicht im Widerspruch. Auffallend aber ist, daß diese Führerrolle gerade die zuerst geheiratete Frau einnimmt und nicht etwa die an Jahren ältere oder die vom Manne am meisten geliebte Frau, die Lieblingsfrau.
Auffallend ist, daß ihr nicht nur diese aus organisatorischen Gründen notwendige Führerrolle zukommt, sondern daß sie nur aus ihren Prioritätsrechten heraus gleichzeitig Anspruch auf mehr und auf bessere Geschenke des Mannes hat. Nicht die persönliche Zuneigung, die Liebe des Mannes, entscheidet über die Zuwendung von Geschenken, sondern die Tatsache, ob sie die zuerst oder die später geheiratete Frau ist. Eine derartige Haltung muß auffallen, und die Frage, scheint diese nicht der Rest einer früheren monogam en Lebensweise zu sein, dürfte daher der Berechtigung nicht entbehren.
Noch auffallender als diese Bevorzugung der zuerst geheirateten Frau ist aber die Vorstellung der Nyamwezi, daß der Sexualverkehr mit der zweiten Frau den Kindern des Mannes mit der zuerst geheirateten Frau schaden könnte. Die zweite Frau schmückt daher die Kinder mit einem Perlenhalsband aus weißen Perlen oder einem Armband aus den gleichen Perlen, um mit Hilfe der Magie der drohenden Gefahr zu begegnen. Das ist ein auffälliger Widerspruch zu einer polygynen Haltung. Liegt es nicht nahe, in diesem Widerspruch ein Relikt, ein Oberlebsel, ein irvival, um mit Tylor zu sprechen, ans einer monogamen Vorzeit zu sehen?
Auch bei den Masai, die in tief eingewurzelter Polygynie leben, besteht ein derartiger auffallender Widerspruch: Die braven, guten Menschen, die sich in ihrem irdischen Leben bewährt haben, leben im Jenseits in menschlicher Weise, doch ohne Sorge, ohne Mühe und ohne Arbeit. Täglich erhalten sie das beste Essen im Überfluß- Jeder aber darf nach Gottes Gebot nur eine Frau haben. Dies ist ein gleicher ungeiklärter Widerspruch zu der vollkommen klaren und tief verwurzelten Haltung der Masai. Hinzuweisen ist schließlich noch auf die Abstammungsmythen der Burungi und Fiomi, die das Menschengeschlecht von einem einzigen Menschenpaar herleiten, von dem nur eine monogame Lebensweise offenbar wird. Worin man ebenfalls einen Gegensatz zu ihrer sonstigen polygynen Lebenshaltung erblicken mag.
Die Entwicklung der Ehe ist aber wohl anders vor sich gegangen, als es der alte Evolutionismus lehrte. Am Anfang der Zeiten stand kaum die Promiskuität, sondern die monogame Ehe, und die später einsetzende Polygynie ist nichts anderes als eine Entartungserscheinung.
Erst später, als sich aus dem Zusammenklang von Hirten und Ackerbaukulturen die Hochkulturen entwickelten, die in ihrer weiteren Entwicklung zu den Trägern der morgen- und abendländischen Kulturgestaltung wurden, können wir bei einigen von ihnen in historischer Zeit bereits, etwa - bei den Römern, bei den Griechen, bei den Germanen, neuerdings die Einehe konstatieren. Eine Wendung, die durch die revolutionäre Kraft des Christentums für das gesamte Abendland fundiert und zu einem Dauerzustand gemacht wurde.