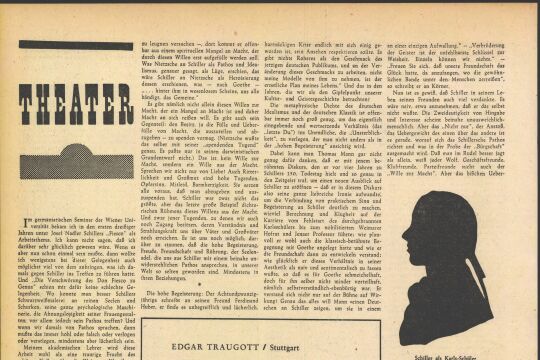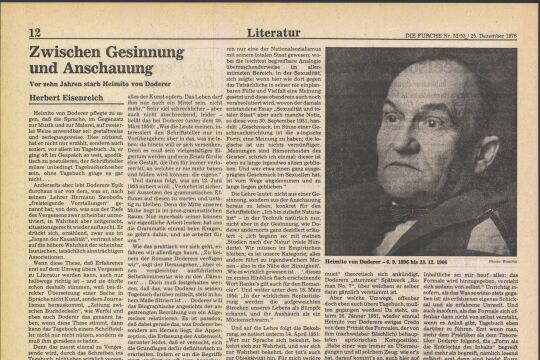Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Fähigkeit, zu trauern
Der Geschichtenerzähler Theodor Weißenborn handelt von der Unfähigkeit, zu lieben — und zwar mit der Penetranz, die den Schriftsteller merkbar vom Dilettanten unterscheidet. Zum Dichter wird man ja stets nur um eines einzigen Themas willen — bei Doderer etwa war das der Umweg, bei Hemingway das Bestehn in der Niederlage. Der Dichter hat, im genauesten Wortsinn, keine Wahl, nicht einmal beim Stoffe. Paradigmatisch lebt er, im Schreiben, etwas, das in seiner Zeit und in seiner Welt vorhanden ist und just in ihm sich konkretisieren, sich aussprechen will.
Von der Unfähigkeit, zu lieben also handelt Theodor Weißenborn: von dieser Unfähigkeit schon der Kinder und Halbwüchsigen, und weiter dann junger Menschen in jenem Alter, im dem man physisch noch voll auf der Höhe und geistig-seelisch schon reif für die Liebe ist, oder, nach Weißentoorn, reif nur zu sein scheint, da die Begegnungen meistens mißlingen. Bei den Kindern — „Die Züge nach Morrow“ oder „Beinahe das Himmelreich“ — bei den Kindern ist es die dominierende Phantasie, in der die erst ängstlich geahnte Realität sich verflüchtigt — so auch in der Titelgeschichte. Die jungen Männer hingegen leiden anv Wirklichen selbst, weil es offenbar niemals sich zu einer ganzen Wirklichkeit fügt: zum Bewußtsein des Ich in der voll akzeptierten Wirklichkeit eines Du.
Der Autor, bescheiden, erklärt nicht; er konstatiert nur: läßt nur, mit Stifter zu reden, „die schreckliche Gewalt der Tatsachen“ sprechen, beläßt, mit Doderer zu reden, „das Sinnlose bei seinem Begriffe“. Er deutet nicht, deutet höchstens an: daß' dem „Sohn der Armee“ eben diese die (nicht bloß sexuell zu verstehende) Unschuld geraubt; oder daß „Der Tag, der ihnen gehört“, tatsächlich keinem der beiden gehört, weil er besetzt war mit — hier ist das Wort einmal wirklich am Platze! —, mit unbewältigter Vergangenheit, in der nicht einmal skizzierten Gestalt einer Monika, „und man hatte Gelegenheit, Entsagung zu üben und das Glück des andern zu wünschen, vornehm, ohne Szenen, und was vorher gewesen war, war eben vorbei, und was man gebraucht hatte zum Leben wie die Luft zum Atmen und die Religion, eine ganze, ungeteilte Empfindung, die alles beflügelt und das Dasein sinnvoll machte, das war alles vorbei, gone und passe —, und man resignierte und verzichtete zugleich auf alles, auf alles, ein für allemal, damit das Leid ein Ende hatte, und was vorher zum Lieben gewesen, war nun zum Hassen, und man zerstörte ...“
Weißenborn, dem ein heftiges politischen Engagement hier nachgerühmt und dort angelastet wird, erzählt ohne jedwede Ideologie, aber immer voll Humanität — sogar auch vom Tod eines Hundes. Denn die Trauer ist entweder unteilbar, oder sie ist keine Trauer, sondern bloß Ausdruck von schwachen Nerven.
Und er erzählt mit einer handwerklichen Redlichkeit, die gerade den Deutschen weithin abhandengekommen ist in der Schizophrenie zwischem abstrakt ziseliertem Experiment und besoffen hingeschludertem Engagement. Hier lebt, und zwar in voller Gegenwärtigkeit, jene gute alte Tradition weiter, die sich zu Recht auf Tschechow und Maupassant berufen darf und vor allem von den Angelsachsen gepflegt worden ist: aus einem Minimum von Sensation ein Maximum an Bedeutung herauszuholen, oder, anders gewendet: die wahre Bedeutung der scheinbar bedeutungslosen Sache sichtbar zu machen mittels der Sprache.
DAS LIEBE-HASS-SPIEL. Von Theodor Weißenborn. 25 Stories. 254 Seiten. Horst Erdmann Verlag, Tübingen und Basel 1973.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!