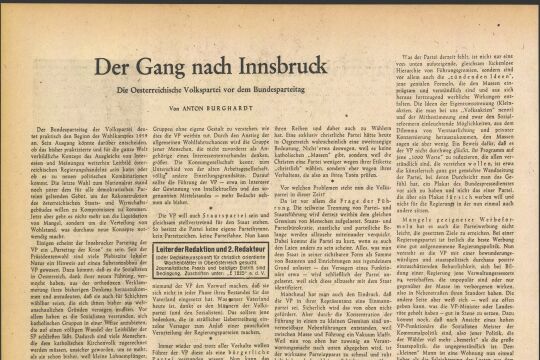Früchte der Faulheit
Die SPÖ kann ihrer Krise nur entkommen, wenn sie den Wählern Konzepte gegen die dramatischen Folgen der Digitalisierung bietet. Doch dazu fehlen ihr der Plan und der Mut.
Die SPÖ kann ihrer Krise nur entkommen, wenn sie den Wählern Konzepte gegen die dramatischen Folgen der Digitalisierung bietet. Doch dazu fehlen ihr der Plan und der Mut.
Peter Kaiser, Sozialdemokrat und Landeshauptmann von Kärnten, hat sich einiges von seinem „blutenden“ politischen Herzen geschrieben. Ein Protestbrief an die Genossen in Wien ist es geworden, ein Nachschlag zu den krachenden Wahlniederlagen des Herbstes. Die Kommunikation der Partei funktioniere weder nach innen noch nach außen, schrieb Kaiser, man brauche eine grundlegende inhaltliche Debatte, einen Aufbruch, und die Gesellschaft eine Befreiung von den „neoliberalen Fesseln“.
Wie sehr diese Fesseln die SPÖ selbst würgen, wurde am Dienstag ruchbar: 14 Millionen Euro Schulden, ein Drittel der Mitarbeiter vor der Kündigung. Und der Rest der Angestellten? „Wir werden mit weniger Mitarbeitern mehr leisten müssen.“ Dieser Satz stammt nicht von einem neoliberalen Ausbeuter, sondern von SP-Chefin Rendi-Wagner. Und er reimt sich gut auf Kaisers Leiden: Die SPÖ ist nicht mehr, was sie sagt, dass sie sei – eine Arbeiterpartei.
Deshalb zurück zu Kaisers Frage: Ist die SPÖ reformierbar? Die Antwort auf diese Frage lautet: ja – aber leicht wird es ihr nicht fallen. Denn dazu müsste die Partei ihre eigenen Wurzeln in Frage stellen. Die Art nämlich, wie sie Arbeit sieht und definiert. Wie etwa geht die SPÖ mit der Digitalisierung um, bei der bis zu 30 Prozent der Jobs für immer verloren gehen könnten? Wie umgehen mit jenen, die keinen Platz mehr auf dem Arbeitsmarkt finden werden? Wie behandelt man die Überforderung und Entsolidarisierung der arbeitenden Menschen, ihre Transformation in Einzelunternehmer? Was tun mit den „Working poor“?
Die taube Führung
Die Antworten auf diese Fragen könnten der SPÖ eine neue Identität geben, aber die geistige Umstellung wäre gewaltig. Denn die Fama vom stolzen Arbeiter, dem seine lebenslang gesicherte Stelle Sinn und Halt im Leben gibt, kann nicht mehr gelten in einer Zeit, in der die Arbeit ausgeht. Müsste also die Sozialdemokratie nicht den Kampf für das bedingungslose Grundeinkommen einleiten, so wie sie im 19. Jahrhundert für die damals unvorstellbare 48-Stunden-Woche kämpfte? Müsste sie nicht für eine digitale Maschinensteuer eintreten, als Teil der sozialen Sicherung? Für eine „Finanztransaktionsabgabe“ – auch gegen EU-Widerstand?
Nichts von alledem ist derzeit Mittelpunkt der SP-internen Debatte. Stattdessen hört man abgekaute Stehsätze über Gerechtigkeit und ja, gegen den Neoliberalismus, den die Partei seit 30 Jahren mitgetragen hat. Dazu noch schwachbrüstige Aktualitäten: Die Partei solle sich öffnen, thematische „Koalitionen“ mit den Wählern eingehen. Diese Inhalts-Faulheit der Parteiführung rächt sich – und wird das weiter tun. Am besten überspielt das noch die Zukunftshoffnung der SPÖ: Hans Peter Doskozil.
Ein Mann des Volkes, ein Mann, der gegen die Bobo-Elite zu Felde zieht. Freilich - als Fürst einer roten Erbpacht wie dem Burgenland lässt sich leicht mokieren. Über die Zentrale, Rendi und die Porsche-Partie. Inhaltlich aber herrscht auch hinter dem Getöne Doskozils gähnende Leere. Mehr noch: Er selbst könnte einer Täuschung unterliegen, wenn er meint, er müsse Wählern nur nach dem Maul reden und einen Schuss FP zur SP-Politik mischen für seinen Erfolg.
Zwar kommt die SPÖ tatsächlich „aus der Bevölkerung“, wie Doskozil sagt – woher auch sonst? Aber auch die Bevölkerung erwartet von der Politik tragfähige Lösungen, nicht bloße Anbiederung. Das gilt übrigens weit über das Burgenland hinaus. Und aus all dem ergibt sich ein für die SPÖ explosives Ganzes, wenn es Richtung Zukunft geht: Die Partei verdankt ihre Geburt einem dramatischen Wandel der Arbeitswelt im 19. Jahrhundert. Sie wird an einem ebenso drastischen Wandel der Arbeit im 21. Jahrhundert zugrunde gehen, wenn sie ihren Kurs hält. Und in diesem Sinn „blutet das rote Herz“ Peter Kaisers zu recht im Voraus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!