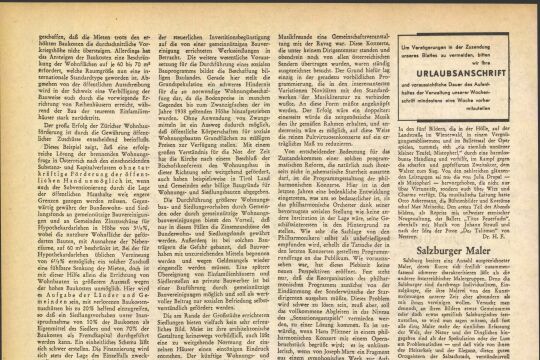Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nur noch ein Luxusgegenstand?
Wenn heute von der Kunstgattung „Oper“ gesprochen wird, so fallen alsbald Namen von Dirigenten, Sängern und Regisseuren. Ob Karajan oder Bernstein den besseren „Falstaff“ macht, was und wo man etwas fehlinszeniert hat, ob man die Callas und del Monaco definitiv abschreiben müsse und ähnliches mehr. Das Weiterleben der Oper ist zwar maßgeblich von ihren Interpreten abhängig — aber auch noch von etwas anderem. Hierüber spricht in dem folgenden Beitrag der österreichische Komponist und langjährige Musikkritiker im „Wiener Kurier“, wie er einmal war, Rudolf Weishappel, Jahrgang 1921, Autor der Opern „Elga“, „Die Lederköpfe“ und „König Nicolo“. die in Graz, Linz und Wien aufgeführt sowie auch fürs Fernsehen produziert wurden. F.
Wenn heute von der Kunstgattung „Oper“ gesprochen wird, so fallen alsbald Namen von Dirigenten, Sängern und Regisseuren. Ob Karajan oder Bernstein den besseren „Falstaff“ macht, was und wo man etwas fehlinszeniert hat, ob man die Callas und del Monaco definitiv abschreiben müsse und ähnliches mehr. Das Weiterleben der Oper ist zwar maßgeblich von ihren Interpreten abhängig — aber auch noch von etwas anderem. Hierüber spricht in dem folgenden Beitrag der österreichische Komponist und langjährige Musikkritiker im „Wiener Kurier“, wie er einmal war, Rudolf Weishappel, Jahrgang 1921, Autor der Opern „Elga“, „Die Lederköpfe“ und „König Nicolo“. die in Graz, Linz und Wien aufgeführt sowie auch fürs Fernsehen produziert wurden. F.
Allabendich geht in den großen und kleinen Opernhäusern der Welt der Vorhang in die Höhe. Allabendlich sitzen mehr oder weniger festlich gekleidete Menschen vor diesem Vorhang und warten auf dessen mu-sikutrerauschfes Hochgehen. Und allabendlich glauben diese mehr oder weniger festlich gekleideten Menschen, mit ihrer Eintrittskarte den Teünahmeschein an etwas erworben zu haben, was man wohl gemeinhin so das „kulturelle Leben“ nennt. Sie ahnen nicht, daß sie nur die Gäste eines Leichenschmaus-Rituals sind, das noch dazu von der öffentlichen Hand, vom Steuerzahler, auf die großzügigste Art subventioniert wird.
Den Beweis für diese Leichenschmaus-These liefern zwei Tatsachen. Die erste Tatsache: Seit ziemlich genau fünfzig Jahren, seit der Uraufführung von Puccimis „Turan-dot“, ist das internationale Opernrepertoire einem stetigen Schrumpfungsprozeß unterworfen. Jeder Opernfan, der heute über fünfzig Jahre alt ist, wird bestätigen müssen, daß eine ganze Reihe von Werken, die in seiner Jugend noch zum festen Spielplanbestand gehörten, aus dem ständigen Repertoire verschwunden ist. Dieser „Schwund“ dürfte bei ungefähr 25 Prozent liegen. Nun hat es diesen Ausleseprozeß in der Geschichte der Oper immer gegeben: Schon ein Eduard Hanslick hat in einem berühmten Essay über die Kurzlebigkeit der meisten Opern meditiert. Aber bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die „Zuwachsrate“ doch so hoch, daß der natürliche „Schwund“ mehr als ausgeglichen worden ist.
Die zweite Tatsache: Im Bereich der Oper ist heute nur noch das In-terpretatorische interessant, und hier wiederum mehr das Optische als das Akustische. Die Regisseure und die Ausstatter sind die wahren Helden der heutigen Opernbühne. Die Folgen dieser „Umkehrung der Werte“ sind bereits deutlich erkennbar: Die Zahl der wirklich bedeutenden Operndirigenten Wird immer kleiner, die Auswahl an Spiteensängern immer dürftiger. Das „Weltensemble“ erster Sänger, von dem Karajan noch vor zehn Jahren schwärmte, ist so klein geworden, daß man heute nicht einmal mehr einen „Othello“ ideal durchbesetzen kann. Es ist daher geradezu lächerlich, wenn Wiens Opernkritiker bei jeder Premiere in ein großes Gejammere über Besetzungsmängel ausbrechen, für die sie den Operndirektor verantwortlich machen Man tut so, als ob dieser geplagte Mann in seinem Managerbüro am Ring nur die Hand auszustrek-ken brauchte, um an jedem Finger fünf Isolden, fünf Aidas, fünf Othellos, fünf Wotans und fünf Osmins hängen zu haben.
Aber all dies sind bereits zweitrangige Folgeerscheinungen des erstrangigen Problems, das da heißt ,3epertoireschrumpfung''. Dem Spielplan wachsen keine neuen Werke au. Das ist Schuld einer verfehlten Auftrags- und Uraufführungspolitik, die immer nur auf der Suche nach dem „zukunftweisenden Geniestreich“ ist und dabei ständig in die Falle der eisigen Publikumsablehnung stolpert. Man hat offenbar ganz vergessen, daß die Werke der Genies nur aus einem fruchtbaren Boden wachsen können, der gedüngt wird von den Werken guter Handwerker; ohne lebendiges musikalisches Gebrauchstheater gibt es auch keine revolutionären Geniewerke. Wie eben auch ein Wagner, ein Verdi ohne die Kreutzers, Spontinis, Marschners, Ixirtzings, Bellinis und Donizettis nicht denkbar sind.
In der heutigen Situation eines beängstigenden Stillstands müssen sich der Subventionsgeber und der Subventiansempfänger endlich der Gewissensfrage stellen, ob sie an den lebendigen Fortbestand der Kunstgattung „Oper“ glauben oder nicht Glauben sie daran, dann haben sie die Pflicht, tätig zu werden
In der Praxis heißt das für uns hier in Wien: Von den jährlichen Subventionen für die Staatsoper ist 1 Prozent für die Schaffung neuer Opernwerke zu widmen. Das müßte in Form von genau präzisierten Aufträgen geschehen — von Aufträgen also, bei denen auch der Auftraggeber ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Dies natürlich nicht in dem Sinne, daß er nach der Auftragserteilung in die Arbeit der Autoren hineinredet; das gewichtige Wort, das er zu reden hat, müßte in dem Motiv der Auftragserteilung zum Ausdruck kommen. Und dieses Motiv kann nur der Glaube daran sein, daß die Kunstgattung Oper sinnvoll weiterentwickelt werden kann. Der Auftraggeber hätte also Komponisten zu suchen und zu finden, die sich nicht zu gering dafür sind, Werke für den Opernalltag zu schaffen — Werke also, die für Sänger und Musiker interessant sind, deren Einstudierung allen Mitwirkenden Freude macht Grundvoraussetzung für die Schaffung solcher Werke ist eine vom Auftraggeber zu fordernde Bereitschaft des beauftragten Komponisten zu einer Zusammenarbeit die auf die Theaterpraxis bezogen ist Das würde heißen, daß bei der endgültigen Auftragserteilung bereits der Dirigent, der Regisseur und zumindest die Sänger der Hauptpartien feststehen und daß — daraus resultierend — Autoren und Interpreten schon während der schöpferischen Arbeit jenen Kontakt miteinander haben, der für eine optimale Bühnenrealisierung des in Auftrag gegebenen Projektes notwendig ist
Bei einer Widmung von nur einem Prozent der Staatsopernsubventionen könnten jährlich leicht drei Autorerateams an solchen Aufträgen arbeiten. Und kämen dabei in einem Zeitraum von meinetwegen vier Jahren auch nur ein bis zwei repertoirefähige neue Opern zustande, so wäre das Geld hiefür weit sinnvoller angewandt als zum Beispiel jene Summen, dSe laufend für nicht erfüllte Dirigenten-, Regisseur- und Sängerverträge ausgegeben werden. Käme aber auf diese Art keine repertoirefähige Oper zustande, dann könnte man ruhigen Gewissens sagen, daß die Kunstgattung Oper offenbar wirklich am Ende ist. Aus dieser Erfahrung wären dann die Konsequenzen zu ziehen.
Es besteht aUerdings auch die Möglichkeit, daß der Subventionsgeber und der Subventionsempfänger schon heute nicht mehr an die Oper glauben. Dann wären die Konsequenzen schon jetzt zu ziehen. Das heißt: Die Subventionsvergabe ist neu zu überdenken. Es ist zu fragen, ob dem Steuerzahler weiterhin und in einem stets steigenden Umfang die Erhaltung von Opernhäusern aufgebürdet werden kann, die keine geistigen Zentren mehr sind; in denen vielmehr nur noch eine Minderheit kulinarischen Genüssen frönen darf. Ganz hart gesprochen: Ist es vertretbar, daß der Steuerzahler dem Herrn Meier, der zum 73. Male das „Holde Aida“ hören möchte, 1000 Schilling oder mehr für diesen Genuß bezahlt? Nur lebendige Kultur muß subventioniert werden, Kultur also, in der der Kreislauf zwischen Tradition und Gegenwart nicht unterbrochen ist. Der Genuß aber muß bezahlt werden — und zwar von demjenigen, der genießt.
Betrachtet man also die Oper als toten Luxusgegenstand, dann wird man sich über kurz oder lang die Frage stellen müssen, ob man sich diesen Luxus überhaupt noch leisten kann.Man wird Verständnis dafür haben, daß ich abschließend pro domo spreche, wenn ich der Oberzeugung Ausdruck gebe, daß die Oper nicht tot, sondern schlimmstenfalls scheintot ist. Es ist aber höchste Zeit daß zur Rettung des Patienten ein Ärzteteam zusammentritt. Subventionsgeber, Subventionsempfänger und Komponisten müssen sich zu einem solchen Team vereinigen, ehe es au spät ist. Und es ist bald zu spät: In seinem jetzigen Zustand lebt der Patient Oper höchstens noch zwanzig Jahre. Dann wird die Schließung der Opernhäuser unvermeidlich sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!