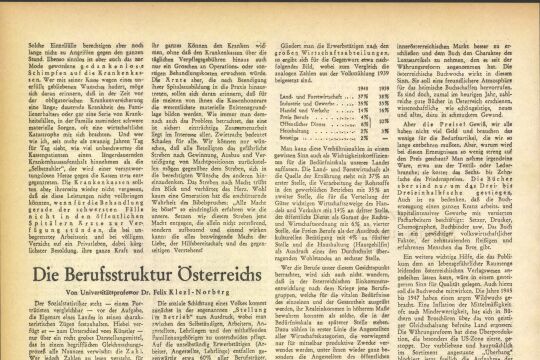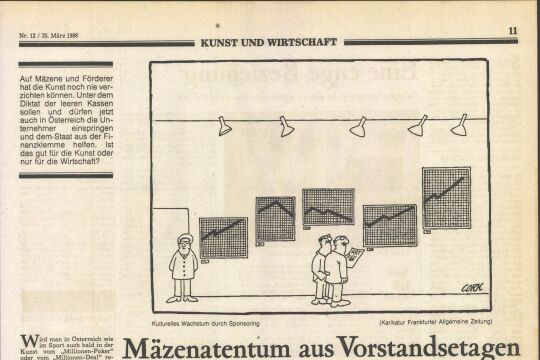Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schädlicher Pessimismus
„Was dies alles für die Zukunft der Künste bedeutet, sollte Kulturpolitikern langsam klarwerden. Nämlich die totale Unterwerfung der Kunst unter die Werbekriterien der Untechaltsamkeit, der Konsumierbarkeit, der Akzeptanz der Verkäuflichkeit.“
Sigrid Löffler, die kürzlich im „profü“ unter dem Titel „Schöne neue Werbewelt“ laut Vorschlagzeile solcherart „analysiert, was passiert, wenn sich die Kunst mit den Sponsoren ins Bett legt“, gibt damit nur die Stimmung wieder, die seit dem „Sponsorerlaß“ des Finanzministeriums vom 18. Mai 1987 in der österreichischen Kulturpublizistik dominiert.
Eine Stimmung, die typisch europäisch, wenn nicht sogar insofern typisch österreichisch ist, als es selbst in Europa kaum ein zweites Land geben dürfte, in dem man es — siehe die Staatsoper, wo der Besucher selbst mit im internationalen Vergleich hohen Kartenpreisen, bildlich gesprochen, nur die Ouvertüre bezahlt — derart selbstverständlich findet, daß für die Kosten der von wem immer gehegten kulturellen Ambitionen „ungeschauter“ die öffentliche Hand aufzukommen habe.
Nur in Österreich konnte daher die OECDweit großzügigste steuerliche Begünstigung des Kultursponsorings bloß Spott und Hohn ernten. Und, was im Interesse der guten Sache ungleich bedenklicher ist, nur in Österreich kann diese fiskalische Freigiebigkeit (denn immerhin übernimmt bis zum Inkrafttreten der großen Steuerreform der Staat bis zu 68,5 Prozent des Sponsoring-Auf wan-des) eben deshalb Gefahr laufen, ein Schlag ins Wasser zu werden, steht und fällt doch die Anerkennung solcher Aufwendungen als Betriebsausgaben mit dem Nachweis einer dem Aufwand angemessenen Werbewirkung, lies: einer genügend häufigen Erwähnung des Sponsors in der Berichterstattung über die gesponserte Veranstaltung, Kultureinrichtung und so weiter.
So schwer dies einer Kulturpublizistik, die hierzulande offensichtlich dem — vermeintlichen — Anspruch auf staatliches Mäzenatentum aus Steuergeldern einen ebensolchen Anspruch auf privates Mäzenatentum aus Firmengeldern an die Seite stellt, begreiflich zu machen sein mag: Kultursponsoring ist nur als eine Symbiose vorstellbar, aus der beide Beteiligte Nutzen ziehen — auch der Sponsor, denn könnte der Vorstand zum Beispiel von IBM nicht glaubwürdig dartun, daß der Werbe- oder wenigstens der Good-will-Effekt den Aufwand für die Übertragung des Neujahr skonzerts zumindest wettmacht, müßten (und würden) ihn die Aktionäre wegen Vernachlässigung der kaufmännischen Sorgfalt beim Umgang mit ihnen zustehendem Geld zum Teufel jagen.
So gesehen, trägt die mit dem Kultursponsoring erzielbare Steuerersparnis wesentlich dazu bei, daß der „break-even“-Punkt, von dem an der Erfolg den Aufwand lohnt, früher, ja, daß er überhaupt erreicht wird, denn natürlich entscheidet sich nicht einmal der Käufer eines PC, geschweige denn der Besteller einer Groß-EDV-Anlage deshalb just für einen bestimmten Anbieter, weil dieser sein Herz für Kultur entdeckt hat.
PS: Anderswo hätte sich dieser Artikel erübrigt. Insbesondere in den USA, wo man das Subsi-diaritätsprinzip nicht predigt, sondern praktisch anwendet. Und wo an die Nennung des Sponsors selbst der ärgste Kulturschmock keine Zeüe der Kritik verschwenden würde, da doch dort die Namen von — wie wir heute sagen würden — Kultursponsoren mit den von ihnen geförderten Einrichtungen für alle Zukunft untrennbar verbunden sind: Guggenheim-Museum, Universität Yale, Carnegie Hall...
Der Autor ist Herausgeber der „Finanznachrichten“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!