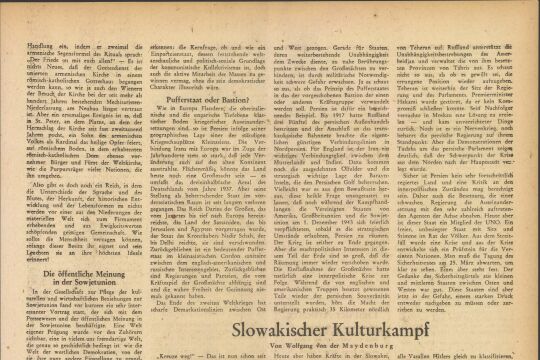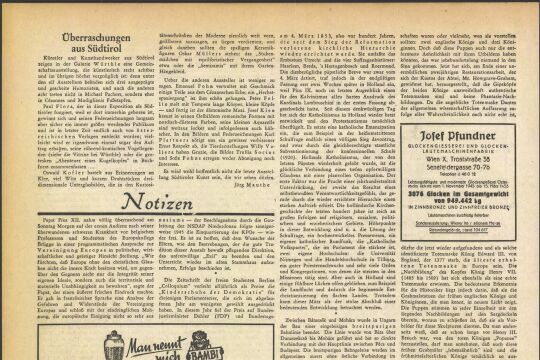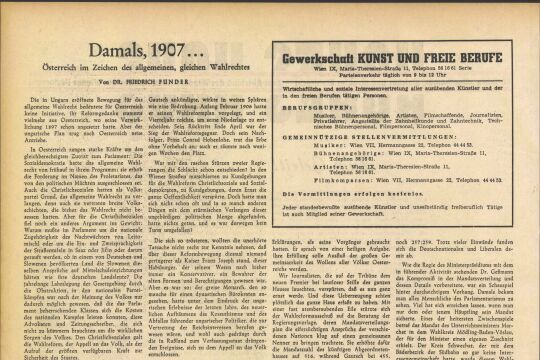Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Spannungen nach allen Richtungen
Natürlich kann man für den oberösterreichischen Bereich kaum von einem „Verhältnis Kirche-Staat” iprechen. Es bestand, krisenhaft und anfällig genug, zwischen der Kirche und der Republik Österreich. Landeskompetenzen vermögen selten eine Kluft zu öffnen.
Nimmt man aber die Beziehungen der führenden Politiker Oberösterreichs zu Diözesanbischof Gföllner unter die Lupe, so müssen nicht nur mancherlei Spannungen registriert werden; es gab Differenzen eigentlich zu allen politischen Richtungen, wenn auch gewiß in unterschiedlicher Intensität.
Johannes Maria Gföllner, der 1915 als 48jähriger Diözesanbischof von Linz wurde, hatte es allerdings auch schwer, das Schiff der ihm Anvertrauten durch drei Klippen, durch drei Zeitwenden, zu führen: durch die des Jahres 1918, die des Jahres 1934 und die des Jahres 1938. Und als er inmitten des Zweiten Weltkrieges, 1941, starb, durfte die gleichgeschaltete Linzer Presse über eine Dreizeilenmeldung nicht hinausgehen.
Durch ein reichliches Jahrzehnt herrschte ein „kalter Krieg” zwischen Gföllner und der Sozialdemokratischen Partei in Oberösterreich, dessen Ausmaße und Injurien man sich heute kaum vorstellen kann. Von sozialistischer Seite galten dabei die Angriffe keineswegs nur dem als Monarchisten bekannten Diözesanbischof; sie steigerten sich fast noch, als Gföllner im Bischöflichen Ordinariat ein eigenes „Soziales Sekretariat” errichtete, als er sich stark für die Katholische Arbeiterbewegung einsetzte und für deren Belange im Jahre 1926 sogar eine Kirchensammlung anordnete. In diesem Kulminationspunkt der Spannungen brachte das sozialdemokratische „Tagblatt” eine Karikatur des Diöze-sanbischofs, sprach vom „Vergelt’s- Gott-Proletarier” und ähnlichem.
Diese Differenzen verstärkten merkwürdigerweise auch die Spannungen zwischen Bischof Gföllner und Landeshauptmann Prälat Johann Nepomuk Hauser, die allerdings schon 1919 sichtbar gewesen waren, als der Bischof nach einer Plünderung des Linzer Bischofshofes durch Demonstranten, unter denen sich auch Volkswehrsoldaten befanden, ein verbittertes Schreiben an den Militärkommandanten von Oberösterreich richtete. Hauser, um ein Jahr älter als Gföllner, hatte eine weit steilere Karriere hinter sich als der Diözesanbischof: er war 1899 mit 33 Jahren Landtagsabgeordneter und mit 43 Jahren Landeshauptmann und Reichs ratsab- geordneter geworden, er war in den kritischen Jahren 1918 und 1919 Klubobmann und Reichsparteiobmann der Christlichsozialen, dazu Zweiter und Erster Präsident des Nationalrates. Auch die Tatsache, daß Hauser an der Ernennung des Bischofs nicht unbeteiligt war, hat die seit 1918 sichtbaren starken Spannungen zwischen beiden Priestern keinesfalls gemildert.
Jetzt, also im ersten Jahrzehnt der Republik, sah sich Gföllner fast pausenlos von sozialistischer Seite angegriffen, wurde aber nicht ungeschickt vom Organ des Katholischen Preßver- eins, dem „Linzer Volksblatt”, verteidigt. In der Landesregierung aber sah er den führenden Christlichsozialen, eben Landeshauptmann Hauser, im guten Einvernehmen mit den sozialdemokratischen Landespolitikem. Die Spannungen führten zur offiziellen Aufforderung des Bischofs an Hauser, nicht mehr zu kandidieren, eine Aufforderung, von der Gföllner allerdings wenige Tage später bat, sie als nicht geäußert zu betrachten. Unmittelbar vor dem Tode Hausers im Jahre 1927 war es zwar zu einer Versöhnung zwischen beiden gekommen; neue Spannungen mit der Christlichsozialen Partei wurden jedoch wenige Jahre später sichtbar, als Gföllner, zuständig für politische Fragen in der österreichischen Bischofskonferenz, es hier durchsetzte, daß in ganz Österreich Priester-Politiker aus dem öffentlichen Leben abgezogen wurden.
In Oberösterreich war der Anteil der Priester im politischen Bereich nach dem Tode Rudigiers, 1884, eher bescheiden; die wenigen hatten allerdings maßgebliche Positionen inne. So mußten in Oberösterreich am 15. Dezember 1933 die Landesräte Hirsch und Pfeneberger und Bundesrat Moser ihre Mandate, aber auch die übrigen Funktionen im Katholischen Volksverein niederlegen. In Oberösterreich hatte es seit Bischof Rudigiers Zeiten eine Sonderentwicklung gegenüber den meisten anderen Bundesländern gegeben: Der Katholische Volksverein hatte gleichzeitig die
Funktion einer Landesleitung der Christlichsozialen Partei inne. In schwersfer Stunde, im Februar 1934, fehlten der Landesregierung zwei Regierungsmitglieder der Christlichsozialen Partei, Parteiobmann und Klubobmann.
Längst hatte Bischof Gföllner mit einer Forderung nach mehr Autorität im Staate nicht zurückgehalten. Schon 1927 erschien sein Hirtenbrief „Uber die Autorität”, und über die Bundesführerin Fanny Starhemberg hatte er zweifellos gewisse Querverbindungen zur Heimwehr, auch wenn er im Februar 1934 ausdrücklich dementierte, vom Vorstoß der Heimwehr zur revolutionären Umgestaltung der Landesregierungen informiert gewesen zu sein. Vorher hatte die Fürstin Starhemberg allerdings vergeblich versucht, ihren Sohn, den späteren Heimwehrführer, zum Bundesführer des Reichsbundes der Katholischen Jugend Österreichs wählen zu lassen. Bischof Gföllners vermutliche Sympathien zur Heimwehr kühlten allerdings rasch ab, als die Heimwehr eigene Frauen- und Jugendorganisationen schuf.
Das politische Durcheinander, die Abwehrstellung der demokratisch eingestellten Christlichsozialen vęr- erst gegen die Heimwehr, später gegen andere autoritäre Bestrebungen, erkennt man deutlich 1930, als die Christlichsozialen, die alle Listenkopplungen (mit Großdeutschen, Heimatblock oder Landbund) strikt ablehnten und daraufhin ihr bestes Wahlergebnis der Zwischenkriegszeit erstritten, in ihrem Landtagsklub einstimmig die Nominierung der sehr angesehenen Fürstin Starhemberg als Bundesrätin, eine Funktion, die sie seit 1921 innehatte, ablehnten. Allerdings war das soziale Engagement der „Fürstin” sicher bedeutsamer als das politische, wie ja auch Gföllners Interesse am politischen Geschehen zweifellos größer war als sein diesbezüglicher Instinkt.
Dies wurde nicht nur Ende 1933 beim Abzug des Klerus aus der Politik deutlich, einer zweifellos richtigen Maßnahme, die aber zu einem wenig glücklichen Zeitpunkt und in einer menschlich wenig ansprechenden Form realisiert wurde. Daß sie überdies als eine gegen die Christlichsoziale Partei, indirekt auch gegen die Demokratie gerichtete Maßnahme gewertet wurde, dafür sorgte Gföllner selbst, als er genehmigte, daß den politischen Gremien des autoritären Staates nach 1934 neuerlich zwei Priester zur Verfügung gestellt wurden: Dr. phiL Franz Eiblhuber für den oberösterreichischen Landtag und Dr. theol. Franz Ohnmacht für den Bundeskulturrat. Man erkannte dies aber auch, als der Diözesanbischof Dr. Gföllner den langjährigen integren Präsidenten des Katholischen Volksvereins, Nationalrat Aigner, ebenfalls zum gefährlichsten Zeitpunkt, am 8. Jänner 1934, zum Rücktritt zwang. Das Gedächtnisprotokoll Dr. Aigners gehört zweifellos zu den tragischsten Dokumenten aus den Grenzbereichen von Kirche und Politik in Österreich.
Ganz anders als die oberösterreichische evangelische Führungsschicht, die ja für den gesamtösterreichischen Protestantismus sehr bedeutsam war und bei einem Blick nach Deutschland genug Warnungszeichen hätte sehen müssen, erkannte der katholische Diözesanbischof die Gefährdung durch den Nationalsozialismus völlig klar. Das dokumentiert insbesondere sein Hirtenbrief „Uber den wahren und falschen Nationalismus” aus dem Jahre 1933. Ein Satz dieses Hirtenbriefes hat Gföllner, sicher nicht ganz zu Recht, in der reichhaltigen Nachkriegs- literatur über den Antisemitismus zu einem Exponenten des innerkirchlichen Antisemitismus werden lassen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!