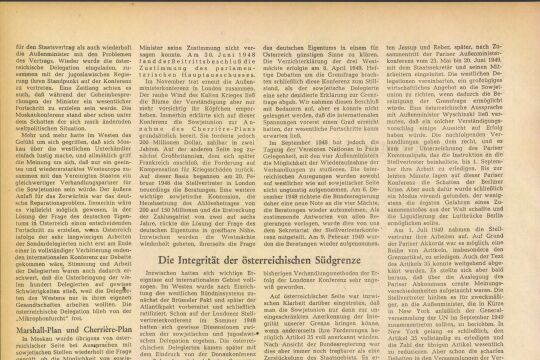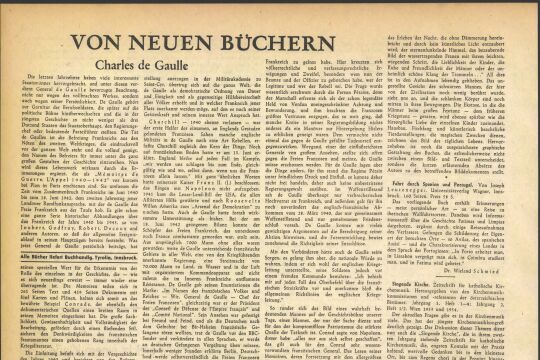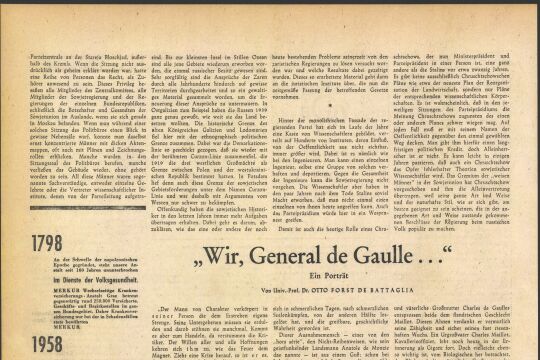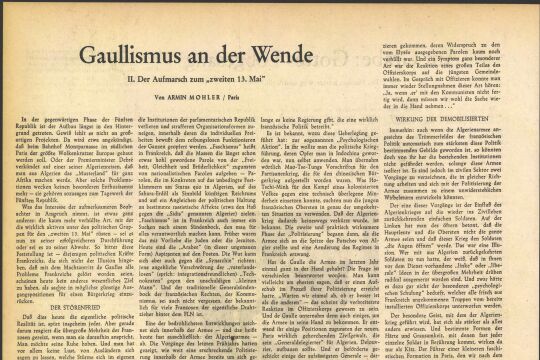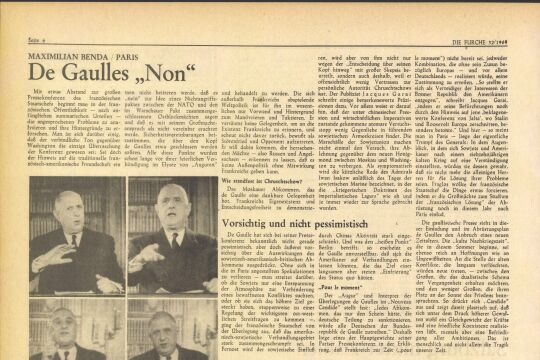Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Amerikaner und de Gaulle
Mit Ausnahme Fidel Castros hat seit dem Krieg kein auswärtiger Staatsmann eine so schlechte Presse in den Vereinigten Staaten wie gegenwärtig der französische Präsident. Eine latente Reizbarkeit gegenüber dem schwierigen General war schon immer vorhanden. Sie hatte ihren Ursprung im letzten Krieg, in dem er angelsächsische Überheblichkeit mit gallischem Hochmut zu übertrumpfen versuchte. Es ist allgemein bekannt, daß de Gaulles nicht immer ausgeprägte Bereitschaft zur Höflichkeit und sein Starrsinn es selbst dann schwierig machen, seinen Standpunkt zu würdigen, wenn dieser berechtigt ist.
Ausschlaggebend für die öffentliche Meinung der USA ist jedoch, daß de Gaulle sich gegen wichtige und grundlegende amerikanische Interessen stellt. Dem amerikanischen Goliath ist plötzlich ein David erwachsen. Aus diesen Gründen wäre es erstaunlich und ein Zeichen für mangelnde Vitalität, wenn keine Reaktion auf die Herausforderung erfolgt wäre.
Frankreich ist jedoch der älteste Verbündete der Vereinigten Staaten. Nur zweimal gab es tiefergehende Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Ländern, die beigelegt wurden, bevor sie sich zu schweren Konflikten ausweiteten: Das erste Mal, als die Heilige Allianz in Südamerika intervenieren wollte, das zweitemal, als Napoleon III. Maximilian in Mexiko auf den Thron hob. Mit Großbritannien dagegen wurde im 19. Jahrhundert ein Krieg geführt (1812/13), kam es 1848 wegen der Oregonfrage beinahe zu einem zweiten, und 1862 beinahe wieder zu einem Krieg, als die Engländer die südstaatliche Flotte ausrüsteten.
In der allerletzten Zeit unterstützte de Gaulle vorbehaltlos die Vereinigten Staaten in der Kubakrise, obwohl es diese unterlassen hatten, ihre Verbündeten zu konsultieren. Die Haltung Großbritanniens dagegen war zweideutig. Unter diesen Umständen ist die homerische Empörung, mit der die Zuchtmeister der öffentlichen Meinung, Presse, Rundfunk und Fernsehen, auf de Gaulle eindreschen, peinlich. Vor allem aber ist sie, wie Henry K i s s i n g e r, der in Deutschland geborene Havard-Professor, der einer der wichtigsten Berater der Regierung in bezug auf Fragen globaler Strategie ist, feststellte, ein erschreckendes Zeichen von Unreife.
Das Unvermögen, die verwickelten Motive eines eigenwilligen Verbündeten kühl zu analysieren, die bedenkenlose Zurückführung dieser Motive auf einen niedrigsten gemeinsamen Nenner, nämlich Großmannsucht, ist der Presse eines Landes, das den Westen führen will und muß, nicht würdig. Es enttäuscht auch, wenn sich die Regierung zwar zurückhält, aber sich nicht um ein ausgewogeneres Bild bemüht. Gerade, wenn man die besseren Argumente hat, kann man es sich leisten, großzügig zu sein. Man fragt sich, wieviel Gerechtigkeit man einem Gegner der Vereinigten Staaten angedeihen läßt, wenn man einen Verbündeten, der seine eigenen Wege gehen will, so schäbig behandelt.
Das große Risiko
Mit Recht verlangt die amerikanische Regierung, die über 97 Prozent der Atomwaffen des Westens verfügt, daß ihre Verbündeten sich hinter ihre strategische Konzeption stellen. Ihre verzweifelten Anstrengungen, eine weiter« Öffnung des Deckels der atomischen Pandora-Büchse zu verhindern, verdienen Anerkennung. Wo so viele Zufälle einen atomaren Krieg auslösen können, ist es jetzt schon ein Wunder, daß es bisher noch zu keinem gekommen ist. Je mehr Nationen eigene atomare Waffen haben, desto sicherer wird es, daß die Katastrophe unabwendbar wird. Solchen Befürchtung hält Henry K i s-singer entgegen, daß eine größere Streuung nuklearer Waffen ein stärkeres Detevent (Abschreckung) darstelle. Er argumentiert: Wenn die Sowjet« union damit rechnen müsse, daß Frank' reich Bomben über ihrem Gebiet abwerfen kann, müsse sie sich einen Angriff auf Europa besser überlegen. Anderseits sieht er die Gefahr, daß zukünftige amerikanische Regierungen zögern könnten, wegen Europa einen atomaren Krieg zu riskieren. Im Hinblick auf das riesige Risiko einer Ausbreitung der atomaren Bewaffnung scheint dieser Vorteil, der infolge Frankreichs beschränkter Möglichkeiten für den Abwurf einer Bombe gering ist, nicht schwer zu wiegen.
Jedoch rührt Kissinger an eine Schwäche der amerikanischen Position. Die Vereinigten Staaten haben bisher de Gaulles Zweifel an dem absoluten Wert von Bündnissen nicht nur nicht entkräftet, sondern ihnen sogar noch Auftrieb gegeben. Englands brüske Behandlung in der Skybolt-Frage, die gegenwärtigen zumindest wahrscheinlichen Verhandlungen zwischen Washington und Moskau, ohne Informierung der Verbündeten, das einseitige Vorgehen gegen Kuba und, last but not laest, die nur zu gut bekannte Tatsache, daß ein amerikanischer Präsident seine Nachfolger nicht binden kann, berechtigen de Gaulle, an das Wort „Vestigia terrent“ zu denken.
Aber — ist der Aufbau einer französischen Force de Frappe mit ihrer Illusion einer unwiderruflich verlorenen Großmachtstellung eine Abhilfe? Bestünde nicht die wirksamste Abhilfe darin, die Vereinigten Staaten möglichst eng an Europa zu binden? Beschwört dagegen nicht die Eigenwilligkeit der Verbündeten gerade die Gefahr einer amerikanischen Abkehr von Europa herauf? iJBfltBlh »n
Der Gemeinsame Markt triicno? j3?ntf)i£wiir: tsd soj
Das bringt uns zum Gemeinsamen
Markt. Die rückhaltlose Unterstützung Großbritanniens gegenüber dem Markt durch die Vereinigten Staaten beweist, daß diese nicht an einem auf Kontinentaleuropa beschränkten Block interessiert sind. Ein solcher Block könnte niemals die Stärke entwickeln, um mit den drei Giganten — es wäre unrealistisch, zu glauben, daß China nicht schließlich dazu kommen wird — zu konkurrieren. Infolgedessen würde er, wie einst der Balkan, ein Zankapfel zwischen ihnen werden. Europäer, die das nicht einsehen, sind noch immer hinter Konstantin Frantz zurück, der das bereits 1864 voraussagte.
Weiterdenkenden Europäern sollte daher das amerikanische Konzept einer atlantischen Gemeinschaft, die schließlich den Gemeinsamen Markt und die Vereinigten Staaten überdacht, mehr zusagen als de Gaulles Konzeption, die sich „an nationalstaatlichen und hege-monialen Vorstellungen des 19. Jahrhundert“ orientiert, wie neulich „Die Zeit“ schrieb. Außerdem würden wohl die wenigsten Europäer vorziehen, die amerikanische Hegemonie für eine französische zu vertauschen.
Englands Beitritt zum Gemeinsamen Markt ist die conditio sine qua non für die atlantische Gemeinschaft. Daher ist es verständlich, daß die Vereinigten Staaten darauf drängen. Aber machen sie nicht den bei ihnen so häufigen Fehler, daß sie nicht in langen Zeiträumen denken und zu ungeduldig sind, eine Situation ausreifen zu lassen? Die Europäer haben gewichtige kurzfristige Einwendungen gegen Englands Beitritt, und das amerikanische Dränjen ist daher in diesem Moment, auf lange Sicht gesehen, ebenso unangebracht wie de Gaulles Widerstand.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!