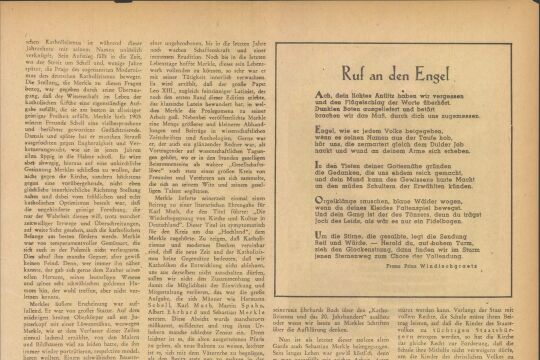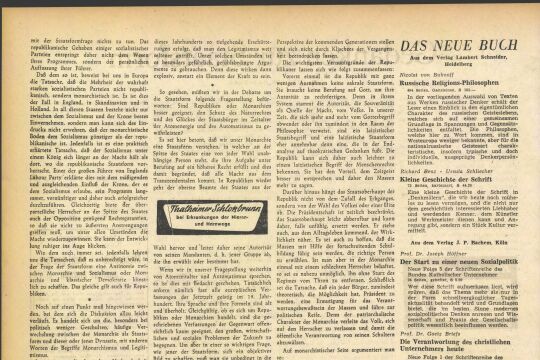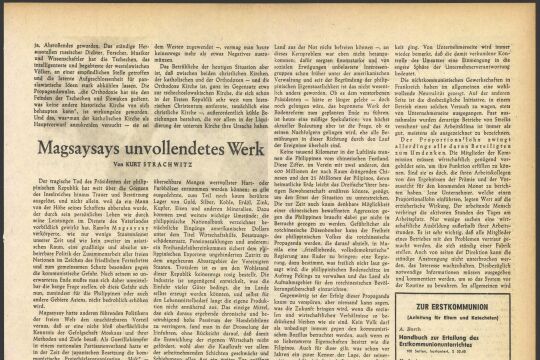Die Entbindung von leidigen Pflichten befreit den Menschen, bürdet ihm aber auch eine neue Qualität von Verantwortung auf: Wer nicht muss, sollte wollen - im Sinne der Gesellschaft.
Die Beschäftigung mit den Rechten und Pflichten des Staatsbürgers führt fast zwingend zu einem der bekanntesten politischen Zitate des 20. Jahrhunderts: "Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann“, sprach John F. Kennedy, 35. Präsident der USA, am 20. Jänner 1961 den Amerikanern ins Gewissen. "Fragt, was ihr für euer Land tun könnt“, lautete die Aufforderung am Ende seiner Rede zur Amtseinführung, in deren Folge er nicht nur seine Landsleute, sondern "alle Bürger der Welt“ dazu aufforderte, sich gemeinsam "für die Freiheit des Menschen“ einzusetzen.
Als Symbol für diesen Pflichtgedanken darf "Uncle Sam“ angeführt werden. Sein auffordernder Fingerzeig ist auch für Menschen außerhalb der United States (deren Initialen "U. S.“ sich mit jenen dieser Kunstfigur decken) ohne große Überlegung deutbar. Unterstützt durch die in Großbuchstaben gesetzte Botschaft "I want you“, also "Ich will/brauche dich“, wurde der mindestens seit dem Britisch-Amerikanischen Krieg ab1812 in Erscheinung tretende blau-weiß-rote Zylinder-Träger Sam etwa zur Rekrutierung von Soldaten eingesetzt.
Die "Schuld“ des Individuums
Weitab des amerikanischen Kontinents und seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten in das Friedensprojekt der Europäischen Union eingebettet, schwelt hierzulande (nicht zum ersten Mal) eine heiße Diskussion über die Zukunft der Wehrpflicht, ja über Freiwilligkeit und Pflicht per se. Und damit über den mündigen Bürger und die Zulässigkeit bestimmter Ansprüche des formalen gegenüber dem lebenden Staat; einer "Schuld“ des Individuums gegenüber der Gesellschaft.
Dabei entzündet sich die Debatte weniger an der Frage, ob unser Land die Pflicht zur Waffe für männliche Staatsbürger beibehalten wird - dagegen steht eine gegenläufige, wenngleich noch nicht verifizierte Tendenz der Volksmehrheit -, sondern am damit verbundenen Ausfall tatkräftiger Hilfskräfte im Gesundheits- und Sozialbereich: der Zivildiener.
Auf deren drohenden Ausfall wird von den Trägerorganisationen mit Sorge hingewiesen; dass Zivis eine wichtige "Säule des Sozialsystems“ seien, brachte etwa das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) ein. Präsident Fredy Mayer verlangte von den politischen Akteuren "praktikable Alternativen“ zur Sicherung ihrer Aufgaben.
Nach Paragraf acht des Zivildienstgesetzes ist bei der Zuweisung zu einer Dienststelle zu beachten, dass "bestehende Arbeitsplätze“ nicht "gefährdet werden“. Damit soll laut der im Innenministerium angesiedelten Zivildienstserviceagentur vorgebeugt werden, dass Planstellen für hauptberufliche Mitarbeiter mit Zivis besetzt werden.
Das ÖRK meint dazu, dass das heutige System mit den aktuell rund 4000 ÖRK-Zivildienern (von bundesweit 13.100) pro Jahr seit der Einführung des Wehrersatzdienstes 1975 "gewachsen“ ist. Hauptberufliche Lebensretter würden durch sie keineswegs eingespart. Demnach bräuchte man auch nicht zu fürchten, dass Menschen nach einem Beinbruch stundenlang auf einen Krankentransport warten. Aber verschiedene, über die Erstversorgung hinausgehende Dienste würden einfach nicht mehr erfüllt werden, wie Wolfgang Kopetzky, Generalsekretär des ÖRK, ausführt.
Was der Staat darf, muss und soll
Das von Sozialminister Rudolf Hundstorfer ins Gespräch gebrachte Modell eines Sozialen Jahres mit einer Entlohnung von 1300 Euro pro Monat - die ursprüngliche Charakterisierung als "freiwilliges“ Jahr wird, wie Kopetzky nach einem runden Tisch der Zivildienst-Trägerorganisationen im Ministerium bestätig, nicht mehr verwendet - könnte er sich als praktikabel vorstellen, wenngleich fraglich sei, ob sich entsprechend viele Menschen dafür finden lassen.
Zwar habe Hundstorfer signalisiert, dass die Organisationen sich ihre Helferinnen und Helfer auf Zeit nach geeigneten Maßstäben selbst aussuchen könnten. Jedoch bleibe die "fehlende Planbarkeit“ ein Problem; immerhin war bisher für jeden Jahrgang zumindest die Zahl der Stellungspflichtigen lange vor deren Einsatzpflicht zu haben. Bei all den praktischen Aspekten, die einen Wegfall der Wehrpflicht gründlich zu planen verlangen, bleibt die eingangs behandelte Frage stehen: Wie "frei“ ist der Einzelne - was darf Vater Staat seinen Kindern abverlangen?
Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, aber philosophische Konzepte. So behandelt Marie-Luisa Frick, Universitätsassistentin am Institut für Philosophie der Uni Innsbruck, die Bürgerpflichten zuerst auf Basis zweier Staatslehren. Während sich das liberale Modell zwar auf die Sicherung grundlegender Rechte - Leben, Freiheit, Eigentum - beschränkt, könnte ein liberaler Denker gerade auch damit eine Verpflichtung zum Sozialen Dienst argumentieren. "Wenn man an den Pflegenotstand und andere Probleme aufgrund der gesellschaftlichen Überalterung denkt, könnte so eine außerordentliche Maßnahme nötig sein“, sagt Frick.
Sozialistisches Denken vertritt die Idee, dass vom Staat mehr zu erwarten ist: "Dass er gerechte Zustände herstellt, das Gemeinwohl garantiert und sein Handeln am Wohl des Menschen ausrichtet“ - einen besseren Menschen schafft. Ein Pflichtdienst würde den Einzelnen reifen lassen und das Gemeinwohl stützen, zeichnet Frick mögliche Überlegungen nach.
Weit auszuholen ist, wenn der "freie Wille“ an sich betrachtet wird, dessen Existenz auch in den modernen Neurowissenschaften umstritten ist. Aristoteles beschrieb vor über 2300 Jahren die Freiwilligkeit als Handeln, dessen Ursache im Handelnden selbst liegt und dessen Umstände bekannt sind. Dem deutschen Denker Immanuel Kant (1724-1804) reichte das nicht: Schon allein das Agieren nach persönlich unumstrittenen ethisch-moralischen Übereinkünften der Gesellschaft sei nicht mehr freiwillig, erklärt Frick.
Eine "Selbstunterwerfung“ kam für Kant nur infrage, "wenn es sich um ein moralisches Gesetz handelt, das man sich selbst gibt“. Es gelte, eigene Schwächen zu überwinden. Es zählt der Kategorische Imperativ: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Wohltätigkeit, die auch nur ein inneres Vergnügen bereitet, weil man anderen hilft, geschieht nicht mehr aus rationalen Gründen. Damit lässt sich natürlich schwer in der praktischen Freiwilligenarbeit argumentieren.
Fürsorge als natürlicher Impuls
Frick verweist dazu auf die 1929 geborene Amerikanerin Nel Noddings, die eine Ethik der Fürsorge ("Caring“) vertritt. Nodding sagt, dass man moralisch auf der Gefühlsebene angesprochen wird: Es regt sich ein natürlicher Instinkt - ein Impuls -, etwas zu tun, zu helfen. Der Impuls lässt sich zurückweisen in der Annahme, dass sich andere Menschen, Institutionen (oder der Wohlfahrtsstaat) um ein Problemfeld kümmern: Ein Ergebnis der allgemeinen Entfremdung der Menschen. "Caring“ bedeutet also, sich um andere zu sorgen, sich ihnen zu widmen - Beziehungen zu anderen zu haben und erhalten zu wollen.
So wie die Bürger heute in Erwerbs- und Familienarbeit eingebunden sind, bleibe kaum Zeit für Engagement im Sinne Noddings, so Frick. Entsprechend ließe sich eine Sozialdienst-Pflicht argumentieren, indem man sage, "da hat man einmal im Leben einen Rahmen, um das zu tun“. Es gebe weniger ethische als juristische Vorbehalte.
Letztere führen zurück zur laufenden Diskussion. Joseph Marko vom Institut für Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre der Uni Graz, stimmt weitgehend mit Verfassungsjuristen überein, die einen Pflichtdienst als "Zwangsarbeit“ und Verstoß gegen die Menschenrechte werten. Er verweist aber auch auf Kuriositäten wie "Hand- und Spanndienste“, die noch heute in Gemeindeordnungen zu finden sind. Diese Pflichten an der Allgemeinheit hieß man früher auch Frondienst.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!