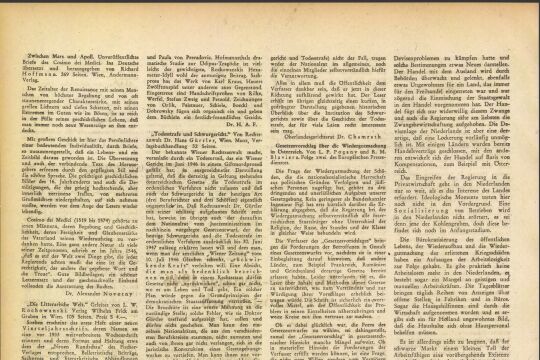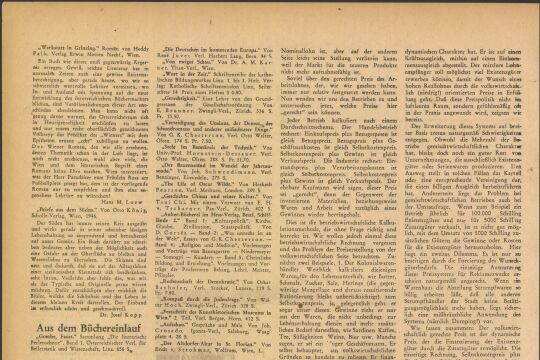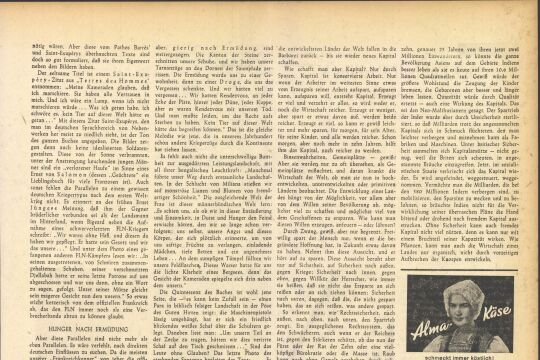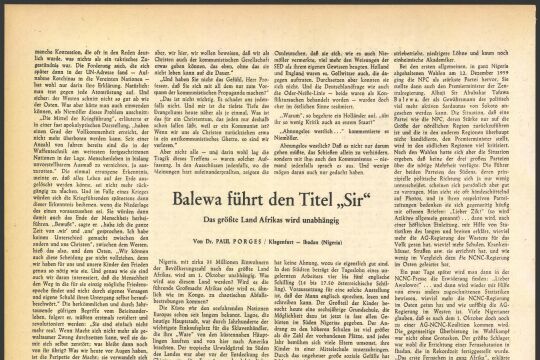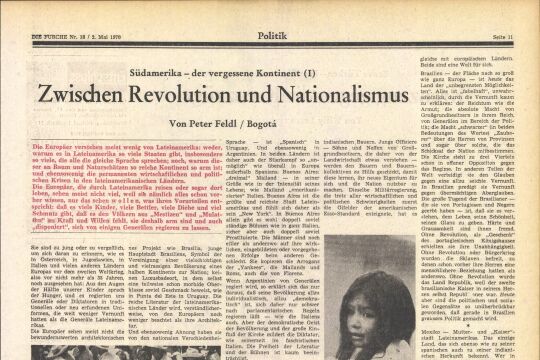Sklaven gibt es, weil andere von ihrer Ausbeutung und Entmenschlichung profitieren. Das klingt banal, aber die Geschichte hat einen moralischen Widerhaken: Die Profiteure sind wir selbst.
Es hat schon etwas Erhebendes, sich als guter, nachhaltig denkender Mensch zu empfinden. Im Supermarkt beispielsweise: Bewusst greift da der Käufer zu sattroten Bio-Tomaten aus Südeuropa. Er darf sich jetzt im moralischen und ökonomischen Sinne für einen "guten“ Kunden halten. Zum einen wegen seiner gelebten "Biozität“. Zum anderen, weil der Preis der Paradeiser kaum höher ist als jener "industrieller“ Tomaten. Warum das so ist, danach fragt der Konsument zunächst nicht. Wenn doch, so wird er sich erklären, dass immer mehr Kunden auf Bio umsteigen und die Bauern nun mehr und billiger produzieren können. Das ist eine schöne These, die den Kunden noch zufriedener macht. Allein - sie ist falsch. Bei Almeria in Südspanien könnte der Konsument eine realistische Erklärung für den Preis finden. Dort, mehr als tausend Kilometer entfernt, paart sich das Vorteilsdenken des österreichischen Kunden mit menschlichem Elend und ein paar ehernen Gesetzen der Ökonomie, die diesfalls Menschen zu Arbeitstieren degradieren.
Die Sklaven von El Ejido
Die Gegend um El Ejido bei Almeria am Abfall der Sierra de Gador wird von den Spaniern "Plastikland“ genannt. 90.000 Afrikaner, Bulgaren, Rumänen und Polen arbeiten dort auf mit Kunststoffplanen überzogenen Plantagen, die eine Fläche von 350 Quadratkilometern bedecken. Papiere haben die Arbeiter keine, sie wohnen in Hütten aus Bauabfall - wie man sie sonst nur von Slums kennt. Dem entsprechen auch die hygienischen Bedingungen. Es gibt hier keine Toiletten, Schmutzwasser muss zum Kochen und Trinken verwendet werden. Eine ärztliche Versorgung gibt es auch nicht. "Das ist moderne Sklaverei“, protestieren Menschenrechtsorganisationen wie "FIAN“ oder "German Watch“. Die Bauern von El Ejido kümmert das nicht. Sie argumentieren mit dem Druck globaler Märkte und dem Kunden, der es billiger und billiger will.
Der Stundenlohn auf den Plantagen beträgt 2,50 Euro. Gearbeitet wird täglich bis zu 16 Stunden bei Temperaturen jenseits der 40 Grad unter den Plastikplanen. Alle Beteiligten, Arbeiter, Bauer, Marktbetreiber und Kunde gehorchen, fragt man Ökonomen, dem Gesetz des "negativen Nachfrageverlaufs“: Je niedriger der Preis desto höher der Absatz und umgekehrt. Je niedriger der Lohn, umso konkurrenzfähiger. Wenn marokkanisches Biogemüse billiger ist, wird sich der Markt vom spanischen Gemüse abwenden - ein "Substitutionseffekt“. Die spanische Ware ist teurer und wird ersetzt. Dann werden in Spanien tonnenweise Lebensmittel zu Abfall. In den Sekunden ihrer Kaufentscheidung vernichten Europas Kunden, ohne es zu wissen, und wie von unsichtbarer Hand ganze Wagenladungen von Gurken, Auberginen und Salaten - täglich und ganz ohne EHEC. Die Konsequenzen für El Ejido sind klar: Die Preise müssen weiter sinken - die Löhne auch. In Italien haben chinesische Tomaten das schon vor fünf Jahren bewirkt. Die um bis zu 50 Prozent billigere Importware aus Fernost hätte die regionalen Produzenten vom Markt gefegt. Nun arbeiten Ukrainer, afrikanische Flüchtlinge, Polen und Bulgaren auf den Feldern.
Unter Mafia-Kuratel
Nach übereinstimmenden Polizeiberichten werden den Arbeitern Pässe und Ausweise abgenommen, sie werden in Lager gepfercht und von Aufsehern der ’Ndrangheta bewacht. Die Arbeitszeit beginnt um fünf Uhr früh und endet spät nachts. Wer flieht, wird verprügelt. So zieht das Sklavenheer jedes Jahr durchs Land - von den Mandarinenplantagen Rosarnos in Kalabrien zu den Erdbeerfeldern bei Cerignola in Apulien und zur Gemüseernte Richtung Poebene.
Bei einem Aufstand afrikanischer Arbeiter in Rosarno Anfang 2010 schritt die Polizei ein: 34 Arbeiter wurden zum Teil schwer verletzt.
Die europäischen Verhältnisse lassen sich ohne Weiteres in verschärfter Form auf die Welt übertragen. 12 bis 27 Millionen Menschen, so sagt die Arbeitsorganisation ILO, arbeiten weltweit in sklavereiähnlichen Umständen. US-Statistiker haben daraus ein Verhältnis errechnet: Von je eintausend Bewohner der Erde sind 1,8 Sklaven. In Asien und Afrika ist diese Rate doppelt so hoch. Besonders gefährdet sind Frauen und Kinder, heißt es im 2010 erschienenen Report der US-Regierung zu Kidnapping, Menschenhandel und Prostitution. 104 Staaten der Welt haben keine hinreichenden Vorschriften, um Menschenhandel vorzubeugen und die möglichen Opfer zu schützen. Mehr als 15 Prozent aller afrikanischen Jugendlichen sind schwerer oder gefährlicher Arbeit ausgesetzt. Die Zahl der Kinder zwischen 15 und 17 Jahren, die unter verbotenen Bedingungen zur Arbeit gezwungen sind, stieg zwischen 2004 und 2008 von 51 auf 62 Millionen.
Zyniker könnten sagen, das sei schon ein Fortschritt im Vergleich zu jenen drei Jahrhunderten, als Europa durch Sklavenhandel reich wurde - als rund 60 bis 100 Millionen Afrikaner Opfer des Menschenhandels wurden. Eine Zeit, in der etwa portugiesische Kaufleute stolz auf "10.000 Tonnen Neger“ verwiesen, die sie an Europas Adelshäuser geliefert hätten. Eine Zeit, in der der Sklavenhändler John Hawkins zum angesehendsten und reichsten Kaufmann Englands wurde. Eine Zeit in der ein paar rostige Musketen, abgetragene Kleider, Alkohol und Glasschmuck für Menschen getauscht wurden.
Der Kreis schließt sich
Tatsächlich haben sich die Verhältnisse geändert. Heute werden die Tomaten der kalabrischen Plantagen in Afrikas Häfen gelöscht. Die EU hilft dabei. Weil zu viel für den europäischen Markt da ist, exportiert Italien sein Tomatenmark - beispielsweise nach Ghana. Nicht dass Ghana keine Tomaten gehabt hätte. Seit Generationen gibt es dort Tomatenanbau. Aber die italienischen Tomaten, die von so weit her kommen, sind billiger. In den 1990er Jahren senkte Ghanas Regierung auf Druck des IWF die Importzölle. Seither hat sich die Tomateneinfuhr verachtfacht, von 3.000 auf 24.000 Tonnen. Die Preise fielen wegen des Überangebots um die Hälfte. Die Tomatenbauern von Nordghana können nun ihre Ware nicht mehr kostendeckend auf den Märkten verkaufen. Zwei von drei Tomatenfabriken Ghanas mussten schließen. Ab hier beginnt sich der Kreis zu schließen. Bauern, die sich mit der Landwirtschaft nicht mehr über Wasser halten können, ziehen in die Stadt - und von dort zieht es die jungen Männer und Frauen nach Europa, wo man, wie es heißt, viel Geld verdienen kann - auf den Tomatenfeldern Europas.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!