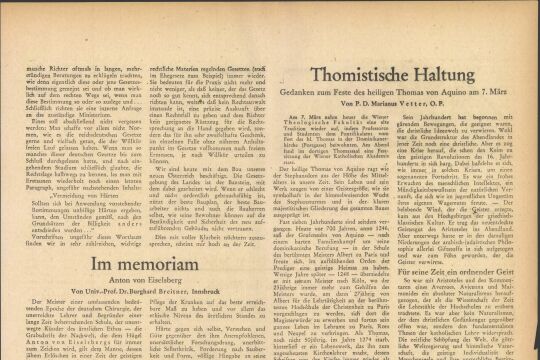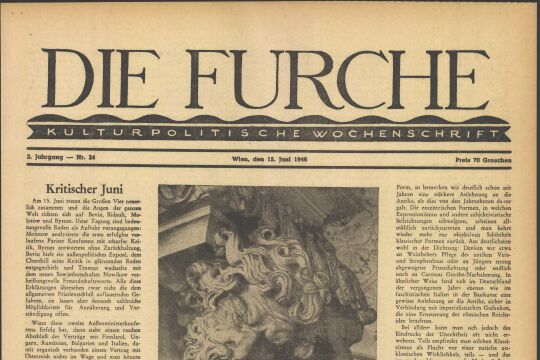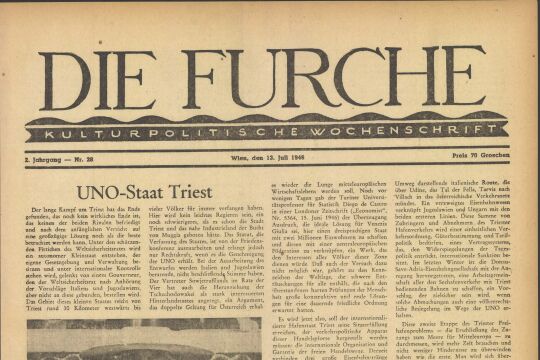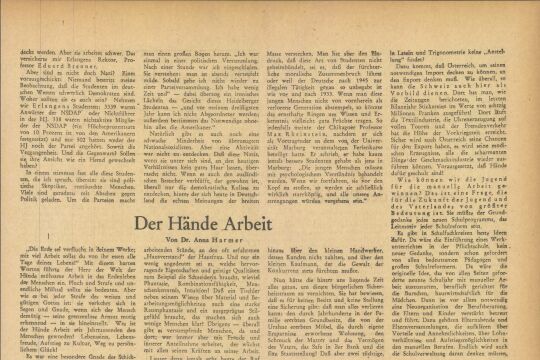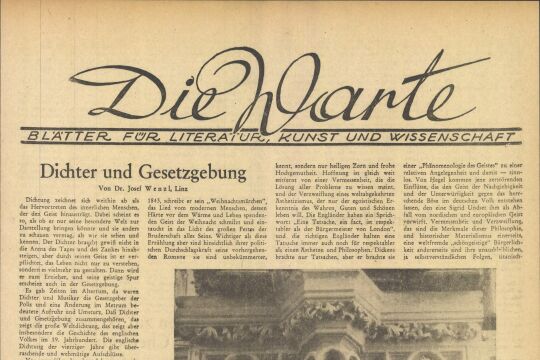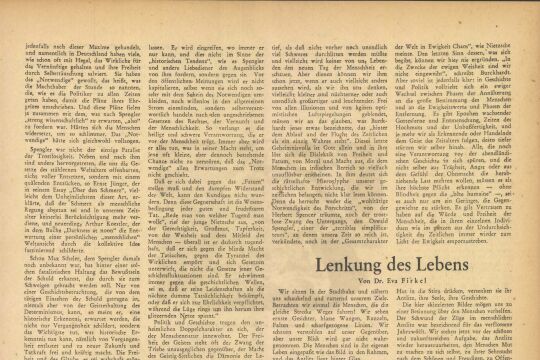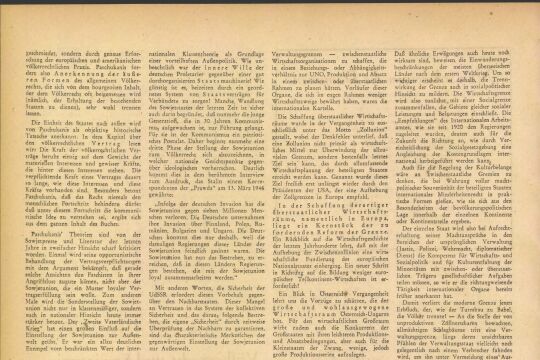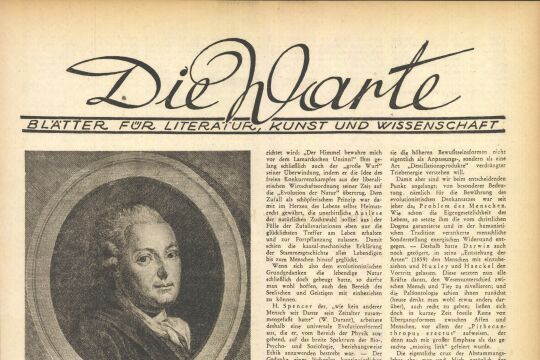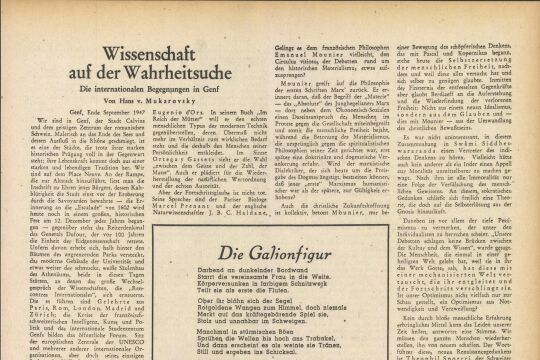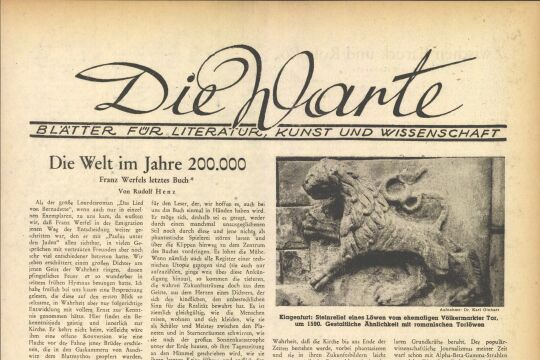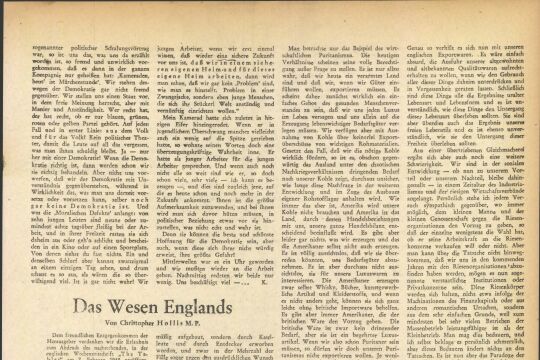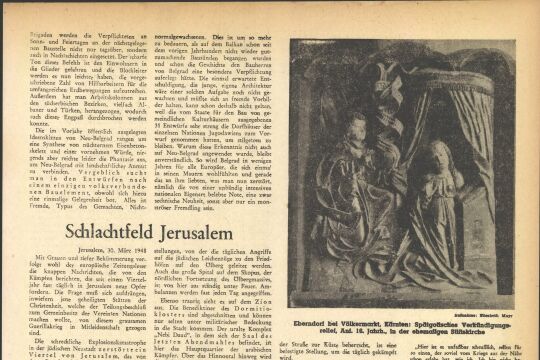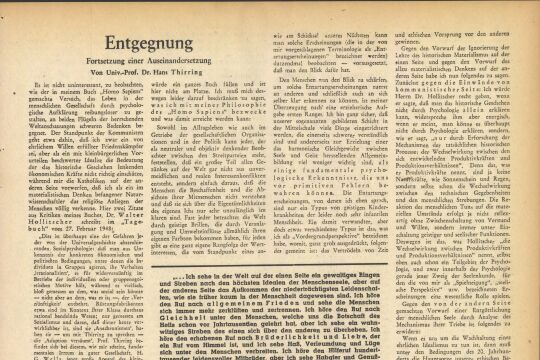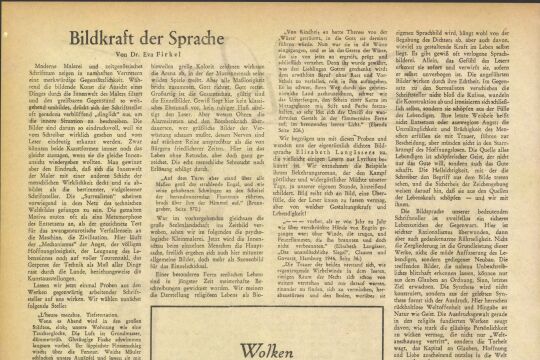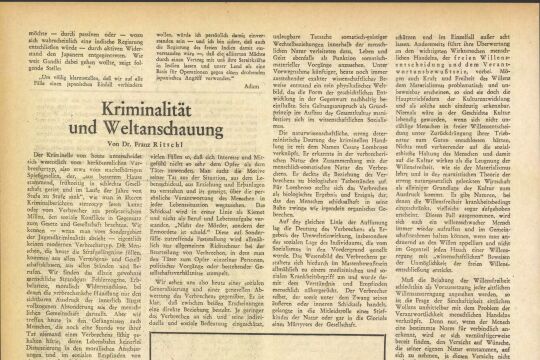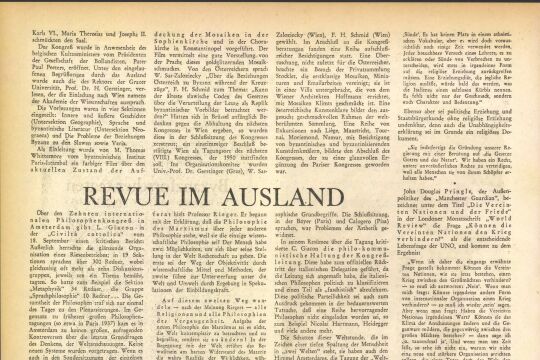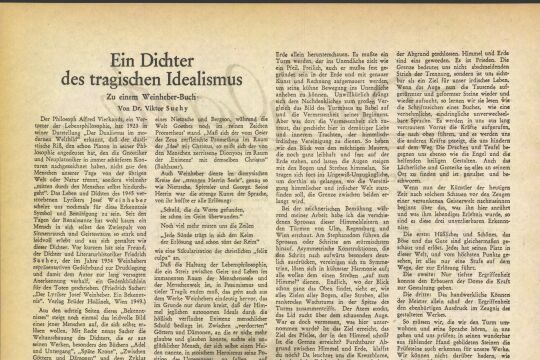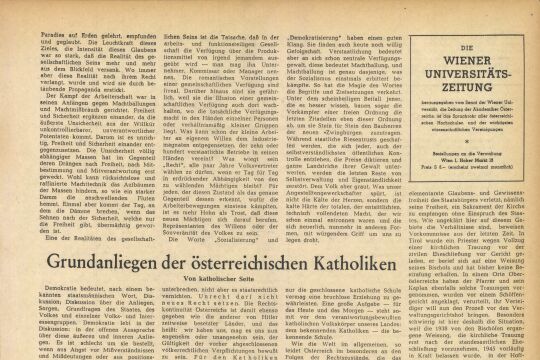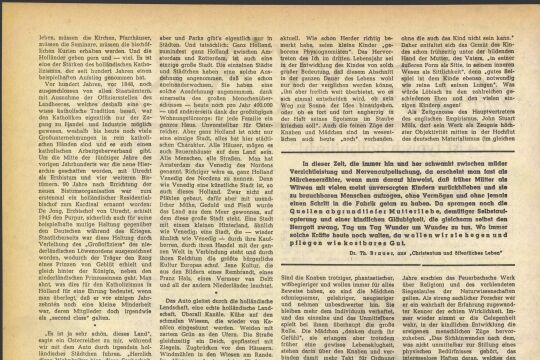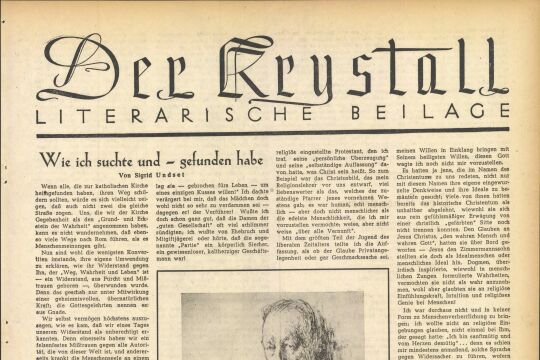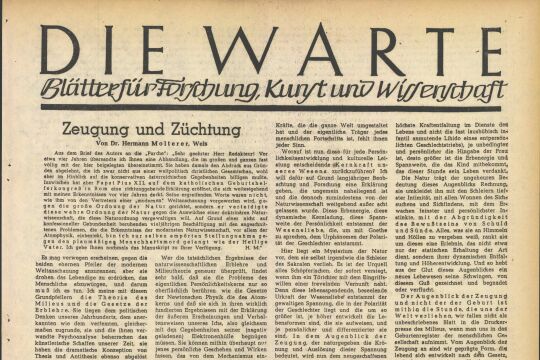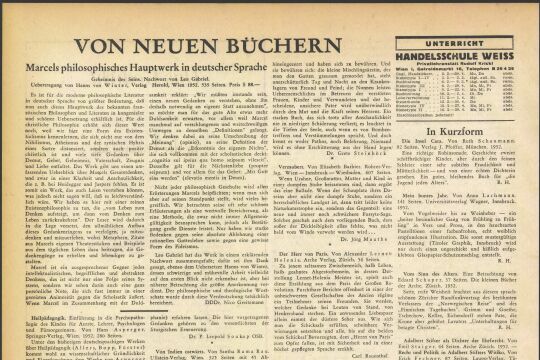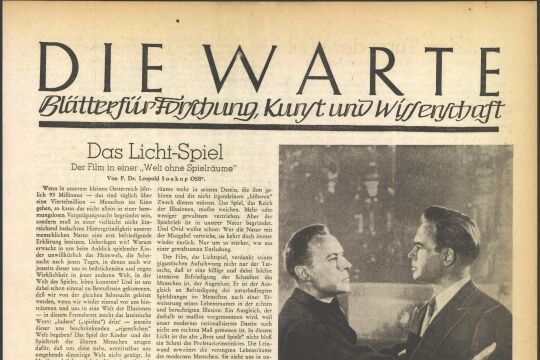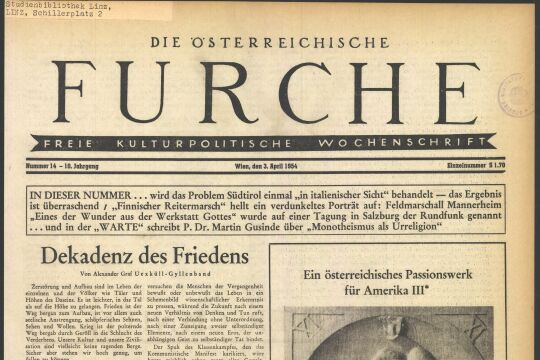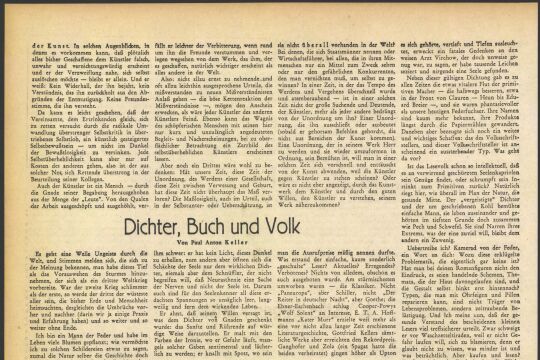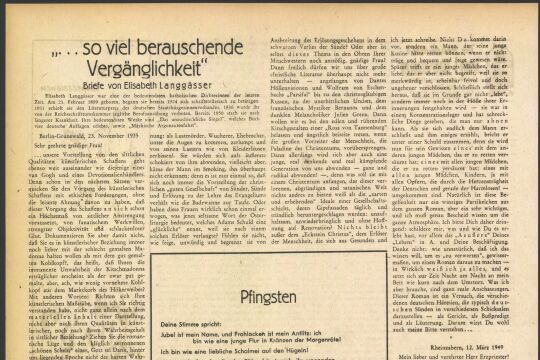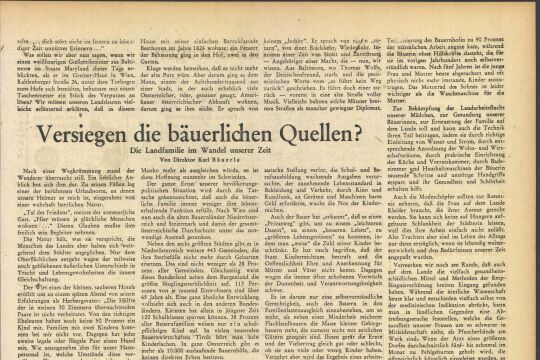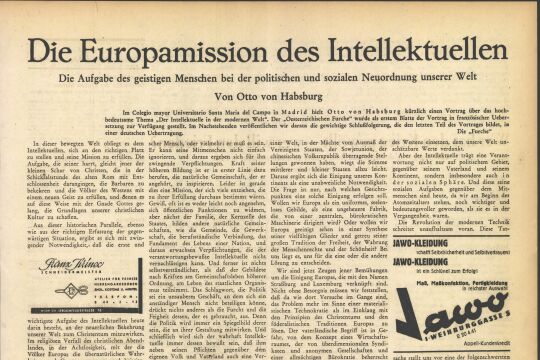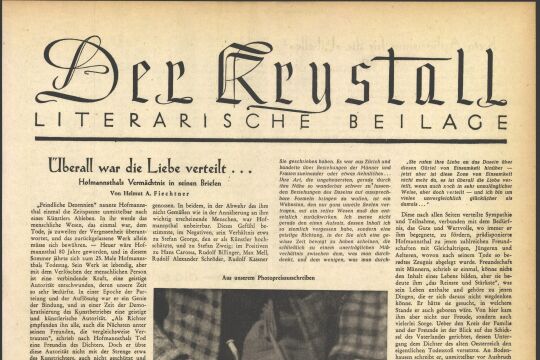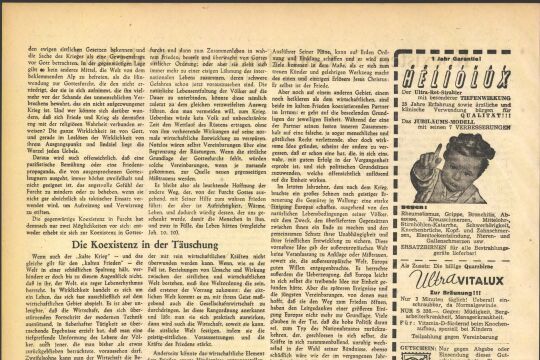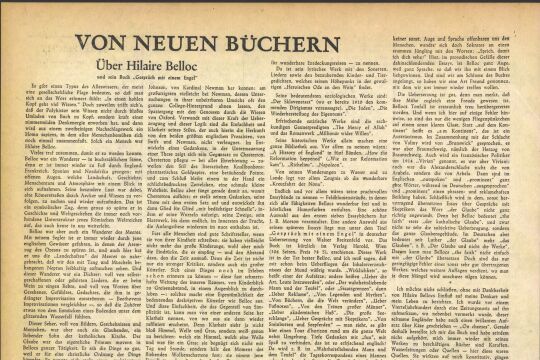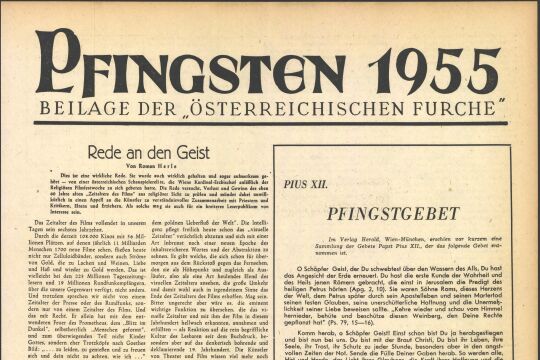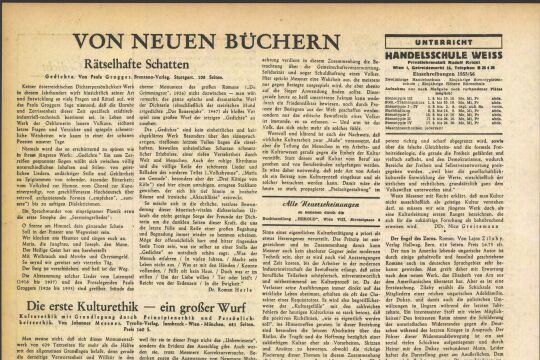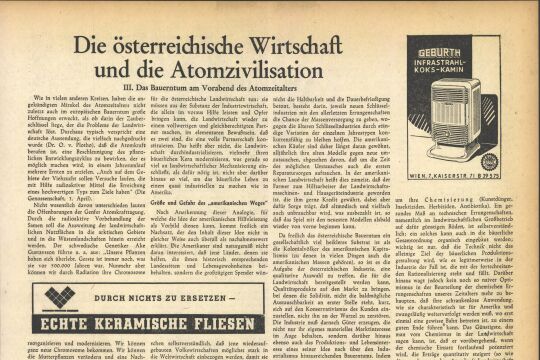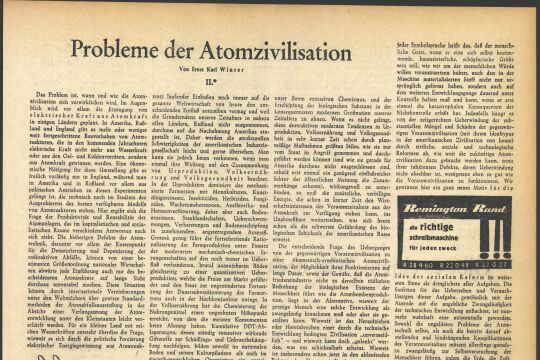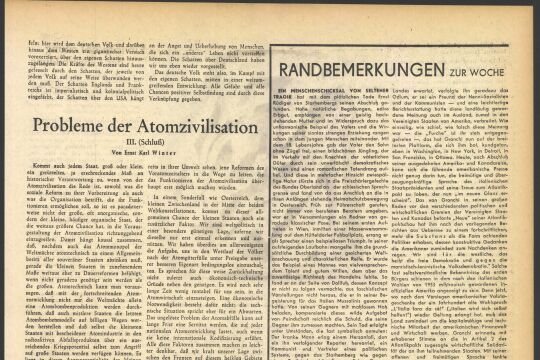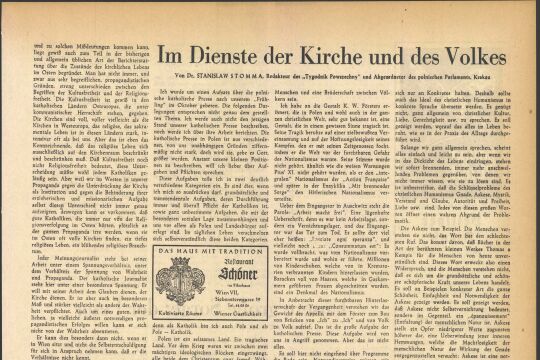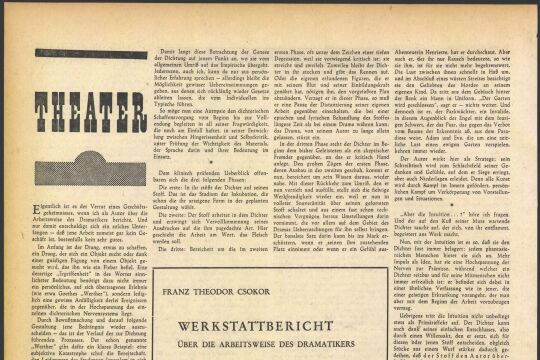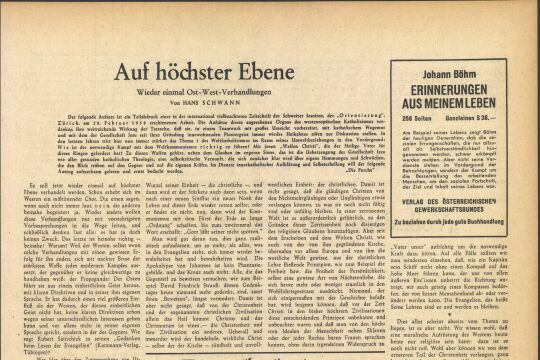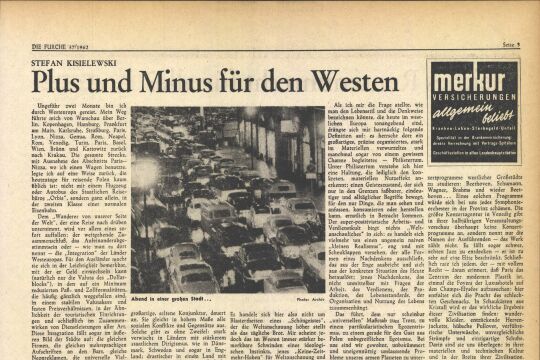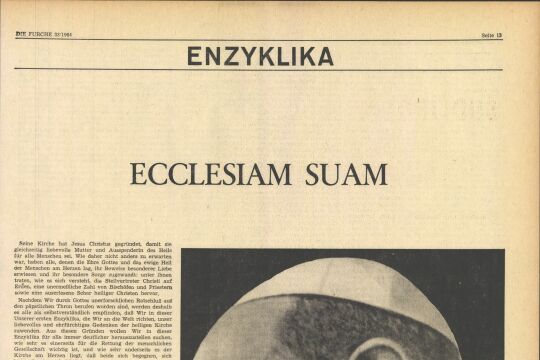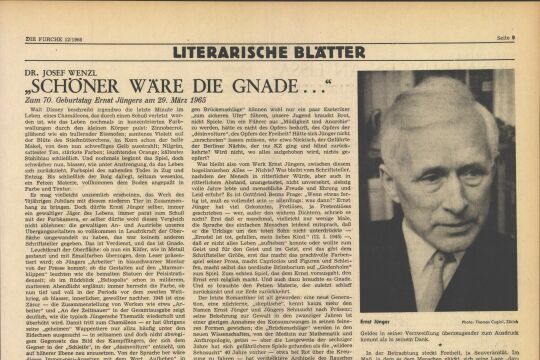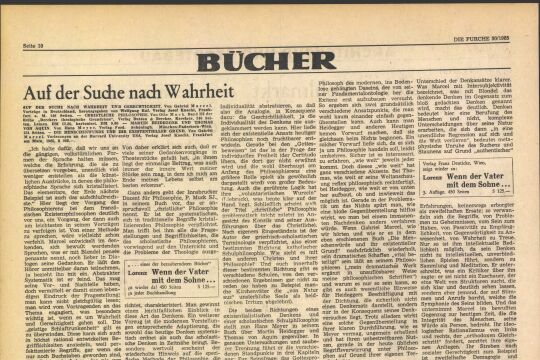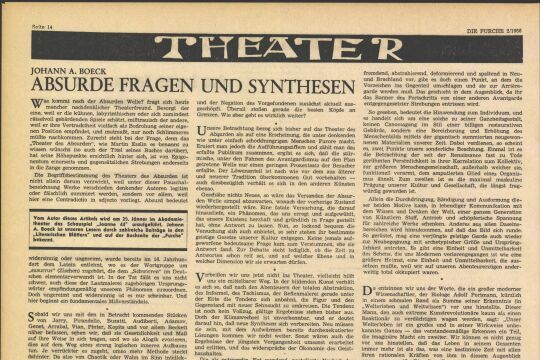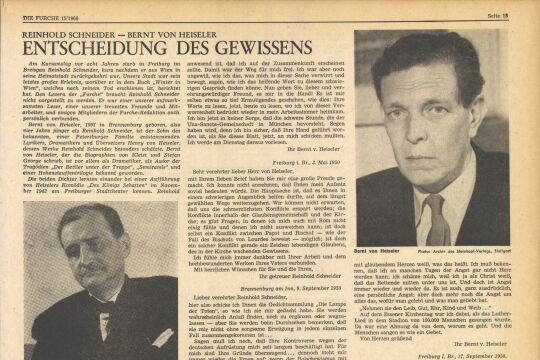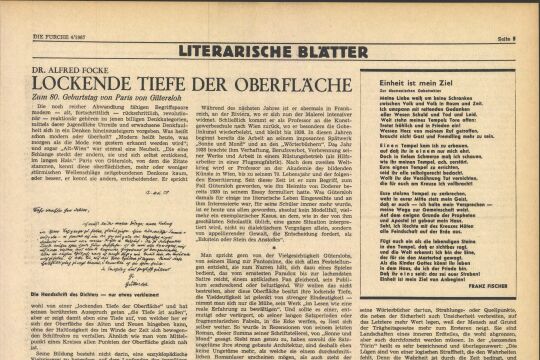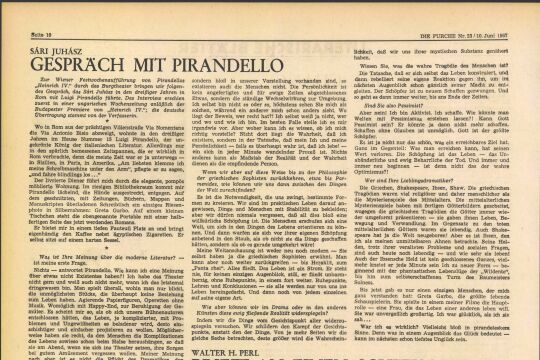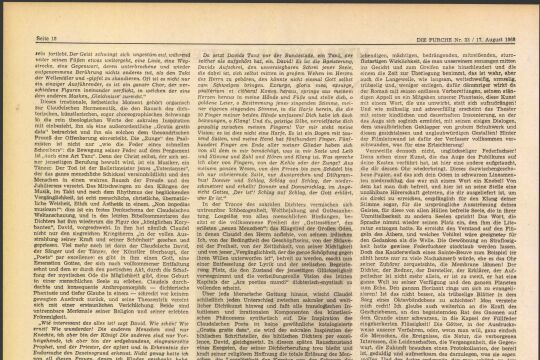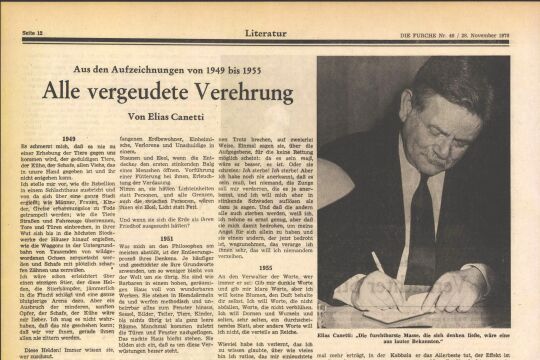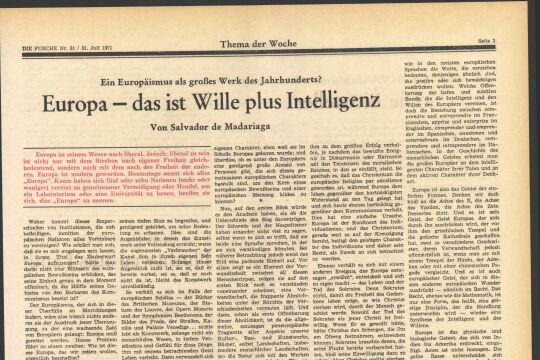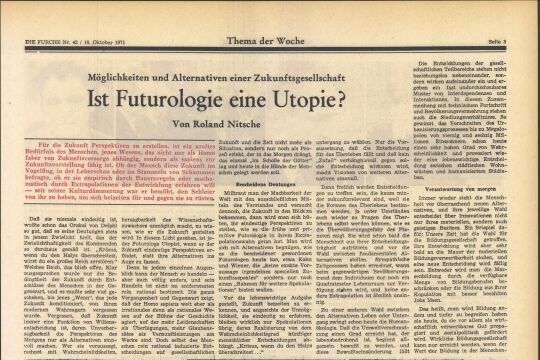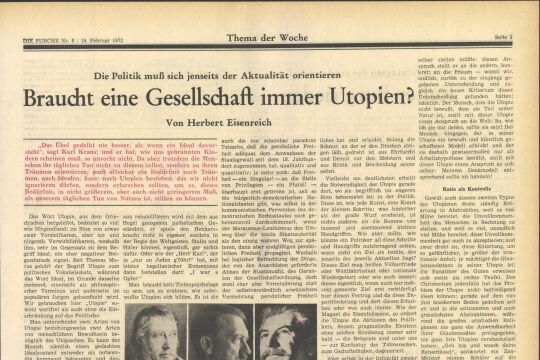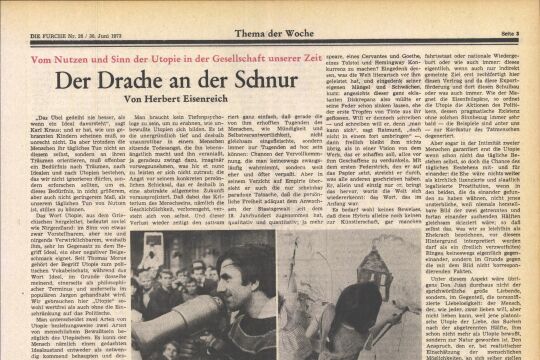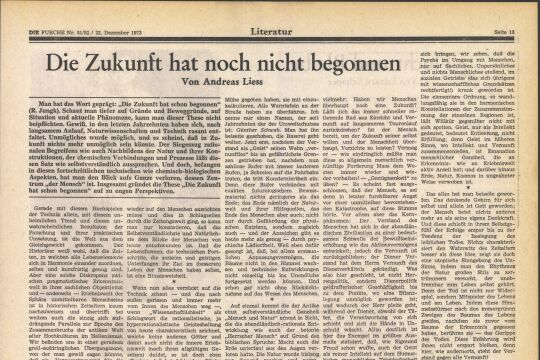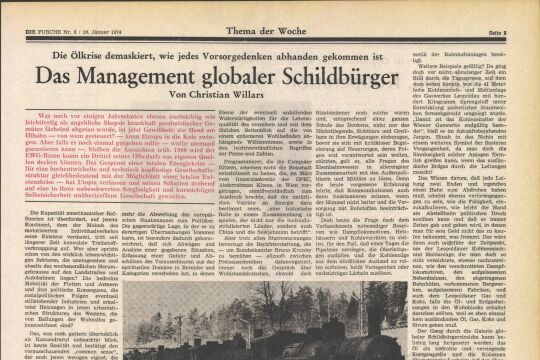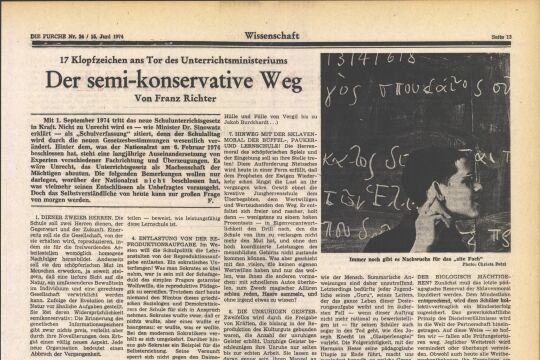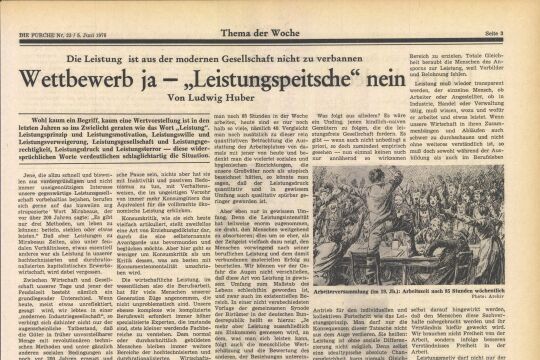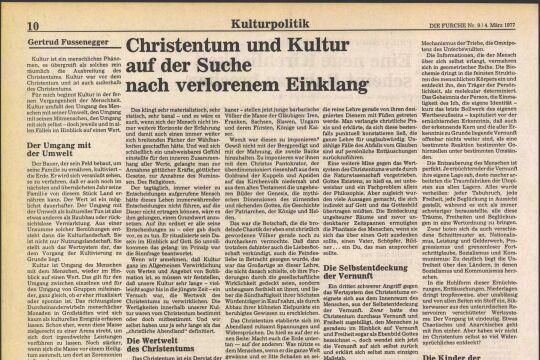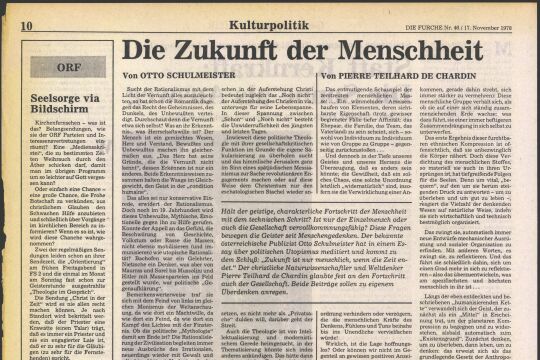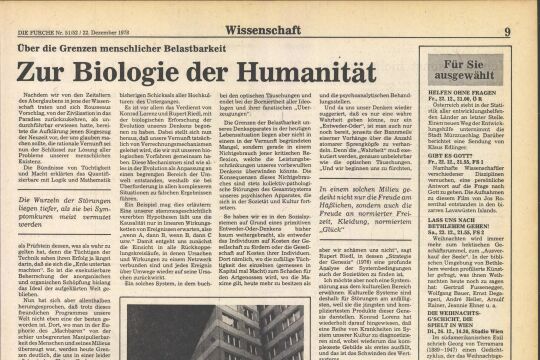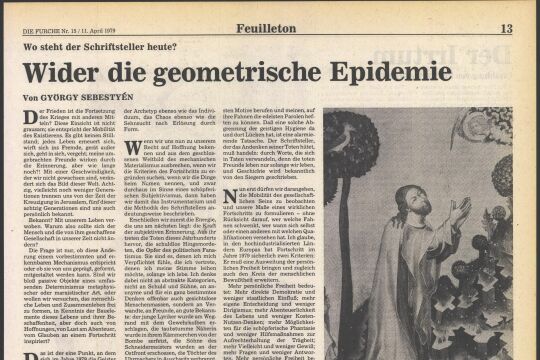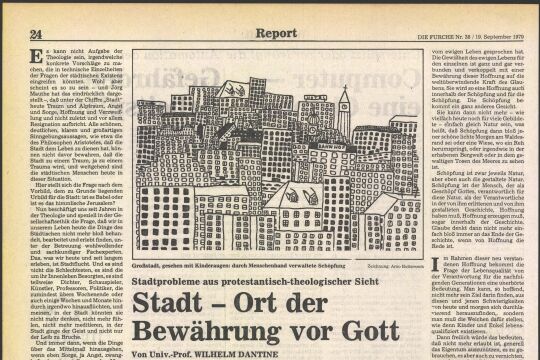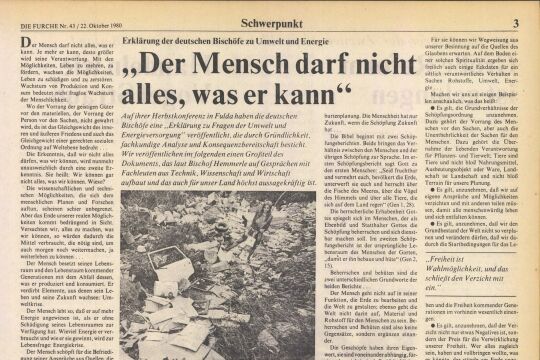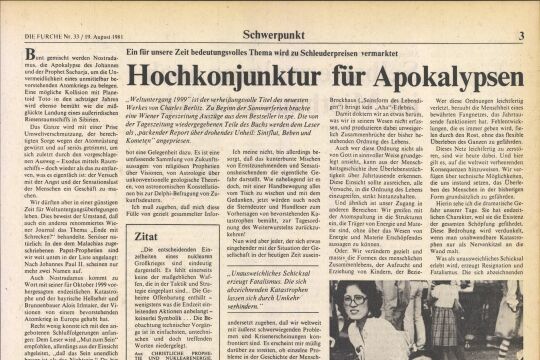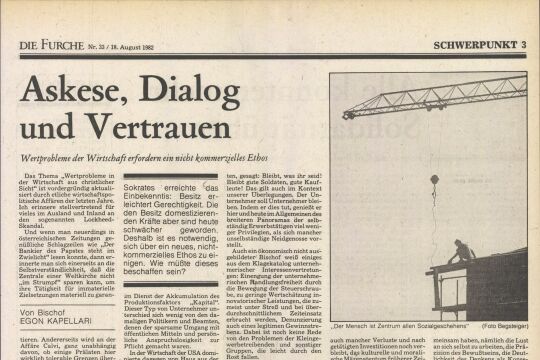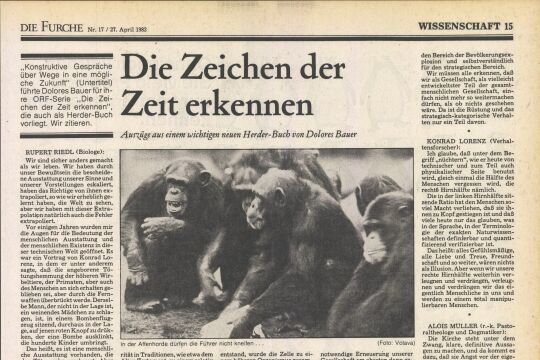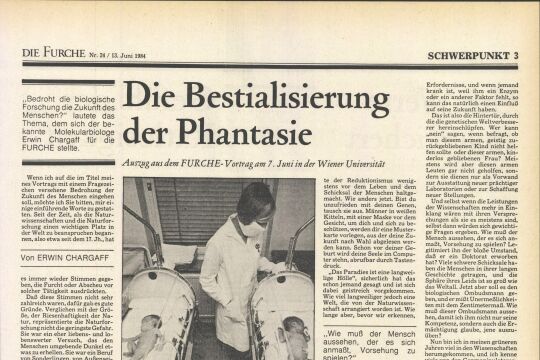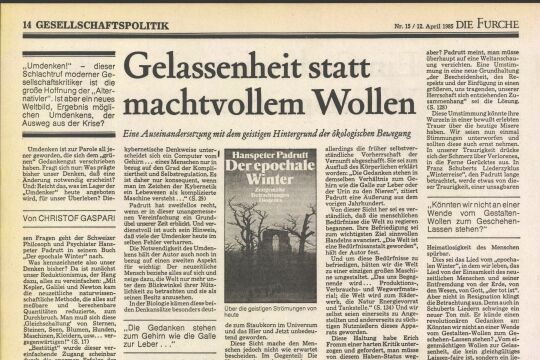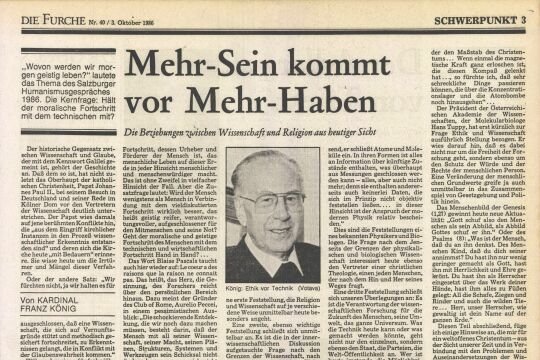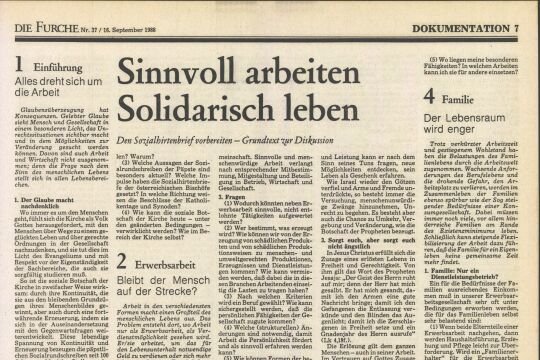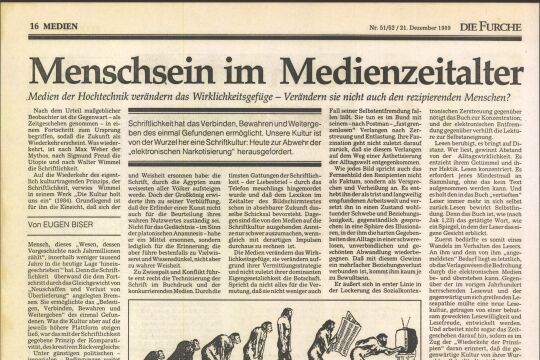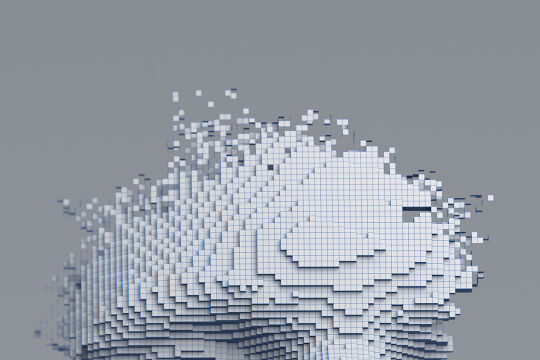Paradiesische Probleme des Nimmersatten
Wie sich Gärtner und Eroberer in der ältesten christlichen Erzählung wiederfinden und wie eine natürliche Harmonie herstellbar wäre.
Wie sich Gärtner und Eroberer in der ältesten christlichen Erzählung wiederfinden und wie eine natürliche Harmonie herstellbar wäre.
Die Beziehung des Menschen zur Natur findet zumeist in einem gesicherten, kultivierten Bereich statt, der der Wildnis entgegengesetzt ist. Dieser Raum rückt besonders dieser Tage in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn es ist Frühjahr und Ostern und alles blüht – und der Garten sieht sich wieder in voller Pracht als konkreter und symbolischer Raum für Naturbeziehung. Das zeigt sich auch auf dem Feld der Traditionen und Überlieferungen. In diesem Sinn ist schon die erste Seite der Bibel, die am Samstag in den Osterfeiern gelesen wird, eine Gartenschrift. Die Geschichte von Eden kann aber nicht nur als religiöses, sondern auch als ein schönes ökonomisches Werk gelesen werden. Denn schon auf den ersten Zeilen spiegeln sie Probleme, die – vor 2800 Jahren erkannt – die Menschheit bis heute verfolgen und prägen. Die Genesis beginnt ihre Schöpfungserzählung zweimal. In der ersten Version bekommt der Mensch einen eindeutigen Auftrag: „Mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ Dann aber nur wenige Verse später, im zweiten Ansatz,– lautet der Auftrag so: „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden dass er ihn baute und bewahrte.“ Diese beiden Verse umfassen den ewigen Konflikt in der Beziehung des Menschen mit der Natur. Der erste Auftrag geht an den sprichwörtlichen Eroberer, der sich alles untertan machen soll. Der Zweite ist der Auftrag für einen Gärtner.
Der Globalisierer
Welchen Prinzipien gehorchen diese beiden unterschiedlichen Typen? Zunächst, der Eroberer. Man stelle sich etwa Alexander den Großen vor. An seiner Geschichte und seinen Feldzügen, die ihn bis nach Indien führten, zeigt sich auch die Struktur des erobernden Charakters sehr gut: Er arbeitet überregional. Seine Nachfrage ist unersättlich. Das Angebot aber ist begrenzt. Daher macht die Intensität der eigenen Nachfrage den Erfolg aus. Vereinfacht gesagt: Der Eroberer ist chronisch unzufrieden. Er ist ein akkumulierender Charakter, je mehr er bekommt, desto mehr muss er haben (außer er wird krank und stirbt, wie Alexander). So wie Alexander strebt der Eroberer nach Globalisierung. Der Gärtner arbeitet hingegen regional. Er muss an das Wachsen und Gedeihen denken und an die Dinge, die ihn tatsächlich umgeben. Er muss im Einklang mit den Gegebenheiten leben und mit dem Kreislauf, den seine Umwelt und ihr Chronotop, die Jahreszeiten, ihm vorgibt. Er, nicht der Eroberer, braucht zum Schutz seiner Kulturen Mauern und Zäune, die seine Kultur absichern. Er ist es, der langfristig denken und sich langfristig sorgen muss. Wir würden heute sagen, er muss nachhaltig sein. Der Gärtner steht beständig mit Dingen, Gegenständen und Menschen in Beziehung, wenn er arbeitet oder seine Güter auf Märkten verkauft. Die Abhängigkeit, die er gegen die Gewalt der Naturkräfte verspürt, machen ihn wohl auch eher demütiger und vielleicht auch vorsichtiger als den Eroberer.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!