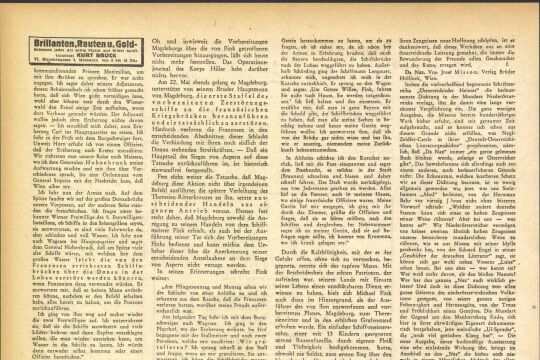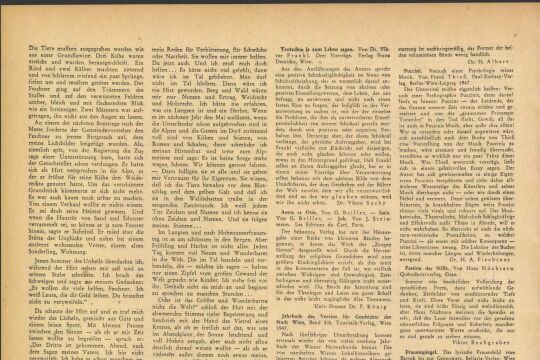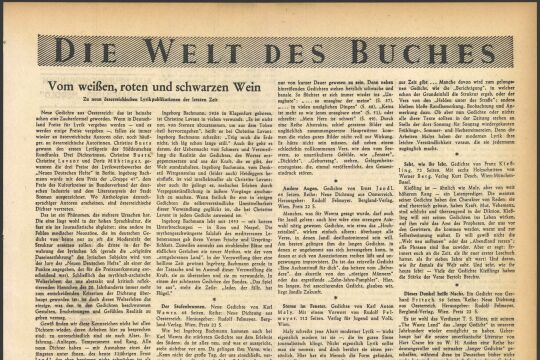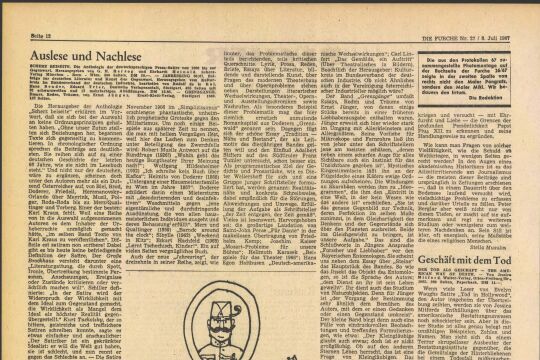Beim Versuch, in Mundart zu schreiben, müssen zuerst Schranken und Vorurteile fallen. Es bedarf einer reiflichen Überlegung. Wo die in der Schule gelehrte und gelernte Schriftsprache das Denken beeinflußt, hat die Sprache des Volkes, seine Mundart, harte und feste Grenzen. Kreisen doch die spezifischen Worte und Wortbedeutungen, wo sie in der zuständigen Mundart gewachsen sind, um alte und überlieferte Güter, Werte und Gegenstände. Der Sprachschatz ist ungleich ärmer im allgemeinen und im besonderen in Ausdrucksformen des heutigen Lebens als die sich ständig wandelnde und den Gegebenheiten des Lebens sich ständig anpassende Schriftsprache. Es würde naheliegen, die Mundart im allgemeinen zu den toten Sprachen zu rechnen. Dieser gefährlichen Täuschung zu unterliegen ist ein Mangel und kann widerlegt werden, wenn man gelernt hat, dem Volk „aufs Maul“ zu schauen. Auch Mundart ändert sich und paßt sich den veränderten Verhältnissen an, wenn auch nicht in der ausgefeilten und nahezu vollkommenen Art der Schriftsprache.
In Ausdrücken des Gefühls, des Schmerzes, der Freude und anderer Erscheinungen verfügt die Mundart hingegen über einen Reichtum, der sie weit über die Schriftsprache erhebt. Feinste Differenzierungen des Gefühls vermag die Mundart vollendet darzustellen. Auch Werte wie Heimat, Treue zum Boden und zum Bauerntum sind selbstverständliche und wichtige Bestandteile.
Es fällt darum nicht leicht, in Mundart zu schreiben, weil Ja auch die Schrift nicht für oder aus einer einzelnen Mundart unseres Landes entstanden ist. Schrift und Buchstaben, wie sie unser Alphabet bietet, reichen für die Mundart niemals aus. Damit muß eine erste Schwierigkeit schon von außen her überwunden werden.
Fürs andere hat die Mundart nicht die ausgefeilte Grammatik der Schriftsprache. Das ist für sie ein großer Nachteil, wenn sie geschrieben werden soll. Da muß der Mundartdichter oder Schreiber von seinem obersten Grundsatz ab- weichen, in der Sprache seines Volkes, seines Tales oder gar seiner Gemeinde zu schreiben. In der ganzen Satzgestaltung, in der Verwendung von Bindewörtern, der Adjektive und der Satzstellung überhaupt lehnt er sich stark an die Schriftsprache an und verfremdet damit seine ureigenste Muttersprache, wenn man von der Mundart überhaupt von eigentlicher Muttersprache reden kann. Die Mutter redet doch mit dem Kind hochdeutsch, wenn auch oft nur in Verniedlichungen. Nicht in erster Linie die Mutter vermittelt dem Kind diese Sprache, sondern die Umwelt der entscheidenden und ersten Kinderjahre und da in erster Linie die ständigen Spielgefährten.
Damit ist Mundart schon lebendige Sprache, wie es die Schriftsprache in dieser Form nie sein kann, da sie immer etwas Gelehrtes und Eingelemtes ist. Damit ist aber auch schon die Einschränkung der Mundart gegeben und auf ihre spezielle Stärke im Bereich des Gefühlsmäßigen festgelegt.
Aus dieser Sackgasse herauszukommen, kostet Überwindung lind macht es dem Mündartdlchter ungleich schwerer als dem Schreiber oder Dichter in der eingelemten und auf alle Gebiete des Lebens ausgerichteten Schriftsprache.
'
Viele haben versucht, aus dieser Sackgasse herauszukommen und sich in der Mundart auszudrücken und, wie zugegeben werden muß, mit Erfolg. Gerade an Österreich ist seit Rosegger, Lutterotti, Kemstock, Klopfer, Weinheber und vielen Ungenannten Erstaunliches geschehen und geschrieben worden.
Aber mit wenigen Ausnahmen hängt der Mundartdichter in erster Linie an den ihm von frühester Kindheit an vertrautesten Begriffen, an und mit denen er überhaupt sprechen gelernt hat. Das ist auch im herkömmlichen Sinn die ureigenste Sprache des Volkes, und es darf nicht verwundern, daß Dichter immer wieder auf sie zurückgreifen. Das birgt freilich die Gefahr der Verfremdung von der Wirklichkeit des Heute in sich, und damit ist der entscheidende Gefahren- punikt der Mundartdichtung aufgezeigt. Sie klebt doch vielfach oder gar zum überwiegenden Teil zäh an der Vergangenheit der Kindheit und gibt sich sehr konservativ sogar mit dem Anstrich, Bewiahrerin des überlieferten Volksgutes zu sein. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Das ist sogar notwendig und erste Aufgabe der Mundartdichtung neben der Bewahrung der Lokalsprache im allgemeinen. Aber damit bleibt sie im Provinziellen verhaftet und vermag nicht zu echter Dichtung aufzusteigen.
Wenn hier und im folgenden von Mundartdichtung gesprochen wird, trifft es in erster Linie auf die gängigste Ausdrucksform, die Lyrik, zu. Auf dem Gebiet des Dramas 1st das diesbezügliche Schaffen noch ärmer als in der Lyrik. Auf dem dramatischen Sektor sind wohl die dummen und verdummenden Bauernschwänke mundartliche Ausdrucksform, sind aber ebensowenig echte Mundart wie die Dramatik etwa der großen Tiroler Kranewitter, Schönherr und Pichler oder des Wieners Anzengruber. Damit soll dem dichterischen Reichtum dieser Dichtungen kein Prügel vor die Füße gelegt werden. Sie ist nicht echte Mundart in der Sprache, dafür aber im inneren Gehalt.
In der Lyrik verhält es sich anders. Hier sind wohl zahlreiche Dichter am Werk, die echte Mundart schreiben, denen aber der tiefe lyrische Gehalt fehlt. Gerade das Festhalten an Heimat, Coden, poesievoller Natur wird dadurch gefördert; verfremdet aber diese Dichtung dem heutigen Menschen. Diese Verfremdung ist gleichzeitig ein gegebener Vorwand zur Einkapselung in sich selbst und trübt den freien Blick in die Wirklichkeit des Alltags.
„Die Mundart muß doch Kraft genug haben, der gegenwärtigen Wirklichkeit Ohne Scheu gegenüberzutreten“ (Ed. C. Heinisch). Dazu gehört aber nicht nur Kraft. Es erfordert Feinfühligkeit und Mut. Die Forderung, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, bedeutet eine Umwandlung der Mundartdichtung gegehüber dem altgewohnten Klischee. Dann droht sie aber, der Sprache des Volkes zu entwachsen und nur noch lyrische Ausdrucksform zu werden,
die Sprache des Dichters und nicht mehr Sprache des Volkes ist. Aber ist denn Lyrik in irgendeiner Form Sprache des Volkes? Nein! Das Volk drückt sich im Reim nur in Sprüchen und einfachen Volksliedern aus. Die Mundartlyrik stellt sich hier in eine Ebene mit der hochdeutschen Lyrik und gibt ihr damit eine entscheidende Daseinsberechtigung. Gerade deswegen ist sie nicht tot oder antiquiert. Gleichsam in neuer, gewandelter Form entsteigt sie den Almen, vergißt sie die Senner und Sennerinnen, überwindet sie das Nachtrauern an verschwindender Bauernromantik und episodenhafter Gelegenheitsdichtung.
Stimmung, Poesie, ja Lyrik in reinster Form vermag die Mundart echter und tiefer auszudrücken. Diese poetisch vielleicht verfremdete und dem Denken des Volkes zu hohe Mundart hat ihre große Chance bekommen und in einem Gebiet unseres Landes auch zu nützen verstanden. Die mit dem hier nicht ganz zutreffenden Sammelbegriff „Avantgarde“ bezeichnten Literaten in Wien um H. C. Artmanns „med ana schwoazzm dintn“, von denen Jandl im besonderen genannt werden muß, haben einen neuen Weg beschritten, wenn er auch teils im Experiment mit der Sprache stecken geblieben ist. Allen voran steht H. C. Artmann, wenn er abweichend vom gewohnten Stimmungsbild der Mundartlyrik neben seinen ruhigeren und versöhnlichen Gedichten über seine Kindheit und die nähere Heimat harte und bittere Worte wählt und teils sogar makabre Bilder formt. Der bekannte Kunstkritiker Alfred Schmeller nennt Artmanns „med ana schwoazzn dintn“ geschriebenen Gedichte „etwas absolut Neues, das schärfer ist als die bisherige gemütliche Mundartdichtung, hintergründig, abgründig, das heißt, wirkliche Peripherie, geraunzter, schwarzer Humor“. Sind mit wenigen Ausnahmen seine stärksten Gedichte mit der schwärzester Tinte geschrieben, ergibt sich ein Extrem in der Mundartlyrik, das beispielgebend und anregend wirkt oder wirken muß. Es müßte doch gerade mit den Mitteln der mundartlichen sprachlichen Feinheiten möglich sein, zarte Stimmungslyrik ahne Kitsch und Sentimentalität zu schaffen. Mundart kann erst dann überregional sein und zu wirklicher Dichtung aufsteigen, wenn ihr der kleinliche Provinzialismus und die vergangenheitsbezogene Nach-Trauerstimmung nicht mehr anhaften. Es ist und muß doch möglich sein, mit dem reichen Formen- und Farbenreichtum der Mundart etwas anzufangen. Zu allen Zeiten wurde gute Lyrik in der Schriftsprache geschrieben. In unserer Zeit wirken große Poeten wie Paul Celan, Maria Luise Kaschnitz, Ingeborg Bachmann, Christine Lavant, Günter Eich und zahllose andere. In deren Gedichten werden volksliedbafte Töne angeschlagen, die zu singen der Mundart besser anstehen würde als dem Hochdeutschen. So würde in vielen Gedichten die Sprachgewalt unserer österreichischen Lyrikerinnen Ingeborg Bachmann, Christine Busta und Christine Lavant durch die Mundart noch überzeugender und kräftiger, noch lyrischer und zarter hervortreten können. Vielleicht mag es als Verlust der österreichischen Gegenwartsdichtung gelten, daß etwa .Lavant ihre doch zutiefst im Kärntner Heimatboden wurzelnde Sprach- und Bilderkraft nicht in ihrer Kärntner Mundart ausdrückt.
Denn ihre Sprache berührt die Grenze zur Mundart und ist vielleicht gerade deswegen so kraftvoll und reich an Bildern. Hier liegt darum die unvergleichliche Kraft des Dialektes.
Es kostet Überwindung, die allgemein in der Mundart ge- . bräuchlichen Worte und Redensarten über Bord zu werfen und, aus ihr schöpfend, neue Worte und Formen zu finden.
Dabei darf diese Lyrik nicht vom Vorwurf getroffen werden, nicht mehr echt und bodenständig zu sein. Jedem Dichter muß die Freiheit eigener Sprache zugebilligt werden. Das erst führt zu freier, schöpferischer Gestaltung, die einen wesentlichen Bestandteil der Lyrik bildet.
Daß die Chancen für die Mundartdichtung in Österreich groß sind, ist eine positive Erkenntnis gerade der letzten Jahre. Denn neue Töne in der Mundartlyrik werden nicht nur in Wien angeschlagen. Sie klingen vernehmlich auch aus anderen Bundesländern. Das 1. Alpenländische Mundartdichterseminar in Spittal, Kärnten, im September 1967 überraschte durch die Qualität österreichischer Lyrik im Vergleich zu den Nachbarländern Bayern und Schweiz. Wenn auch der weitaus überwiegende Teil der österreichischen Beiträge im überkommenen Klische der allgemein bekannten Mundartdichtung verhaftet ist, berechtigt der verbleibende und sehr geringe Prozentsatz zu Optimismus. Soll unsere Mundartlyrik Dichtung sein und soll sie Bestand haben, dürfen die wenigen Beispiele Zukunft haben.
Man darf gespannt sein, was die weiteren Treffen dieser Art bringen werden. Es bleibt zu hoffen, daß die antiquierte Themenwahl vergangener Jahrzehnte einem gesunden Sinn für die Wirklichkeit des Heute weicht und daß „die Klage um das.verlorene Paradies der kargen Scholle“ (Ed.,C. Hei- nisčh) von einer neuen Auffassung abgelöst und damit eher zur echten Kunst wird.