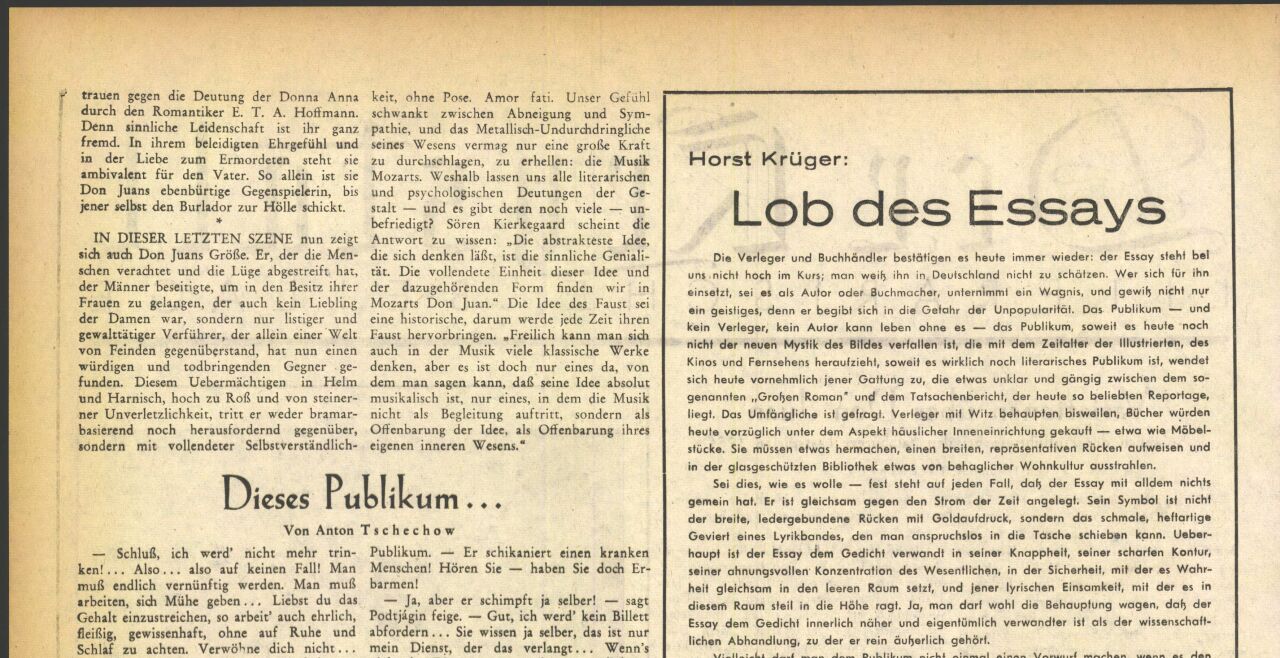
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lob des Essays
Die Verleger und Buchhändler bestätigen es heute immer wieder: der Essay steht bei uns nicht hoch im Kurs; man weif ihn in. Deutschland nicht zu schätzen. Wer sich für ihn einsefzt, sei es als Autor oder Buchmacher, unternimmt ein Wagnis, und gewiß nicht nur ein geistiges, denn er begibt sich in die Gefahr der Unpopularität. Das Publikum — und kein Verleger, kein Autor kann leben ohne es — das Publikum, soweit es heute noch nicht der neuen Mystik des Bildes verfallen ist, die mit dem Zeitalter der Illustrierten, des Kinos und Fernsehens heraufzieht, soweit es wirklich noch literarisches Publikum ist, wendet sich heute vornehmlich jener Gattung zu, die etwas unklar und gängig zwischen dem sogenannten „Großen Roman und dem Tatsachenbericht, der heute so beliebten Reportage, liegt. Das Umfängliche ist gefragt. Verleger mit Witz behaupten bisweilen, Bücher würden heute vorzüglich unter dem Aspekt häuslicher Inneneinrichtung gekauft — etwa wie Möbelstücke. Sie müssen etwas hermachen, einen breiten, repräsentativen Rücken aufweisen und in der glasgeschützten Bibliothek etwas von behaglicher Wohnkultur ausstrahlen.
Sei dies, wie es wolle — fest steht auf jeden Fall, daß der Essay mit alldem nichts gemein hat. Er ist gleichsam gegen den Strom der Zeit angelegt. Sein Symbol ist nicht der breite, ledergebundene Rücken mit Goldaufdruck, sondern das schmale, heftartige Geviert eines Lyrikbandes, den man anspruchslos in die Tasche schieben kann. Ueber- haupt ist der Essay dem Gedicht verwandt in seiner Knappheit, seiner scharfen Kontur, seiner ahnungsvollen Konzentration des Wesentlichen, in der Sicherheit, mit der es Wahrheit gleichsam in den leeren Raum setzt, und jener lyrischen Einsamkeit, mit der es in dieser! Raum steil in die Höhe ragt. Ja, man darf wohl die Behauptung wagen, daß der Essay dem Gedicht innerlich näher und eigentümlich verwandter ist als der wissenschaftlichen Abhandlung, zu der er rein äußerlich gehört.
Vielleicht darf man dem Publikum nicht einmal einen Vorwurf machen, wenn es den Essay nicht schätzt. Denn im Grunde ist der Essay ein Gebilde höchst fragwürdiger Natur, ein Grenzfall der Literatur und damit, wie alle Grenzfälle, eine Sache der Eliten und geistigen Feinschmecker. Zwei ,L°9er literarischer Form gibt es, über deren Ursprung, Aufgabe und Reichweite allgemeine Uebereinkunft herrscht: den Roman und die wissenschaftliche Abhandlung. Der Roman, sofern er mit seinen besten Würfen etwas mit Kunst zu tun hat und das ist heute nicht oft der Fall!, wächst aus der freien schöpferischen Phar lasie des Künstlers hervor. Mit dem Panorama seiner Figuren, Situationen und Gestaltungen erhebt er sich wie eine weitausladende Vision vor dem Auge des Autors, und die Kunst des Romanciers besteht darin, diesen Visionen, die man nicht beweisen, sondern nur annehmen oder ablehnen kann, Kontur, Plastik, Realität und Leben zu geben.
Anders das wissenschaftliche Referat: Es arbeitet nicht mit der Optik, sondern mit der Logik, mit der Grundkafegorie, daß nichts, was geschieht, ohne zureichenden Grund geschieht. Es will erkennen und Erkenntnis übermitteln, und zwar mit der Strenge vernünftiger Schlußfolgerungen. Was im wissenschaftlichen Referat nicht beweisbar und logisch ist, ist nicht. Seine Aussagen bedürfen so des „Apparates", der sach- und fextkrifisch nebenherläuft und wie die Verstrebung eines Bauwerkes dem Ganzen Halt und Festigkeit gibt. Man kann ihm im einzelnen oder ganzen widersprechen. Die wissenschaftliche Abhandlung ist eine Sache der Vorbildung, der Intelligenz, der Beobachtung, Kombination und des selbstlosen Fleißes, wie der Roman eine der inneren Schau, der Kontemplation, ja des intellektuellen Müßiggangs ist.
Dazwischen nun der Essay, dieses strenge, fast marmorn-kühle Gebilde aus Kunst und Geist, in welchem die Klarheit der Erkenntnis und das Pathos der Vision zu einer neuen, eigenen Form verschmolzen sind. Mit der Wissenschaft hat er noch gemein, daß er auf Erkenntnis, nicht Schau zielt, daß er Wahrheit denkend vermitteln will. Allerdings nicht mehr aus wissenschaftlicher Kompetenz, aus der Ueberzeugungskraff logischer Beweise, sondern aus der Freiheit neuer, schöpferischer Erfahrung. Das ist seine Größe und seine Not, daß er etwas sagt, was im tiefsten nicht beweisbar ist, gleichwohl aber dem Denken untersteht. Und darin ist der Essay anderseits zugleich ganz Kunst, ja „Gedicht", daß er seine Wahrheit einfach setzt, aus dem Pathos innerer Schau und Erfahrung waffenlos und unbegründbar in die Welt stellt, wie es sonst nur der Lyriker darf. Und ein Weiteres eint ihn mit diesem: die Fähigkeit zur großen, übergreifenden Schau, der Mut zum Ueberschreiten der herkömmlichen Grenzen, zur eigenen Stellungnahme, zur großen Synthese, bewußt zusammenziehend, sfellungnehmend, urteilend, wertsetzend, Bewunderung und Aergernis erregend.
Aus all diesem wird schon deutlich, warum der Essay seinem Wesen nach eben immer — man verzeihe diese ‘Tautologie — ein Essay, das heißt aut deutsch: nur ein Versuch, ein Bruchstück sein wird. Als Grenzfall zwischen Kunst und Geist, Vision und Logik, Dante und Aristoteles kann er, obschon immer zum Ganzen ausholend, nie dieses Ganze selber geben, sondern nur Bemühung, Versuch, Entwurf dahin sein, der einholf und im Einholen wieder zurücksinkt auf sich selbst, wie das Leben. Wollte man eine Metaphysik des Essays entwerfen — und sie wäre sehr aufschlußreich —, so ergäbe sich, daß gerade in diesem Unvollkommenen, in dem Wagnis der Erkenntnis, in der man im einzelnen erkennt und im ganzen doch scheitert, der Essay recht eigentlich die Grundfigur, das Modell unserer menschlichen Existenz ist. Eine Theologie des Essays würde zeigen, daß er die literarisch vollkommenste Gleichung unseres Daseins vor Gott ist: Gewißheit und Ungewißheit, Wagnis des Geistes, Bruchstück, Tapferkeit und Bescheidung, Hinwendung und Scheitern. Nicht wie die Wissenschaft, in der die Kraft der Vernunft an sich selber glaubt, nicht wie der Roman, der eine eigene neue Welt danebensetzt, sondern keines und beides, aber geöffnet, unfertig, dauernd seiner Möglichkeit und seiner Vorläufigkeit bewußt. Wir alle, könnte man in bildhafter Wendung sagen, sind Essays in der Vorform des Fleisches.
Deshalb gilt es, den so wenig erkannten Essay zu preisen. Er ist die menschlichste und zugleich wahrhaftigste Form der Literatur. Er setzt Nüchternheit gepaart mit Leidenschaft, strenge Rationalität verbunden mit magischer Bildkraff voraus. Er fordert Zucht, Maß und Ordnung. Mit einem Satz: er ist eine Form der Mitte. Ist dies der Grund, warum wir Deutsche wohl viele überragende Wissenschaftler und Künstler hervorgebracht haben, aber kaum einen großen Essayisten? Die deutsche Tiefe, Innerlichkeit und Gründlichkeit, diese verhängnisvollen Talent-Laster unserer Nation, sind dem Essay gram. Zum großen Essayisten gehört offenbar immer etwas von französischer Natur: klar, ja präzis in der Denkweise, elegant und wendig in der Form, tapfer, aber niemals verwegen im Gehalt, so wie es Montaigne, der Vater des Essays, vorbildhaft war.
Solcher Essayisten bedürfen wir heute. Wir sind auf der Suche nach ihnen, sie könnten zu ihrem Teil unserer Welt Uebersichf und Ordnung, Mitte, Horizont und Grenze geben, wie es im ganz großen Sinn einmal die Apostel in ihren Briefen taten. Denn im Essay ist alles möglich: Enthüllung und Offenbarung des ganzen Seins.
Aus „Dekadenz und Erneuerung", Verlag Josef Knecht, Carolusdruckerei, Frankfurt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































