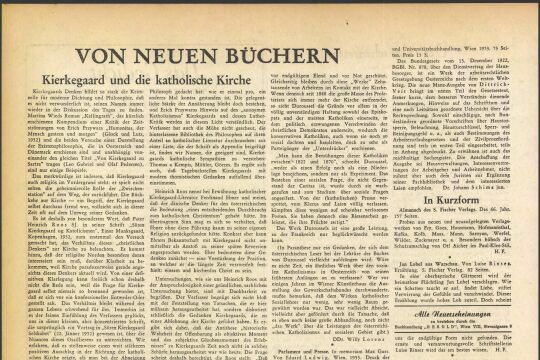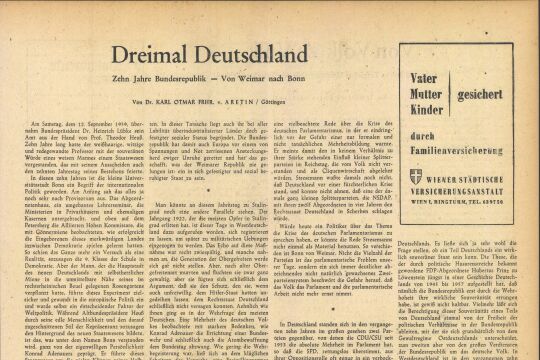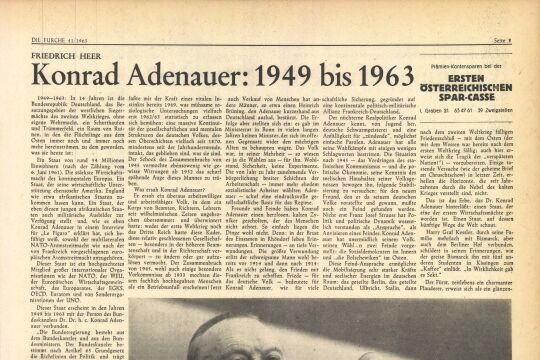100 Jahre nach der Gründung des Zweiten Reiches der Deutschen im Kriege von 1870/71 erscheinen jetzt, im Jahre 1970, die politischen Erinnerungen Heinrich Brünings; die Memoiren des letzten Reichskanzlers, der vor der Zerstörung dieses Reiches unter Adolf Hitler das Experiment einer Alternative zur Löwenlösung des Hitlerismus auf sich nahm und der dazu wohl in der Lage war. In einer Stunde wie dieser, da ein in seiner Geschichtserkenntnis so sehr gehemmtes deutsche Volk es vielfach den Intellektuellen und Ideologen der politischen Linken überlassen muß, die Bedeutung der Reichsgründung Otto von Bismarcks mit dem Zollstock der Epigonen nachzumessen, wiegt das Zeugnis des letzten Großen in der Reihe der Nachfolger Bismarcks schwer in der Geschichte. Im Deutschland der freien Welt des Westens hat die im Amt befindliche Bonner Regierung der Sozialdemokraten und Linksliberalen dem am 30. März 1970 in Norwich/Vermont, USA, im 85. Lebensjahr Verstorbenen anläßlich der Beerdigung in der Heimat den Respekt erwiesen; die DDR und der kommunistische Osten beließen es bei der Registrierung des Todes des Feindes laut Schema; in der übrigen Welt war das Echo des Erinnerns vielfach beträchtlich. Nur ein schwacher Nachhall erreichte auch Österreich, dessen Schicksal In den letzten 40 Jahren wohl anderes verlaufen wäre, hätte man Brüning nicht im Jahre 1932 „hundert Meter vor dem Ziel“ abgefangen und zum Sturz gebracht.
Hier soll nicht eine geschichtliche Darstellung des Endes der Weimarer Republik kommentiert werden. Andre Frangois-Poncet, von 1931 bis 1938 Botschafter Frankreichs in Berlin, schildert Brüning nach dessen Ausscheiden aus der Reichsregierung im Sommer 1932 als „erleichtert, aber verbittert“. Ein Bodensatz dieser inneren Verfassung findet sich auch in den wunschgemäß nach dem Tode des Kanzlers herausgekommenen Memoiren. Im Verlauf der 38 Jahre, die Brüning nach seiner Verabschiedung zum großen Teil außerhalb Deutschlands zugebracht hat, vor allem bei der Niederschrift der Erinnerungen, suchte Brüning die Verbitterung zu bewältigen; das Gefühl der „Erleichterung“ aber, das der Franzose vor einer Generation wahrzunehmen glaubte, hat sich in jene Bedrücktheit gewandelt, die angesichts der „deutschen Frage“ von heute nicht nur die Deutschen und die Europäer, sondern mit ihnen die ganze Welt befallen hat. Brüning ist in dem Zwielicht gestorben, das in diesem Jahr 1970 noch über der deutschen Frage liegt. Er hat es vermieden, in seinen Memoiren eine Zukunft auszumalen.
Man soll bei und nach der Lektüre dieser Memoiren nicht das „Was wäre-geschehen,-wenn-Spiel“ betreiben. Brüning selbst geht derartigem in seinem Text aus dem Wege, es sei denn, daß er bei der Erklärung einer bestimmten geschichtlichen Situation das kaiLkulieirte Risiko des seinerzeitigen Tuns und dessen mögliche Auswirkungen auf die Zukunft mit in Erwähnung zieht. Seit Rudolf Morsey, unter anderem in „Das Ende der politischen Partelen 1933“ (Düsseldorf), seine Schilderung des seltsamen Endes der Deutschen Zentrumspartei zur Diskussion stellte, ist dieser Hintergrund der Ereignisse oft genug und von verschiedenen Seiten aus beleuchtet worden. Brünings Memoiren sind daher auch nicht von jenem Sensationalismus des „Unerhörten“ umwittert, demzufolge die vulgäre Erwartung gewisse Politikermemoiren zu Bestseller macht. Ein derartiger Effekt stünde mit Gehalt und Wert der Persönlichkeit Brünings in einem kontradiktorischen Gegensatz. Zeitgenossen und Tatzeugen von damals werden diese, wie man früher sagte, „mit Herzblut geschriebenen“ Erinnerungen mit Erschütterung lesen und noch einmal ihr Ja oder Nein zu erfassen suchen; Historiker, Politologen, Soziologen, Nationalökonomen usw. haben hier ein Ganzes vor sich, an das fundierte Kritik anzulegen sich lohnt; junge Menschen, die Zugang oder Einstieg in das Politische suchen, erleben das politische CEouvre eines Katholiken, Deutschen und Europäers.
Brünings Memoiren enthüllen Position, Struktur und Funktion eines „Verfechters des politischen Katholizismus in der Weimarer Republik“ {Adolf Hitler) und den Werdegang des letzten Vorsitzenden der Deutschen Zentrumspartei, einer (so ein politologisches Urteil nach 1945) „kirchlich-organisatorisch abgestützten Ideologienpartei“.
Er ist Sohn des westfälischen Katholizismus (sein älterer Bruder starb als römischer Prälat), aber er beschreibt selbst, wie er aus den Beengtheiten dieses festgewachsenen, vielen unerschütterlich scheinenden, Bereich herausstrebte. Während seines Hochschulstudiums in Straßburg tritt er der katholischen Studentenverbindung „Badenia“ bei; aber sein Verhältnis zum Oartellverband in Deutschland bleibt zeitlebens eher prekär. Nach dem Krieg tritt er in den Dienst des preußischen Wohlfahrtsministeriums ein; seine Formung im Staatsdienst erhält er aber nicht als Bürokrat, sondern in der Schulung des Volksvereins für das katholische Deutschland, Mönchen-Gladbach, und in den Begegnungen im Sozialstudentischen Sekretariat Karl Sonnenscheins (SSS/Berlin). Das Mandat als Mitglied des Reichstags erhält er nicht in Westfalen, sondern im Osten, in Breslau. Nach der Übernahme der Geschäftsführung bei den christlichen Gewerkschaften schien er zeitlebens gewissen Industriellen verdächtig: Brüning wurde aber kein Gewerkschaftler im Reichskanzlerpalais, sondern der Reichskanzler, der das zum Teil aus Vorkriegsverhältnissen stammenden Parteiengefüge vom „Gemeinschaftserlebnis des Krieges“ her aufzulockern versucht. Der „tadellose Frontsoldat des Weltkrieges“ („Völkischer Beobachter“), dessen soldatische Grundhaltung auch im linksgerichteten „Spiegel“ von 1970 Achtung findet, lehnt die paramilitärischen Methoden derer ab, die „irgendeinen Unteroffizier oder einen Lehrer fanden, der Reserveoffizier gewesen war, der ihnen etwas Drill beibrachte — für Soldaten alles etwas lächerlich“.
Das eben gesagte markiert eine ganze Reihe von Abständen zu dem, was man unlängst in unserer Zeit ein „Establishment“ nannte; Abstände, die allerdings auch im Umkreis der Persönlichkeit Brünings trotz dessen Neigung zu Geselligkeit eine Lichtung der politischen Beziehungen entstehen lassen, in der zu existieren gefährlich wird, als Joseph Goebbels schreiben darf, daß „unsere Wühlmäuse bei der Arbeit sind, die Brünings Position vollends zernagen“. Als es 1932 soweit war, stand Brüning bereits über der Bruchlinie, die nach 1930 das allgemeine Rechts-Überholmanöver auch in der katholischen Zentrumspartei aufgerissen hat. An der Punkt für Punkt festgelegten Einschätzung des Zentrumsvorsitzenden Prälat Ludwig Kaas und des Zentrumsabgeordneten (und Nachfolger Brünings) Franz von Papen erweist sich Brünings Bemühen, gerade bei der Schilderung dieser beiden Persönlichkeiten, die beide zum Scheitern seiner Bemühungen so viel beitrugen, möglichst menschliches Verstehen ja ebenfalls Sachlichkeit walten zu lassen.
Es soll hier nicht untersucht werden, welche Antwort die Umstände des Zerfalls der Deutschen Zentrumspartei im Jahre 1932/33 auf die Frage geben, ob überhaupt eine katholische Partei, eine Politik nach katholischen Grundsätzen, ein katholischer Politiker möglich und gerechtfertigt sein können. Die Frage erscheint jetzt, da es einen „politischen Katholizismus“ der Linken gibt, zweifellos in einem anderen Licht als vor einem Jahrzehnt, als für die jungen Katholiken der Vorwurf irgendeines politischen Katholizismus' unerträglich war.
Die katholische, die christliche Partei existiert unter bestimmten Voraussetzungen im Schnittbereich von Religion und Politik, Staat und Kirche im gesellschaftlichen Leben. Der Inhalt dieses Schnittbereiches ist nicht prinzipiell ein für allemal bestimmt; er wechselt in Größe und Dichte, weil er geschichtliche Gewordenheit und Veränderlichkeit darstellt. Das Vakuum in diesen Beziehungen tritt ein, wenn die itio in partes geschieht. Wenn die Katholiken, die Christen sich zum Teil in den sakralen Raum der Kirche zurückziehen, zum anderen Teil Reisläufer bei politischen Bewegungen mit anderen als christlichen Zielsetzungen werden.
Zu den dramatischesten Partien der Memoiren gehören jene, die beschreiben, wie sich der Zentrumsvorsitzende Prälat Kaas in der Krise zur Politik des Vatikans und zuletzt zum Vatikan absetzt (wobei die Partei in der Auseinandersetzung mit dem Hitlerismus zeitweise ohne Führer dasteht) und Franz von Papen mit zwei Rochaden zu den Nationalisten und nachher zu den Nationalsozialisten wechselt. Wer das Politische als wertfreie Wissenschaft betreibt, wird an diesen Stellen „Ursachen und Wirkungen“ politologisch erforschen, bestimmte „Typen des Handelns“ eruieren, „typische Kausalbeziehungen“ konstruieren können. Für den Katholiken tut sich die immer wieder zu befahrende gefährliche Passage zwischen den Klippen auf, die Brüning anläßlich seiner „bedrückten Heimkehr“ aus dem Vatikan (S. 359 ff.) schildert. Am Fall Brüning mag jeder ermessen, welche Valuta die „für den katholischen Politiker ausgestellte kirchliche Legitimation“ in der Krise hat.
Als Reichskanzler stand Brüning an der Spitze einer Regierung, die den Ausweg aus der unergiebigen Positionsstrategie der politischen Parteien der zwanziger Jahre suchte und sich — wenigstens auf die Dauer — nicht auf das verfassungsmäßige Notverordnungsrecht des Staatsoberhaupts stützen wollte. Sein Experiment vollzog sich in einem Staat, der im Übergang vom patriarchalischen zum demokratischen Zeitalter zu Zeiten ein wenig wackelig, jedenfalls nicht so repräsentativ aussah, wie es das „Reich, das die Väter aus den Einigungskriegen heimbrachten“ zu sein schien. Die legitimierende Staatsidee war 1918/19, in den Wechselschlägen von Revolution und Reaktion, ein wenig flach erfaßt worden. Gegenüber den Möglichkelten, die „öffentliche Meinung“ zu manipulieren, die „politische Willensbildung“ zu radikalisieren und das „parlamentarische Rituale“ zu mißbrauchen, war der Staat schlecht gerüstet. Erst auf dem Totenbett der Weimarer Republik erkannte die bis dahin kaum gehemmte Publizistik, daß das, was die Nazis noch nicht heruntergerissen hatten, sie mit ihrer Kritik ohne Alternativen skelettiert hatten. In dem Transitorium zum „totalen Staat“ ist Brüning für die einen der letzte Garant eines erneuerten Parlamentarismus, für die anderen Sachwalter eines „Präsidialregimes“, Schrittmacher dessen, was nachher kam. Die Wahrheit ist, daß die politische Rechte (NSDAP, Deutschnationale Volkspartei, Stahlhelm und andere) die Kraft und die Mandate zur Mehrheitsbildung Im Parlament ebensowenig besaß wie die politische Linke (KPD, SPD u. a.); so entstand sein Regime in einer harten und unnachgiebigen Auseinandersetzung mit der politischen Rechten und mit Hilfe einer lässigen parlamentarischen Duldung seitens der Sozialdemokraten. Diese von der Propaganda und Agitation der nadl-kalen Rechten verteufelte »Linksneigung“ war in der Zelt des Rechts-Überholmanövers der jungen Generation gefährlich; sie konnte aber auch nicht die SPD für ihre Politik der Duldung genügend honorieren, da diese Massenpartei immobil wurde, es schwer hatte, die Konkurrenz der mächtig aufkommenden KPD niederzuhalten. Zu diesen Balanceakt des Politischen liefert Brüning Einsichten, die auch den wenigen lesefreudigen Realpolitiker faszinieren könnten. In der Sache ist wesentlich, daß „die Politik der reinen Sachbezogenheit“ in' Grenzen eine Chance haben kann, wenn sie von der Persönlichkeit des großen Staatsmannes getragen wird. Groß in dem Sinn, daß im Fall Brünings zu dem wissenschaftlich betriebenen Studium der Philosophie und der Geschichte, des Staatsrechts und der Nationalökonomie die Fähigkeit „Kunst des Möglichen“ im Sinne Bismarcks hinzukam: Die Fähigkeit, ,,in jedem wechselnden Moment der Situation das am wenigsten Schädliche oder das Zweckmäßigste zu leisten“. Für die Richtigkeit dieses Handelns hatte Brüning einen unerbittlichen erbarmungslosen Monitor neben sich: Die Krise der nationalen und internationalen Situation der Wirtschaft, der Finanzen und der sozialen Verhältnisse, die dem Reglerungschefs nicht nur „Konzepte und Modelle“, sondern Aktionen abverlangte.
Der konservative Mensch wird es beklagen, daß in diesen Krisen das Verhältnis Brünings zum Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zerbrach, der Reichskanzler beim Generalfeldmarschall in den Verdacht geriet, in seinem Kabinett „bolschewikische“ Tendenzen zu dulden.
Es geschah aber anderseits, und Brüning beschreibt es mit großer Offenheit, daß er der Nachbarschaft mit den großen Männern der deutschen Sozialdemokratie nicht aus dem Weg ging, sondern sie schätzte. Man wird Brüning und Friedrich Ebert wohl als die bedeutendsten Gestalter der inneren Politik der Weimarer Republik nennen dürfen.
Ebert, dessen Wort, er werde in der Gefahr Deutschland wegen der Verfassung nicht zugrunde gehen lassen, wohl besser als Tatmodell auf die Situation gepaßt hätte als das, was bei der Verabschiedung Brünings und nachher am 30. Jänner 1933 in Deutschland geschah. Brünings auswärtige Politik hatte drei schwere Hypotheken auf sich: Die in Versailles übernommene Alleinschuld der Deutschen am Krieg die Last der Reparationen, die unheimliche Nachbarschaft zu Frankreich und die schwer zu enträtselnde Verschleierungspolitik Großbritanniens. Die Zeit für die Ausführung europäischer Konzepte war in diesem Jahrzehnt der Hybris des Nationalismus in Europa kurz geworden. Zu kurz. Stresemann großes Erbe lag in den Händen Aristide Briands, der wußte, wie schwer die Schatten waren, die auf seine und Stresemanns Hinterlassenschaft, aber auch auf sein höchstpersönliches Dasein bereits fielen.
In der Schilderung der Begegnung mit Briand deutet Brüning eine gefährliche Zukunftsvision an, die er mit eigenen Worten stets vermeidet: „J'al peur des peuples des steppes et de pralries“, sagte der Franzose; „et je crains de las voir ectrase entre eux notre pauvre vieille Europa.“
Diese Angst vor den Russen und vor den Amerikanern wurde Brüning nicht mehr genommen. Der Hitlerismus, den Brüning mit der Last der Verantwortung in der Krise vor dem Erreichen der Macht fernhalten wollte, bekam die Macht, die Tore in Ost und West weit aufzureißen; durch die eine ungeheure Übermacht über die formlos gewordene europäische Mitte hereinbrach.
MEMOIREN 1918 BIS 1934. Von Heinrich Brüning. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, 1970. 721 Seiten. S 220.—.