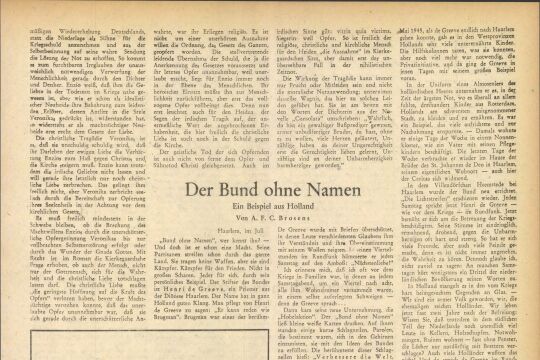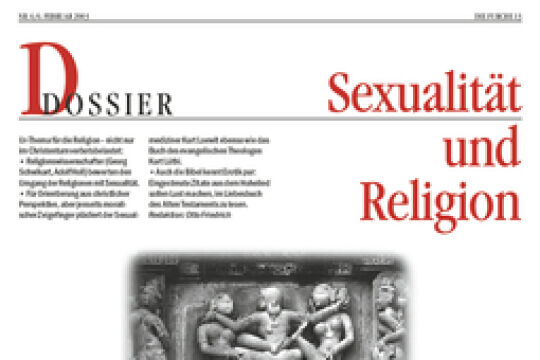"Dauert die Beziehung an, muss die Wirkung der Verliebtheitshormone durch tiefere Gefühle der Liebe ersetzt werden."
"Menschen sind Generalisten, die mit einer breiten Palette von Lebensbedingungen zurecht kommen. Das schlägt sich auch in den Verheiratungssystemen nieder."
Die Liebe ist mehr als nur ein Gefühl. Sie ist ein ganzer Verhaltenskomplex, geprägt durch biologische, psychologische und soziale Faktoren. Liebe gibt es bekanntlich in hetero- und homosexuellen Partnerschaften. Doch aus biologischer Sicht wird Liebe in erster Linie im Zusammenhang mit der Fortpflanzung untersucht. Warum aber sollte dazu Liebe notwendig sein? Und brauchen wir überhaupt die Sexualität?
Der amerikanische Biologe Leigh van Valen hat uns - knapp 100 Jahre nach Darwins Tod - mit der "Herzkönigin-Hypothese" eine Antwort darauf gegeben. Er benannte sie in Anlehnung an Lewis Carrolls Novelle "Alice im Spiegelland", in der die Thronherrschaft über ein Wettrennen entschieden wird. Van Valen erkannte die Wichtigkeit der "Wirt-Parasiten-Koevolution" - der Wechselbeziehung zwischen großen, langlebigen Organismen und ihren Parasiten. Durch Sexualität gelingt es, etwas Neues hervorbringen, das für die Parasiten eine neue Herausforderung darstellt. Mit diesem evolutionären Turbo schaffen es langlebige Organismen, im Wettrennen mit Parasiten besser Schritt halten zu können.
Biologische Kosten
Sexuelle Fortpflanzung findet im Tier-wie auch im Pflanzenreich vor allem dann statt, wenn Organismen besonders stark veränderlichen Umwelten ausgesetzt sind. Mittels Sexualität wird die genetische Information von zwei völlig unterschiedlichen Individuen zusammengemischt. Somit erscheint Sexualität wie das Wetten auf eine unbekannte Zukunft. Sexuelle Fortpflanzung an sich ist eine sehr aufwendige Angelegenheit. Ein Mindestmaß an Kooperation ist allein schon notwendig, damit es überhaupt zu einer Befruchtung kommen kann. Gibt es Fürsorgeverhalten für die Nachkommen, also elterliches Investment, muss natürlich auch eine Art Paarbindung etabliert werden.
Aufgrund der sich ergänzenden Vor-und Nachteile von großen und kleinen Keimzellen entwickelte sich die so genannte "Anisogamie" (Samen-und Eizellen). Bei der sexuellen Fortpflanzung mit zwei Geschlechtern ist es daher möglich, die Vorteile von kleinen und großen Keimzellen auf die beiden Geschlechter zu verteilen: Die vielen, sehr billig herzustellenden, mobilen kleinen Spermien stellen die Wahrscheinlichkeit des Aufeinandertreffens mit einer zweiten Keimzelle sicher. Die eher immobile große Eizelle stellt wiederum sicher, dass der entstandene Embryo auch genügend Energie zur Verfügung hat.
Bei den meisten Organismen ist das weibliche biologische Minimalinvestment höher als das männliche. Bei Säugetieren wie den Menschen ist das biologische Minimalinvestment stark asymmetrisch ausgebildet: Beginnend mit der größeren Eizelle, folgt die lange Schwangerschaft und Stillperiode auf der weiblichen Seite. Auf der männlichen Seite sind die biologischen Minimalkosten relativ gering: Ein Sexualakt dauert im Schnitt circa vierzehn Minuten, und Ejakulat ist energetisch auch nicht sehr teuer herzustellen.
Neben diesem Minimalinvestment kommt noch fakultatives Zusatzinvestment hinzu: Die variablen Kosten der "Brutfürsorge" können sich auf beide Geschlechter verteilen, das heißt das weibliche Geschlecht versucht, sich Unterstützung durch väterliches Investment zu sichern. Deshalb bevorzugen Frauen Reproduktionspartner, die sowohl fähig als auch bereit sind, den Nachwuchs zu versorgen. Aus biologischer Sicht ist die Vaterschaftsunsicherheit der Hauptfaktor, der dem väterlichen Investment jenseits des biologischen Minimalinvestments entgegenwirkt.
Weibliches Fehlermanagement
Paarbindung ist eine Möglichkeit, um Vaterschaftsunsicherheit zu reduzieren. Beide Geschlechter streben also aufgrund unterschiedlicher Motivationen Paarbindung an: Das weibliche Geschlecht versucht so, väterliches Investment sicherzustellen, während das männliche versucht, sicher zu gehen, dass dieses Investment biologisch betrachtet auch in eigenen Nachkommen resultiert.
Diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen schlagen sich auch im Einschätzen potentieller Partner nieder. Wir bedienen uns in der Entscheidungsfindung einer Denkstrategie, die als Fehlermanagement bezeichnet wird. Weil man die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu begehen, nicht beeinflussen kann, versucht man durch gezieltes Fehlermanagement die Konsequenzen dieser zu minimieren: Dadurch verschieben wir unsere Entscheidungsstrategie in Richtung der weniger schwerwiegenden Fehler.
Bei der Einschätzung des Interesses eines potentiellen Partners sind für das weibliche Geschlecht zwei Fehler möglich: Entweder sie erwartet Interesse und auch Investitionsbereitschaft dort, wo keines ist (Typ 1-Fehler), oder sie geht davon aus, dass beides nicht vorhanden ist, obwohl Interesse bestünde (Typ 2-Fehler). Da ersterer Fehler mit größeren Kosten verbunden ist, hat sich die weibliche Entscheidungsstrategie Richtung Typ-2-Fehler verschoben. Umgekehrt wiegt für das männliche Geschlecht der Typ-2-Fehler schwerer, da es dadurch Reproduktionsmöglichkeiten ungenutzt lässt. Das unterschiedliche Fehlermanagement bei Mann und Frau lässt sich auch in anderen Situationen beobachten, etwa im Arbeitsalltag, bei Spielen -wo immer Entscheidungen getroffen werden müssen, ohne dass ausreichend Fakten zur Verfügung stehen.
Trotz aller Unterschiede überwiegen jedoch die Gemeinsamkeiten von Männern und Frauen. So legen beide Geschlechter am meisten Wert darauf, dass ihr Partner nett, verständnisvoll und gesund ist. Erst danach tun sich Unterschiede auf: Frauen legen mehr Wert auf Eigenschaften, die mit dem sozioökonomischem Status verbunden sind, während für Männer die Attraktivität und Jugendlichkeit der Partnerin wichtiger ist als umgekehrt für Frauen.
Optimierte Versorgung
Aus biologischer Sicht kann die partnerschaftliche Liebe also dadurch erklärt werden, dass dadurch die Versorgung der Nachkommen optimiert werden kann. Durch erhöhte Vaterschaftssicherheit wird väterliches Investment in die Nachkommen erhöht. Auf hormoneller Ebene kommt dem Oxytocin eine entscheidende Rolle für die Etablierung und Aufrechterhaltung der Paarbindung zu. Dieses "Bindungshormon" wird besonders im Beziehungskontext ausgeschüttet: Bei der Geburt und beim Stillen wird dadurch die Mutter-Kind-Bindung gestärkt. Die Paarbeziehung wird durch Oxytocin-Produktion bei Berührungen, sexueller Erregung und insbesondere beim Orgasmus gestärkt.
Da der Geschlechtsverkehr bei Menschen nicht nur zeitlich begrenzt stattfindet, sondern über den ganzen Zyklus hinweg, kann so die physiologische Grundlage für die Paarbindung geschaffen werden. Am Anfang einer Beziehung werden "Verliebtheitshormone", die Phenylethylamine ausgeschüttet. Dauert die Beziehung aber an, werden diese nicht mehr produziert. Die Verliebtheitsgefühle müssen somit durch tiefere Gefühle der Liebe, also durch andere Bindungsmechanismen ersetzt werden.
Diese biologischen Grundlagen führen nicht zu einem starren Verhaltensmuster, im Gegenteil: Menschen sind vielmehr Generalisten, die mit einer breiten Palette von Lebensbedingungen zurecht kommen und so die biologischen Anlagen durch kulturelle und soziale Überformung optimieren. Dieses Generalistentum schlägt sich u. a. in den Verheiratungssystemen nieder, die große kulturelle Unterschiede aufweisen können. Die diversen Sozialsysteme sind gleichsam Antworten, die an die ökologischen Rahmenbedingungen angepasst wurden.
Die Biologie liefert nur Erklärungen dafür, warum bestimmte Phänomene häufiger auftreten als andere. Da wir Menschen nicht nur biologische, sondern auch Sozial-und Kulturwesen sind, treffen wir mitunter auch Entscheidungen, die den biologischen Erklärungen widersprechen. Um dies zu veranschaulichen, ist wohl nichts besser geeignet als das weite Land der Liebe -nachzuvollziehen nicht nur in den unzähligen "Love-Stories" in Literatur, Film und Musik, sondern oft auch im wirklichen Leben.