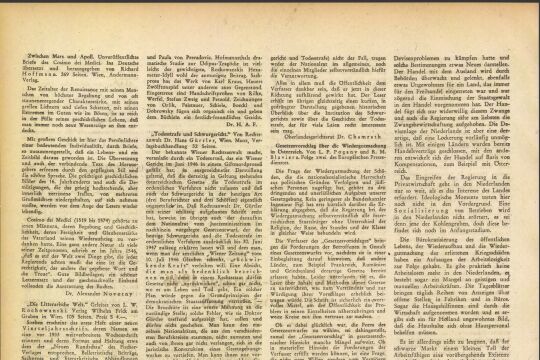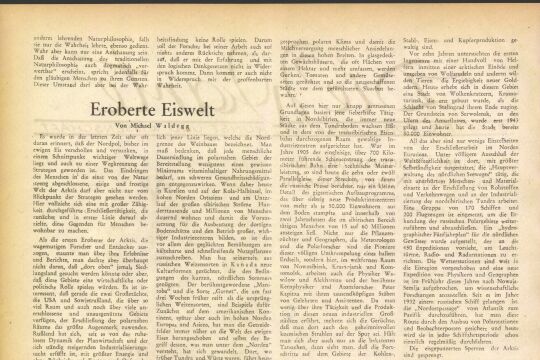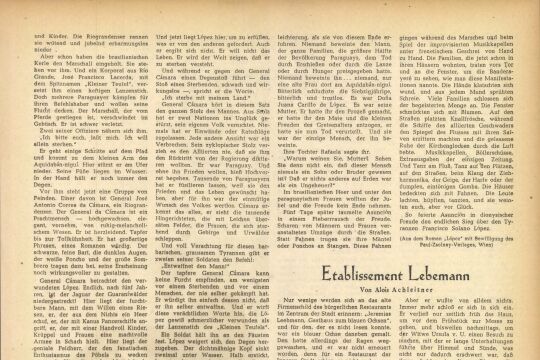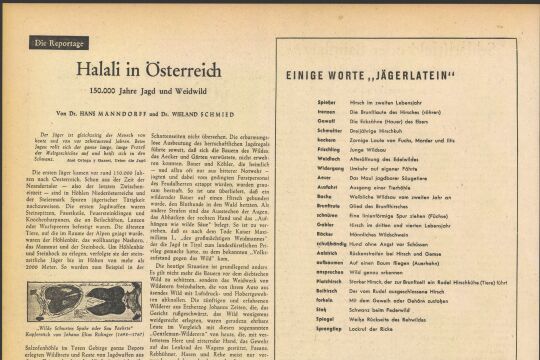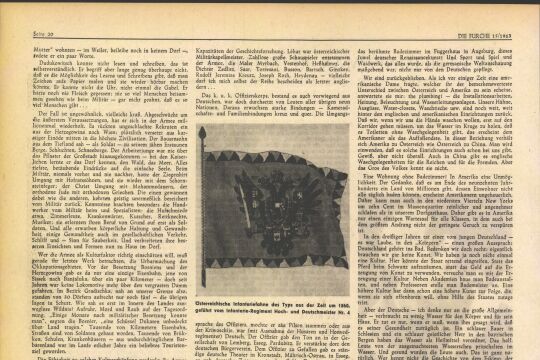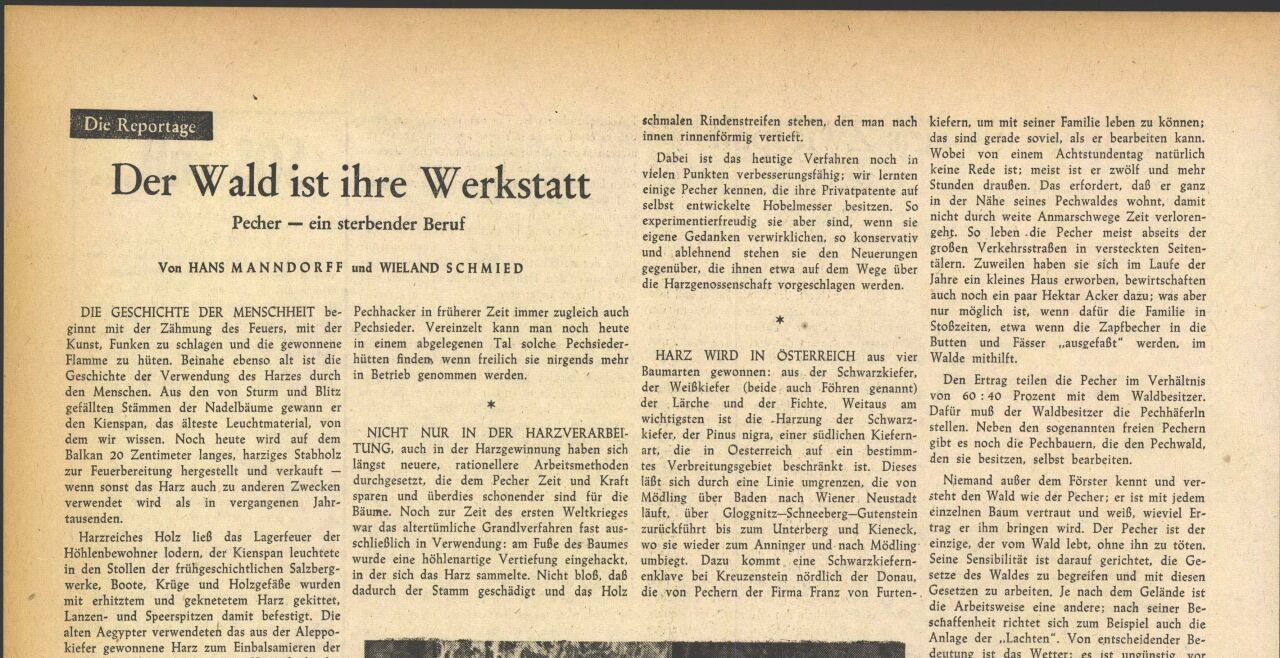
DIE GESCHICHTE DER MENSCHHEIT beginnt mit der Zähmung des Feuers, mit der Kunst, Funken zu schlagen und die gewonnene Flamme zu hüten. Beinahe ebenso alt ist die Geschichte der Verwendung des Harzes durch den Menschen. Aus den von Sturm und Blitz gefällten Stämmen der Nadelbäume gewann er den Kienspan, das älteste Leuchtmaterial, von dem wir wissen. Noch heute wird auf dem Balkan 20 Zentimeter langes, harziges Stabholz zur Feuerbereitung hergestellt und verkauft — wenn sonst das Harz auch zu anderen Zwecken verwendet wird als in vergangenen Jahrtausenden.
Harzreiches Holz ließ das Lagerfeuer der Höhlenbewohner lodern, der Kienspan leuchtete in den Stollen der frühgeschichtlichen Salzbergwerke, Boote, Krüge und Holzgefäße wurden mit erhitztem und geknetetem Harz gekittet, Lanzen- und Speerspitzen damit befestigt. Die alten Aegypter verwendeten das aus der Aleppo-kiefer gewonnene Harz zum Einbalsamieren der Leichen. Sie hatten eine eigene Hieroglyphe für den Harzfluß.
Griechen und Römer nahmen Harz für die Herstellung von Heilmitteln: schon früh wurde die heilende und desinfizierende Wirkung des Balsams aus Fichte, Tanne und Föhre erkannt. Harz ist Balsam für alle Wunden. Die Griechen im besonderen dichteten ihre Weinkrüge und -fässer mit Harz, und heute noch herrscht der Brauch, dem Wein etwas Harz zuzusetzen, um ihn zu konservieren.
Im Mittelalter fehlte Harz in keiner Alchemi-sten- oder Goldsucherwerkstatt; es wurde für die verschiedensten dunklen Zwecke destilliert. In den Klosterlaboratorien und Apotheken wurden Arzneien daraus hergestellt. Die mittelalterlichen Burgen hatten Pechnasen, aus denen siedendes Harz auf die Belagerer heruntergeschüttet wurde; die Angreifer wieder schössen in Pech getränkte Brandpfeile in die Festungen.
Die Verwendung, die das Harz heute findet, sieht nüchterner aus. Hier eine kleine Tabelle, die allerdings schon einige Jahre zurückliegt (entnommen dem Buch „Harzgewinnung in -Oesterreich“ von Dr. Karl Mazek-Fialla, Wien 1947). Demnach fanden die beiden Bestandteile des Harzes, Kolophonium und Terpentinöl, folgende Verwendung:
Kolophoniumverbrauch: Terpentinölverbrauch: Papierindustrie 48% Schuhcreme 55%
Lackindustrie 16% ' Lackindustrie 32%
Seifenherstellung 10% Anstreichergewerbe, Chemisch-technische Händler- und
Betriebe 8% Medizinalbedarf 13%
Linoleumherstellung 6% 100%
Buchdruck 3 %
Sonstiges 9%
100%
DIE HEIMAT DES HARZES, oder genauer: das Ursprungsland der systematischen Harzgewinnung durch den Menschen, sind die östlichen Randgebiete des Mittelmeeres; nach der Stadt Kolophon in Lydien hat das Kolophonium, der feste Bestandteil des Kiefernbalsams, seinen Namen. Von Kleinasien wanderte die Kenntnis der Harzgewinnung nach Spanien, Südfrankreich, Italien; aus allen diesen Ländern deckten die Römer ihren Harzbedarf. Heute sind die Vereinigten Staaten von Amerika, Rußland, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Oesterreich (in dieser Reihenfolge) die Haupt-harzungsländer der Erde; dazu kommen noch Indien, Indochina, Sumatra. Die Gesamtharzproduktion der Welt beträgt jährlich etwa 750.000 t Kolophonium und 250.000 t Terpentinöl.
In Oesterreich läßt sich die Harzung bis ins 14. Jahrhundert und weiter zurück verfolgen. Schon damals galt im Schwarzkieferngebiet Niederösterreichs die Harznutzung als Lebensgrundlage der bäuerlichen Waldbesitzer; sie half ihnen über Mißernten und Kriegszeiten hinweg, indes außerhalb immer wieder Bauernhöfe durch Landflucht verödeten.
Während heute die Pechbauern und freien Pecher in der Harzgenossenschaft in Piesting zusammengefaßt sind, die auch eine eigene Fabrik zur Vordestillation des Rohharzes in Kolophonium und Terpentinöl betreibt, waren die
Pechhacker in früherer Zeit immer zugleich auch Pechsieder. Vereinzelt kann man noch heute in einem abgelegenen Tal solche Pechsieder-hütten finderft wenn freilich sie nirgends mehr in Betrieb genommen werden.
NICHT NUR IN DER HARZVERARBEITUNG, auch in der Harzgewinnung haben sich längst neuere, rationellere Arbeitsmethoden durchgesetzt, die dem Pecher Zeit und Kraft sparen und überdies schonender sind für die Bäume. Noch zur Zeit des ersten Weltkrieges war das altertümliche Grandlverfahren fast ausschließlich in Verwendung: am Fuße des Baumes wurde eine höhlenartige Vertiefung eingehackt, in der sich das Harz sammelte. Nicht bloß, daß dadurch der Stamm geschädigt und das Holz entwertet wurde, verdunstete das Terpentinöl auf dem oft langen Weg zum Grandl. Denn dieses konnte man ja nicht, wie heute den „Zapfbecher“ von Jahr zu Jahr, mit dem Ansteigen der ..Lachte“, nachsetzen.
An die Stelle der alten Werkzeuge sind moderne getreten. Der Dexel, eine quergestellte Hacke, der dem Baum tiefe Wunden zufügte, ist fast nirgends mehr in Verwendung. Stattdessen wird, nachdem man im Frühjahr mit einem „Bügelschaber“ die grobe Rinde bis fast auf den Bast entfernt hat, allwöchentlich nur mit einem feinen Hobelmesser ein Schnitt von etwa vier bis fünf Millimeter Dicke durchgeführt. Es ist nötig, daß man so oft schneidet: denn nach etwa zwei bis drei Tagen stockt der Harzfluß und die Wunde verkient. Nach einer Ruhepause von vier Tagen kann man sie wieder öffnen.
Früher wurde der Harzbalsam durch in den Stamm gehackte I.eitspäne zum Pechhäferl geleitet; heute läßt man, wenn man im Frühjahr die Rinde entfernt („anrötelt“), einfach einen schmalen Rindenstreifen stehen, den man nach innen rinnenförmig vertieft.
Dabei ist das heutige Verfahren noch in vielen Punkten verbesserungsfähig; wir lernten einige Pecher kennen, die ihre Privatpatente auf selbst entwickelte Hobelmesser besitzen. So experimentierfreudig sie aber sind, wenn sie eigene Gedanken verwirklichen, so konservativ und ablehnend stehen sie den Neuerungen gegenüber, die ihnen etwa auf dem Wege über die Harzgenossenschaft vorgeschlagen werden.
HARZ WIRD IN ÖSTERREICH aus vier Baumarten gewonnen: aus der Schwarzkiefer, der Weißkiefer (beide auch Föhren genannt) der Lärche und der Fichte. Weitaus am wichtigsten ist die -Harzung der Schwarzkiefer, der Pinus nigra, einer südlichen Kiefernart, die in Oesterreich auf ein bestimmtes Verbreitungsgebiet beschränkt ist. Dieses läßt sich durch eine Linie umgrenzen, die von Mödling über Baden nach Wiener Neustadt läuft, über Gloggnitz—Schneeberg—Gutenstein zurückführt bis zum Unterberg und Kieneck, wo sie wieder zum Anninger und nach Mödling umbiegt. Dazu kommt eine Schwarzkiefernenklave bei Kreuzenstein nördlich der Donau, die von Pechern der Firma Franz von Furten-, bach (Wiener Neustadt) genutzt wird.
Die Weißkiefernharzung, die nicht so ertragreich ist, wurde nach dem zweiten Weltkrieg vor allem im Burgenland propagiert.
Der umsichtig geleiteten Piestinger Harzgenossenschaft ist die Intensivierung der Weiß-kieferharzung, vor allem in den Gebieten um den Geschriebenstein, zu danken. Hier wurden viele Flüchtlinge eingesetzt.
Das Lärchenharzungsgebiet erstreckt sich von der Südwestecke der Steiermark nach Osttirol. Gegenwärtig wird aber beinahe keine Lärchen-harzung mehr betrieben, obwohl der Lärchenbalsam, der nicht gerinnt, besonders kostbar ist.
Von der Fichte wird kein Flußharz gewonnen, sondern nur Scharrharz eingesammelt. Dieses bildet sich an Schälwunden der Fichte, die das Rotwild, dem die Fichtenrinde besonders gut schmeckt, verursacht.
WIE LEBEN DIE PECHER IN ÖSTERREICH? Ein Pecher braucht 2500 bis 3000 Schwarzkiefern, um mit seiner Familie leben zu können; das sind gerade soviel, als er bearbeiten kann. Wobei von einem Achtstundentag natürlich keine Rede ist; meist ist er zwölf und mehr Stunden draußen. Das erfordert, daß er ganz in der Nähe seines Pechwaldes wohnt, damit nicht durch weite Anmarschwege Zeit verlorengeht. So leben .die Pecher meist abseits der großen Verkehrsstraßen in versteckten Seitentälern. Zuweilen haben sie sich im Laufe der Jahre ein kleines Haus erworben, bewirtschaften auch noch ein paar Hektar Acker dazu; was aber nur möglich ist, wenn dafür die Familie in Stoßzeiten, etwa wenn die Zapfbecher in die Butten und Fässer „ausgefaßt“ werden, im Walde mithilft.
Den Ertrag teilen die Pecher im Verhältnis von 60 :40 Prozent mit dem Waldbesitzer. Dafür muß der Waldbesitzer die Pechhäferln stellen. Neben den sogenannten freien Pechern gibt es noch die Pechbauern, die den Pechwald, den sie besitzen, selbst bearbeiten.
Niemand außer dem Förster kennt und versteht den Wald wie der Pecher; er ist mit jedem einzelnen Baum vertraut und weiß, wieviel Ertrag er ihm bringen wird. Der Pecher ist der einzige, der vom Wald lebt, ohne ihn zu töten. Seine Sensibilität ist darauf gerichtet, die Gesetze des Waldes zu begreifen und mit diesen Gesetzen zu arbeiten. Je nach dem Gelände ist die Arbeitsweise eine andere; nach seiner Beschaffenheit richtet sich zum Beispiel auch die Anlage der „Lachten“. Von entscheidender Bedeutung ist das Wetter; es ist ungünstig, vor einem Gewitter einen Baum anzuhobeln; die günstigste Zeit sind die heißen Tage nach einem ausgiebigen Regen, die wichtigsten Monate Juli und August, wenn die Bäume richtig „schwitzen“. Was der Pecher in diesen Monaten an Arbeitszeit verliert, bringt er nie mehr ein. Der Pecher weiß auch, daß er die Bäume nur zart anschneiden darf; dringt er mit seinem Messer zu tief ins Innere, so scheint zwar im ersten Augenblick das Harz stärker zu rinnen, in Wahrheit aber verkient der Baum dann nachhaltiger und der Harzfluß stockt. - Man trifft oft seltsame Gestalten unter den Pechern. Klein, zäh, bärtig, das verwitterte Gesicht unter einem verhutzelten Hut versteckt, erinnern sie manchmal an die Waldgnomen des Mittelalters.
Flink wie Katzen klettern sie auf die Leitern (vom sechsten Jahr an kann jeder Baum nur noch mit der Leiter bearbeitet werden), fleißig wie Ameisen sammeln sie das Harz ein, um schließlich in der kalten, arbeitslosen Jahreszeit gleich Bären in den Winterschlaf zu ver-faBtö.j'ilj 'mit qMutyM&Mdis 1 Vm, iA.
STERBEN DIE PECHER AUS? Es gibt heute noch an die 5000 Pecher in Oesterreich. Aber es werden immer weniger. Wer selber einen Pechwald besitzt, wird zwar dabei bleiben, ihn zu bearbeiten. Viele der freien Pecher aber zieht es in die Nähe der größeren Ortschaften, zu den Lockungen der Zivilisation und zur Sicherheit eines festen Arbeitsplatzes. Pecher sind als fleißige Leute bekannt; sie werden in den Fabriken gerne genommen. Wer ein wenig im Schwarzkieferngebiet umherwandert, wird immer wieder auf Reviere stoßen, wo die Föhren nach ein paar Jahren stehengeblieben sind und nicht mehr geharzt werden. Die Pecher sind weggezogen. Neue Pecher, vor allem in den abgelegenen Gebieten, sind kaum zu gewinnen. Viele Bauern sind heute schon bereit, dem Pecher mehr als 60 Prozent des Ertrages zuzugestehen, um nur überhaupt jemanden zu bekommen. Aber auch das nützt oft nichts.
Das freie Pecherleben wirkt wie ein Relikt aus vergangener Zeit. Es liegt nur noch wenigen, auf ein unsicheres Einkommen, dessen Höhe von den verschiedensten Faktoren abhängt, zu warten. Auch muß' der Widerstand erwähnt werden, der von einzelnen Forstverwaltungen dem Pecher entgegengesetzt wird. Derzeit besteht noch ein Gesetz, das nur die Abholzung bereits geharzter Schwarzkiefern erlaubt. Dies soll aber auf Betreiben forstwirtschaftlicher Kreise geändert werden, weil derzeit der Holzpreis sehr hoch steht und nach Ansicht mancher sogar durch die schonendste Harzung eine gewisse Minderung des Holzwertes eintritt.
Auch unter verständnislosen Ausflüglern haben die Pecher zu leiden. Immer wieder veranstalten gedankenlose Großstädter „Preisschießen“ auf die Pechhäferln, und die Harzer sehen am Montag die Ergebnisse ihres Fleißes auf dem Boden liegen.
Nein, die Zeiten sind nicht günstig für den Pecher. Und doch gibt es viele, die um keinen Preis bereit wären, diesen Beruf aufzugeben; schon, weil sie sich ein anderes Leben gar nicht mehr vorstellen könnten. Wir sprachen mit einem Flüchtling, der nach dem Krieg einige Jahre als Pecher gearbeitet hatte und dann, der Kinder wegen, sich eine Arbeit in der Nähe einer Stadt gesucht hatte. Er sagte: „Es war die schönste Zeit meines Lebens.“