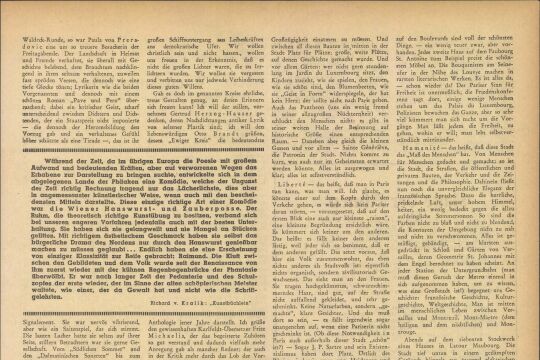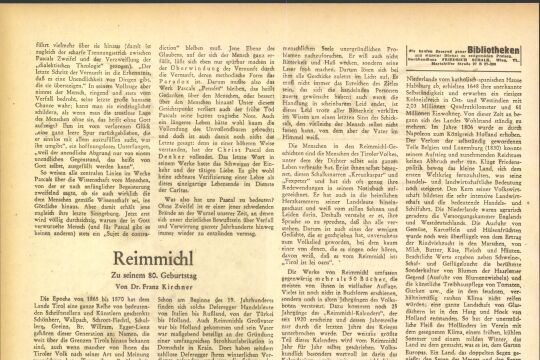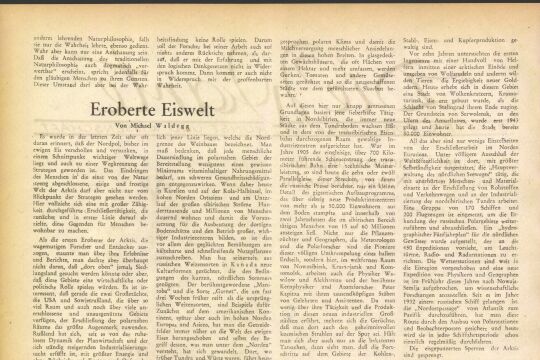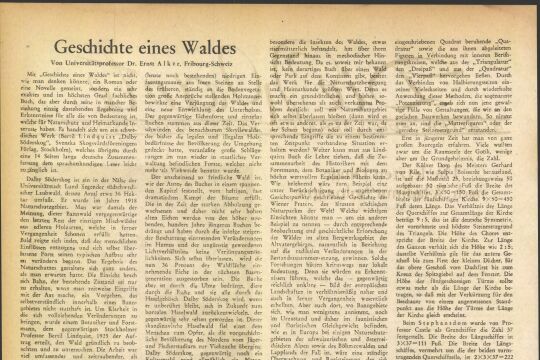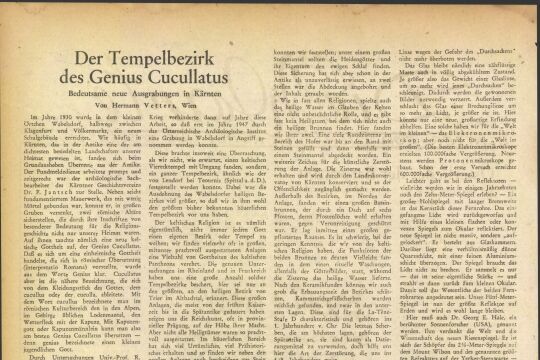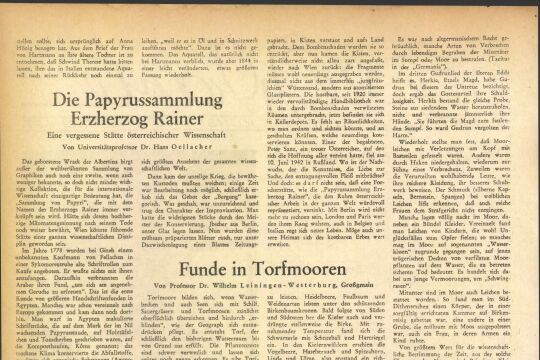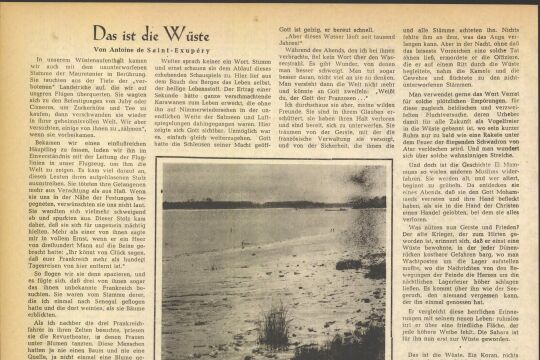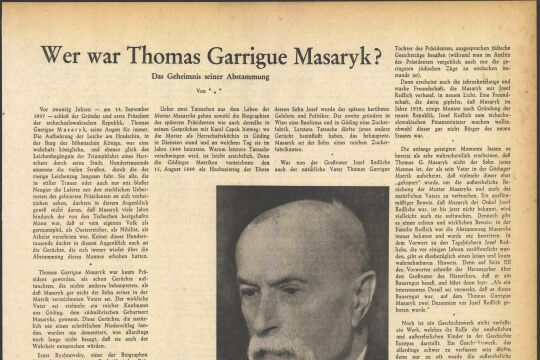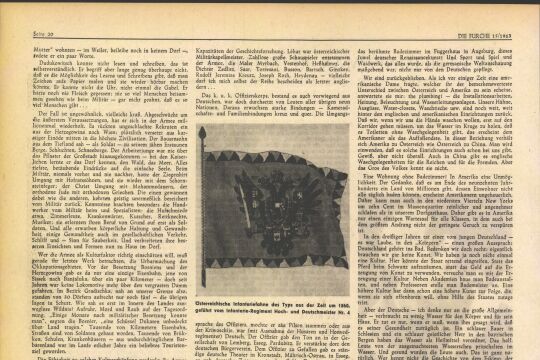Der Wald war die erste und lange die wertvollste Ressource des Menschen. Er ist Nährer - und fallweise auch Verteidiger. Die kulturhistorische Analyse einer Beziehung.
Seit Jahrtausenden ist die Menschheit aufs Innigste mit Wäldern verbunden, und zwar wirtschaftlich und kulturell. Holz war lange Zeit einer der wichtigsten Rohstoffe. Vor allem stabiles und widerstandsfähiges Eichenholz brauchte man zum Bauen von Häusern; als Brennholz und zur Herstellung von Werkzeug verwendete man auch andere Holzarten. Die eine eignete sich eher für Axtschäfte, eine andere zur Anfertigung von Pfeil und Bogen, wieder eine andere nahm man, wenn man Schüsseln schnitzen wollte. Schon vor mehr als 7000 Jahren kannte man sich bestens mit den Eigenschaften verschiedener Hölzer aus. Die damalige Jungsteinzeit wird von den Archäologen deshalb so genannt, weil man bei Ausgrabungen vor allem steinerne Gegenstände fand. Holz war zwar der viel wichtigere Werk- und Baustoff, hielt sich aber über die Jahrtausende meist nicht. Man müsste die Steinzeit eigentlich zur "Holzzeit“ rechnen. Sie dauerte noch länger an: Bronze- und Eisenzeit, ja selbst das Mittelalter sollten als weitere Teile der Holzzeit aufgefasst werden, der Ära also, in der Holz das wichtigste Material war, das Menschen verarbeiteten.
Wechselnde Siedlungsplätze
Bis zum Mittelalter bestanden Siedlungen nur für einige Jahrzehnte, dann wurden sie verlassen. Wir können nur vermuten, warum die Menschen immer wieder weiterzogen, um neue Siedlungen zu gründen. Wahrscheinlich bestand irgendwann eine Voraussetzung für ihr weiteres Leben am alten Wohnplatz nicht mehr. Ließen die Getreideerträge auf ausgelaugten Böden nach? Weil die Menschen damals beste Böden beackerten, ist dies wenig wahrscheinlich. Aber möglicherweise gab es am Siedlungsplatz nach einigen Jahrzehnten kein Bauholz mehr, mit dem man schadhafte, baufällige oder abgebrannte Hütten erneuern konnte. Man rodete eine neue Waldparzelle und baute das Holz an Ort und Stelle in neue Häuser ein. Der alte Siedlungsplatz blieb ungenutzt liegen; bald stellte sich wieder Wald ein. Er sah nicht in jedem Fall genauso aus wie derjenige, der vor der Gründung der Siedlung abgeholzt worden war. In den neuen Wäldern gab es zunächst viele Birken, dann wieder Eichen, aber es gesellten sich weitere Bäume hinzu: Buchen, die heute viele mitteleuropäische Wälder prägen.
Als die Römer in der Zeit um Christi Geburt ins Gebiet nördlich der Alpen vordrangen, stießen sie auf Menschen, die sie für Waldbewohner hielten; Tacitus berichtete dies über die Germanen. Es gelang den Römern nicht, in den großen Waldgebieten eine Infrastruktur von Verwaltung und Handel aufzubauen. Die brauchte man aber, wenn Siedlungen, wie im römischen Reich üblich, ortsfest bleiben sollten. Sie mussten dann, wenn es an lebensnotwendigen Gütern wie beispielsweise Holz mangelte, über eine Handelsinfrastruktur versorgt werden können.
Rohstoff-Ressource
Die Ausbreitung des Imperium Romanum ging zu Ende, und die Römer zogen sich aus vielen zuvor unterworfenen Gebieten wieder zurück. Im Mittelalter breitete sich dann aber die ortsfeste Siedelweise endgültig in weiten Teilen Europas aus. Damit war eine Intensivierung der Landbewirtschaftung verbunden. Wald wurde immer weiter zurückgedrängt; vor allem in Städten wurde ungeheuer viel Holz gebraucht. Im Inneren des Kontinentes konnte man mit Holz gutes Geld verdienen, indem man es schlug, die Flüsse hinunter triftete oder flößte und es dann in den Hafenstädten am Meer verkaufte. Besonders gut ließ sich mitteleuropäisches Holz in den Niederlanden und in Norditalien absetzen, beispielsweise in Venedig. In den Ostalpen, im böhmischen und sächsischen Erzgebirge, im Harz und im Schwarzwald baute man im Mittelalter reiche Erzvorkommen ab. Zum Verhütten des metallhaltigen Gesteins brauchte man große Mengen an Holz. Viel Holz wurde auch zum Kalkbrennen, in Glashütten und Köhlereien benötigt. Die Wälder wurden immer weiter zurückgedrängt.
Schließlich, im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert, stellte man fest, dass es so mit dem Raubbau an den Wäldern nicht weitergehen konnte. Man war sich darüber im Klaren, dass man auch in Zukunft noch Wald nutzen musste, daher durfte nicht allzu rücksichtslos abgeholzt werden. Diese Forderung findet sich unter anderem in der "Sylvicultura oeconomica“, die der sächsische Oberberghauptmann Hannß Carl von Carlowitz 1713 verfasste. Für viele gilt er als der erste Förster; aber er hatte eigentlich eine andere Aufgabe: Er befasste sich mit dem Bergbau im Erzgebirge. Dazu gehörte auch die Beschaffung von Holz für die Erzverhüttung. Carlowitz bekräftigte seine Forderung, Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, mit dem Hinweis auf Tacitus, der von den weiten Wäldern der Germanen gesprochen hatte. Diese Wälder sollten wieder erstehen!
Umdenken im 19. Jahrhundert
In den folgenden Jahrzehnten wurde nach allen Regeln der Kunst versucht, Mitteleuropas Wälder zu schonen und neue Gehölzbestände aufzubauen, was dank einer damals neu eingesetzten Forstverwaltung in vielen Gegenden auch gelang. An der Wende zum 19. Jahrhundert kam noch ein weiterer Grund hinzu, warum man Wälder pflanzte. Damals stießen Napoleons Truppen nach Mitteleuropa vor. Man verglich die Franzosen mit den alten Römern, waren doch beide "Romanen“. Man forderte damals allen Ernstes, an der Grenze zu Frankreich Wälder zu pflanzen, in denen sich die Franzosen verlaufen sollten. Caspar David Friedrich malte nach der Völkerschlacht von Leipzig, in der die Franzosen vernichtend geschlagen worden waren, den "Chasseur im Walde“: Ein geschlagener französischer Soldat irrt durch aufgeforsteten Fichtenwald.
Vor allem die Deutschen, deren Wünsche nach nationaler Erneuerung auf dem Wiener Kongress nicht erfüllt wurden, befassten sich danach mit ihrer anderen "patriotischen Aufgabe“, der Pflege von Wäldern. Förster bauten sie auf, Dichter verherrlichten sie, Grimms Märchen sind ohne sie nicht denkbar, Münzen wurden mit Waldsymbolen verziert. Damals ging auch die Holzzeit zu Ende: Mit Dampfmaschinen kam man an tief im Untergrund liegende Kohle heran, wenig später begann man, Erdöl zu fördern. Endlich konnte man mit anderen Rohstoffen heizen und brauchte auch in den Erzhütten kein Holz mehr. Wälder konnten geschont werden.
Bald nahm man aber neue Probleme wahr, Wälder litten unter dem Einfluss von Luftschadstoffen. Ein Aufschrei ging durch die Lande, als man Anzeichen eines Waldsterbens sah. Vor allem die Mitteleuropäer machten sich Gedanken um "ihren“ Wald, während sich die Franzosen über "le waldsterbén“ amüsierten. Um das Waldsterben zu bekämpfen, wurden erheblich strengere Umweltstandards entwickelt. Dank Filtern und Katalysatoren ist unsere Luft sauberer geworden. Eigentlich sollte damit der Wald geschützt werden, aber wir haben uns so selbst etwas Gutes getan. Nachhaltige Waldnutzung in vielen Industrieländern konnte in den letzten beiden Jahrhunderten vor allem dank Kohle und Erdöl durchgesetzt werden, auch leider dadurch, dass man Regenwälder abholzte. Für unser nachhaltiges Überleben brauchen wir nun aber neue Konzepte. Möglicherweise wird die Nutzung des einheimischen Waldes wieder zunehmen müssen. Im Internationalen Jahr des Waldes 2011 sollte man sich bewusst machen, dass Wälder nicht nur Natur sind, sondern auch wichtige Bestandteile unserer Kultur: Sie sind überlebenswichtig für die Menschheit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!