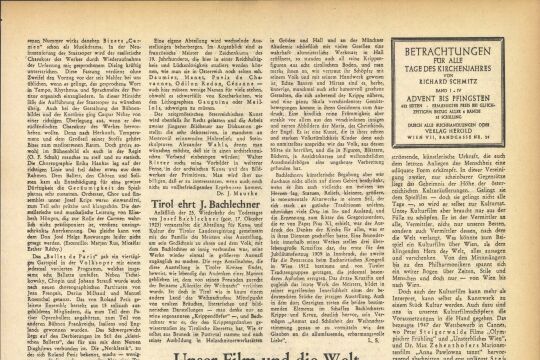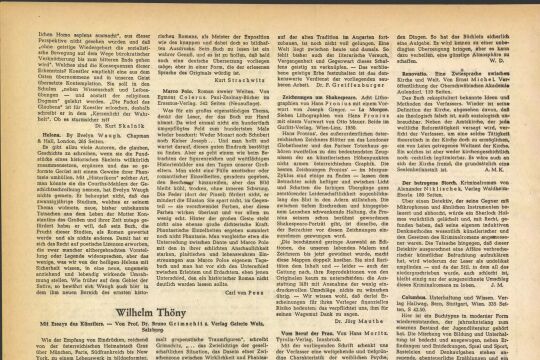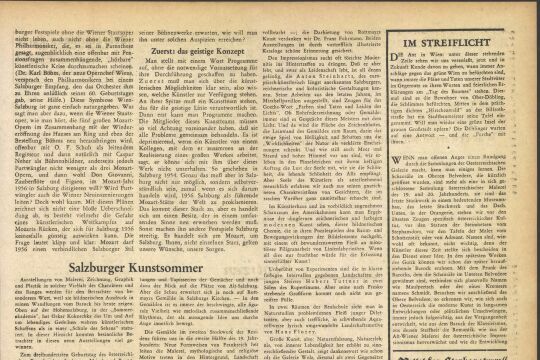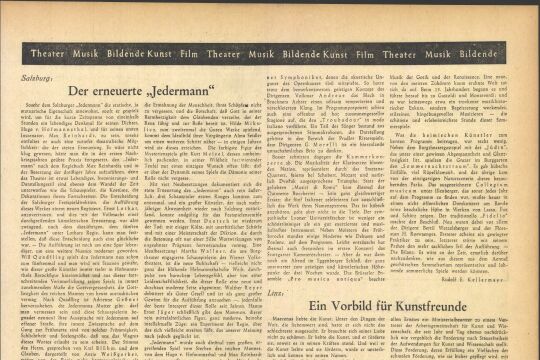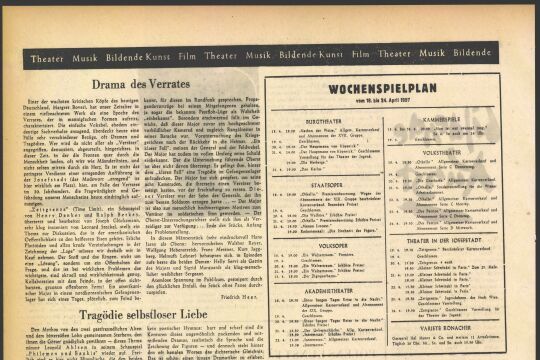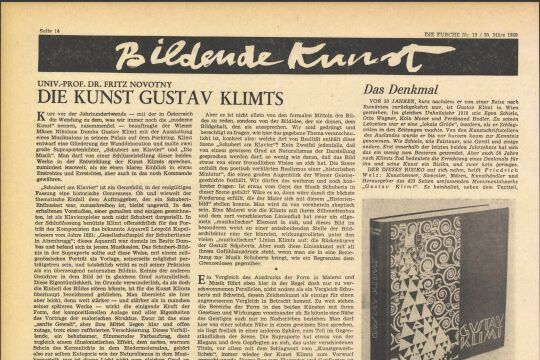Bei vielen jener prächtigen Ringstraßenbauten, für die Wien berühmt ist, wurde bulgarischer Muschelkalk verwendet. Mit demselben Stein ist auch das Leopold Museum im Wiener Museumsquartier verkleidet - das architektonische Prachtstück und zugleich die bedeutendste Institution des neuen Kulturbezirks, der in den letzten Wochen sukzessive seine Pforten für Kulturinteressierte öffnete.
In ein paar Jahren wird sich der Kunstinteressierte gar nicht mehr vorstellen können, dass es das Leopold Museum jemals nicht gegeben hat; das Leopold Museum nämlich ist das Museum für die klassische österreichische Moderne schlechthin, es ist ein nicht mehr wegzudenkender Teil unseres kulturellen Erbes. Rund 600 Gemälde, 400 Graphiken sowie 300 kunstgewerbliche Gegenstände umfasst die Erstpräsentation jener Sammlung von insgesamt 5.266 Objekten, die der leidenschaftliche Kunstsammler Rudolf Leopold im Laufe eines halben Jahrhunderts zusammengetragen und 1994 in die Leopold Museum Privatstiftung eingebracht hat. Im Zentrum: die legendäre Egon-Schiele-Sammlung mit den meisten zentralen Werken des österreichischen Expressionisten. Dazu kommen bedeutende Hauptwerke von Oskar Kokoschka, Richard Gerstl, Albin Egger-Lienz, Alfred Kubin oder Anton Kolig sowie eine üppige Kollektion österreichischer Gemälde des 19. Jahrhunderts. Die Sammlung enthält aber auch Kunstgewerbe, vor allem des Jugendstils und der Wiener Werkstätte, was die Eingangsebene mit Werken von Gustav Klimt, Kolo Moser, Adolf Loos oder Josef Hoffmann zu einem veritablen Jugendstilmuseum macht.
Bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus wurde die Wiener Moderne als skandalös empfunden und wenig geschätzt. Insbesondere Egon Schiele galt international als lokales Talent, hierzulande wurden viele seiner Werke als pornografisch, ja sogar - in bester Nazi-Tradition - als "entartet" eingestuft. Diese ablehnende Haltung ermöglichte es nach dem Ende des zweiten Weltkriegs dem mittellosen Medizinstudenten und späteren Augenarzt Rudolf Leopold, aus dem finanziellen Nichts eine einmalige Kunstsammlung aufzubauen, die 1994 auf 7,9 Milliarden Schilling geschätzt wurde. Heute würde die Schätzung zweifellos noch höher ausfallen. Einige der im Leopold Museum ausgestellten Bilder würden am freien Kunstmarkt jederzeit mehr als jene 400 Millionen Schilling erzielen, die der Bau des Museums gekostet hat.
"Ich erkenne einen gefälschten Schiele innerhalb weniger Sekunden", sagt Leopold - was wohl dran liegt, dass es kein Bild von Schiele gibt, das er nicht kennt. Dass Schiele national und international die ihm gebührende Anerkennung gefunden hat, ist zum größten Teil seinem eifrigen Sammler zu verdanken. Mit Schieles Ruhm wuchs auch der Wert der Sammlung, die Leopold 1994 schließlich in eine Privatstiftung einbrachte. Dafür verpflichteten sich die Republik Österreich und die Österreichische Nationalbank zum Bau eines Museums für die Sammlung sowie zur Zahlung von 2,2 Milliarden Schilling an Leopold, in Raten bis 2007.
Der Bau ist - ganz im Gegensatz zu seinem Pendant, dem Museum moderner Kunst, dessen zu niedrige Räume durch Fluchttüren, Notausgangsleuchten und ähnliches verunstaltet sind - architektonisch gelungen: ein klarer, sachlicher, dennoch monumentaler Kubus, der schon nach außen jene Helligkeit ausstrahlt, die im Inneren für ideale Lichtverhältnisse sorgt. Das Tageslicht, das schon das eindrucksvolle 19 Meter hohe Atrium durchflutet, beleuchtet auch zentrale Werke der Sammlung - so im Schiele-Saal im dritten Obergeschoß.
Dort, ganz oben, könnte der Besucher auch einen ersten, überblicksmäßigen Rundgang beginnen. Sich einigen ausgewählten Werken und Werkkomplexen intensiv widmend, an den anderen Werken huldvoll vorbeischlendernd. Inmitten einer ungeahnten Fülle von Werken Schieles, in denen das Leid geschundener Kreaturen in qualvoll verzerrte Konturen gepresst ist: "Tote Mutter" (1910), "Eremiten" (1912), "Kardinal und Nonne" (1912) und, und, und ... Dann: einen Stock tiefer, der Egger-Lienz-Saal. Des Tirolers bedrohliche, archetypisch ins Monumentale übersteigerte Szenen aus dem Landleben: "Bergmäher" (1907), "Die Schnitter bei aufziehendem Gewitter" (um 1922) ... Vielleicht noch Jehudo Epsteins "Michiko Meinl" (1929). Anschließend ins Erdgeschoß, durch die zwei Jugendstil-Säle. Ein Werk von Klimt: "Tod und Leben" (1910/15), eine Art gothic Version des "Kusses". Erstes Untergeschoß: massenweise zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, drei Bilder von Ferdinand Georg Waldmüller ziehen mit ihren leuchtenden Farben das Auge des Schlenderers an, dann das nagende "Bildnis Isabella Reisser" (1885) von Anton Romako. Schließlich, im dunklen zweiten Untergeschoß, die Zeichnungen - welch ein Schatz! Abermals Schieles ausgezehrte Figuren, erotische Bleistiftzeichnungen von Klimt, berühmte Allegorien von Kubin. Und dann: sich auf den nächsten Besuch freuen.
125 Schilling kostet der Eintritt. "Wir sind stolz darauf, das teuerste Museum Wiens zu sein", sagt Christian Meyer, Vorstandsmitglied der Museum Leopold Privatstiftung. Nicht nur gesundes Selbstbewusstsein, sondern auch wirtschaftliche Gründe sind für den hohen Eintrittspreis verantwortlich: die Subvention des Bundes reicht bei weitem nicht zur Deckung der laufenden Kosten. Geld ist Mangelware im Leopold-Museum - sehr zum Ärger von Rudolf Leopold: "Was für ein krasses Missverhältnis: eine halbe Million Ankaufsbudget und fünf Millionen Werbebudget", empört sich der Stifter und Direktor des Museums. Im Stiftungsgesetz steht zwar, dass 15 Millionen Schilling jährlich für Ankäufe zur Verfügung stehen sollen - doch Leopold musste leider erkennen, dass er bei den Verhandlungen die juristische Bedeutung des Wörtchens "sollen" übersehen hatte ...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!