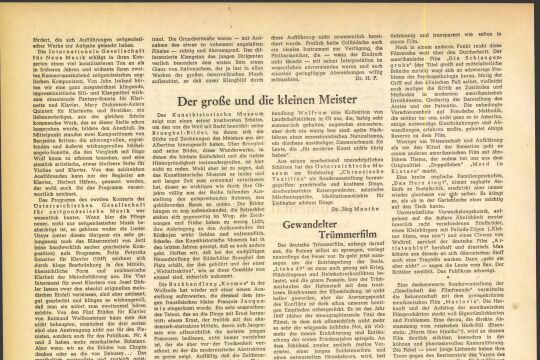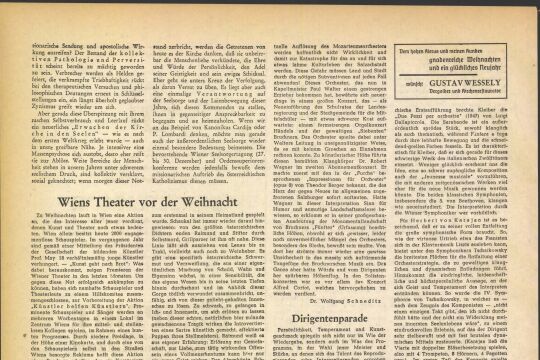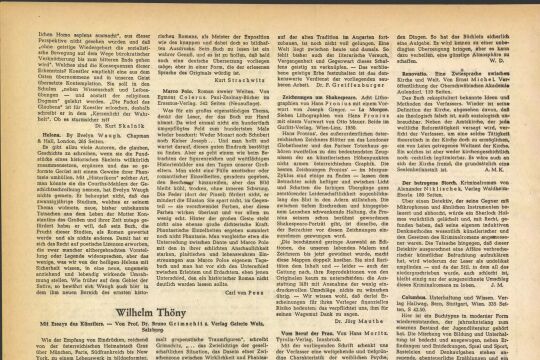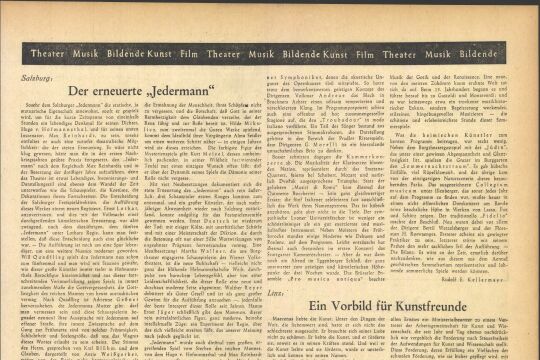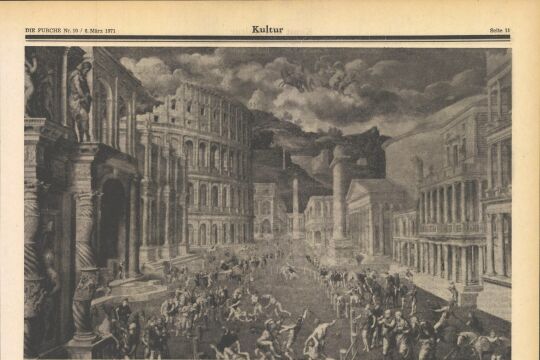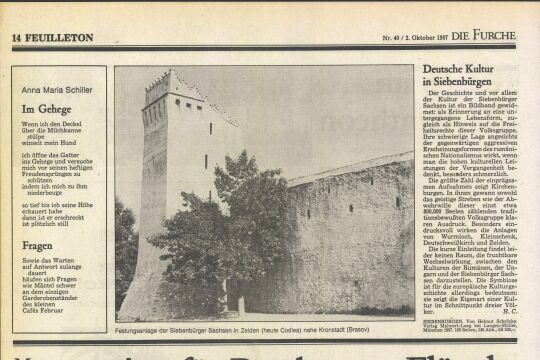Rudolf Leopold wird auch künftig nicht zur Ruhe kommen: Als Sammler und Museumsleiter will er es nicht, als zentrale Figur in Sachen Restitution kann er es nicht.
Es begann unspektakulär: In seiner Kindheit sammelte Rudolf Leopold Schmetterlinge, weil ihn die „Vielfalt und Harmonie ihrer Farben begeisterte“. Durch seine Begabung, erstklassige Kunst zu erkennen, auch wenn der betreffende Künstler zu dieser Zeit weder berühmt noch anerkannt war, habe er 1950 für sich den Künstler Egon Schiele entdeckt. Er sammelte seine Bilder und Blätter, auch wenn er deswegen „verspottet und verlacht“ worden sei. So trug er aus dem Nichts die bedeutendste Schiele-Kollektion zusammen und verwirklichte ein eigenes Museum, dem er als Direktor auf Lebenszeit vorsteht. Es sei der Drang nach Ewigkeit, der einen Sammler antreibt, sagt Leopold heute: „So wie der jung verstorbene Maler Absolon es ausdrückte: ‚Ich möchte dem Nichts etwas entgegensetzen.‘“
„Jede Leidenschaft grenzt ja ans Chaos, die sammlerische aber an das der Erinnerungen“, schrieb Walter Benjamin über den Trieb, dem er selbst verfallen war. Um Erinnerung geht es auch Rudolf Leopold. Ursprünglich habe er nicht an ein Museum gedacht, sagt der frühere Augenarzt und Kunsthistoriker, „sondern dass die Sammlung zusammen erhalten bleibt“, und es war die Freude am Sammeln selbst: „Das ist vielleicht der archaische Trieb des Jagens. Es sind wahrscheinlich die 30.000 Jahre Männergeschichte als Jäger noch lebendig, und es macht mir weiterhin einen ungeheuren Spaß.“
„So etwas Degeneriertes“
Eine Freude, die er sich auch in turbulenten Situationen nicht nehmen ließ, und davon gab es in seinem Leben viele. Als der junge Mediziner in den fünfziger Jahren leidenschaftlich Schiele sammelte, war der Maler alles andere als geschätzt, galt bestenfalls als regionales Talent. „Damals haben mich die Leute als Narr bezeichnet, der diesen pornografischen Künstler sammelt“, erinnert sich Leopold: „Im Dorotheum hat ein Händler über Schieles großen Leinwandakt von 1910 gesagt, so etwas Degeneriertes, das gehört von der Wand heruntergerissen und verbrannt.“ Leopold jedoch vertraute seinem Blick, ersteigerte dieses Bild und sammelte weiter Schieles Werke: „Ich habe mir damals nur gedacht, entweder bin ich der Depp oder die anderen.“ Dabei empfinde er sich nicht als eigensinnig: „Ich glaubte einfach, erkannt zu haben, dass Schieles Blätter und Bilder großartige und einmalige Werke sind.“
Leopolds Vater war ein bedeutender Agronom, aber nicht kunstsinnig und interessierte sich bloß für Naturwissenschaften. Deswegen führte er seinen Sohn nie ins Kunsthistorische, sondern immer nur ins Naturhistorische Museum. Leopolds Talent für Musik und darstellende Kunst kam zweifellos von seiner Mutter, die „gut aquarellierte und am Klavier ‚Schlager‘ trefflich vortrug“, während ihr Sohn Rudolf Werke von Mozart, Beethoven und Schubert am Klavier spielte. Die Bilder an den Wänden der Wohnung seiner Mutter entsprachen bloß dem bürgerlichen, aber nicht Leopolds Geschmack. Aus eigenem Antrieb besuchte er mit 23 Jahren, im Herbst 1948, erstmals das Kunsthistorische Museum. Dort entdeckte er, dass die Schönheit der Natur auch in der Kunst, aber parallel zu ihr, zu finden sei. Damals entschloss er sich sofort, Bilder zu sammeln.
Motorrad statt VW
Sein Medizinstudium litt unter seiner neuen Leidenschaft: Neben seiner Sammlertätigkeit hatte Leopold auch noch begonnen, Kunstgeschichte zu studieren. Dadurch verzögerte sich sein Medizinstudium, was seine Mutter als Schande betrachtete, da ihr Sohn in der Mittelschule stets der beste Schüler war – ohne ein sogenannter Streber zu sein. Deswegen versprach sie ihm, einen Volkswagen zu kaufen, wenn er sein Medizinstudium noch vor den nächsten Sommerferien abschließe. Leopold beendete das Studium rechtzeitig, nahm das Geld, erwarb die „Eremiten“ und fuhr weiter mit seinem Motorrad.
1994 brachte Leopold seine Sammlung in eine Privatstiftung ein, für die Bund und Nationalbank zusammen 28 Prozent des damals geschätzten inländischen Wertes zahlten. Für die Sammlung errichtete der Staat das Leopold-Museum. Mehr als 300.000 Besucher werden jährlich im Museumsquartier von der Schiele-Sammlung und wechselnden Ausstellungen angezogen. Dabei kämpfe die Stiftung mit einem seit der Eröffnung des Museums 2001 „ohne Valorisierung“ stagnierenden Budget von 2,7 Millionen Euro jährlich, das bei steigenden Personal- und Betriebskosten keine Ankäufe zulasse. „Der Leiter der National Gallery in London sagte richtig: ‚Ein Museum ohne Ankaufsbudget ist wie ein Auto ohne Benzin.‘ Neben dem fehlenden Ankaufsbudget tobt eine von Dr. Muzicant geschürte Restitutionsdebatte rund um die Sammlung“, erklärt Rudolf Leopold.
Mit der Errichtung der Stiftung wurde er zu einem großen österreichischen Mäzen des 20. Jahrhunderts. Das hat ihm Bewunderer, aber auch viele Neider und Gegner eingebracht. Ruhe wird es daher für ihn noch länger nicht geben. Vor zweieinhalb Jahren habe ihm Ministerin Claudia Schmied in Kürze ein Vieraugengespräch versprochen, dies aber bis heute nicht eingelöst: „Ich bin eben bei den Politikern nicht beliebt, die die Wahrheit nicht hören wollen. Andere wieder schätzen sowohl mich als einen, in der ganzen westlichen Kunstwelt anerkannten Experten, als auch die von mir erbrachte Leistung.“ Auf seine Zukunft angesprochen, weiß Leopold, was ihn antreibt: „Ich würde lieber sammeln und Ausstellungen vorbereiten, als mich ewig mit zum Großteil ungerechtfertigten Restitutionsanforderungen herumschlagen.“
Bilder auf sich wirken lassen
Für den Künstler Leopold Hauer veranstaltete Rudolf Leopold als Kurator die derzeit laufende Retrospektive. Mit ihm verband ihn auch eine persönliche Freundschaft. Er schätzt an Leopold Hauer, dass er sich nicht dazu verleiten ließ, seinen realistischen Malstil zu ändern, nur um „modern“ zu sein. Auch ein Bild, dessen Stil nicht im Mainstream liegt, könne ein gutes Werk sein. Hauers Zuwendung zu einfachen Dingen wie Brettertüren, Steinen oder verfallenen Fenstern zeige eine Poesie des Alltags und bringe Schönheit zutage, die gewöhnlich übersehen werde. „Hauers Zeichnungen und Aquarelle entstanden häufig auf Reisen in Jeep und Wohnwagen an südlichen Küsten. Sie gehören zum Feinsten ihrer Art.“
Leopold kennt die Turbulenzen eines Sammlerlebens, und doch sei es schwierig, jungen Sammlern eine Empfehlung mit auf den Weg zu geben. Zu individuell sind die Vorlieben, zu unberechenbar der Kunstmarkt. „Aber ich würde ihnen auf alle Fälle raten, sich nicht nach Reproduktionen oder Fotos zu entscheiden oder nur über Kunst zu lesen und zu lesen. Das Wichtigste für einen Sammler ist, in Museen zu gehen, Bilder auf sich wirken zu lassen und zu vergleichen. Daraus kann sich ein Verständnis entwickeln.“
Auch nach der Eröffnung des Museums hat Leopold privat weiter gesammelt. Der Gegenwert seiner neuen Sammlung dürfte längst wieder beträchtlich sein, die Zukunft des Verbleibs ist noch ungewiss.
Das wichtigste Werk jeder Sammlung scheint jenes zu sein, das ihr noch fehlt, lautet eine alte Sammlerweisheit. Dem will Leopold zwar nicht gleich zustimmen, meint dann aber unumwunden: „Ich hätte natürlich gern einen Rembrandt, einen Vermeer, einen Van Gogh oder einen Cézanne. Aber dazu fehlen mir nicht nur die Mittel. Die meisten ihrer Hauptwerke sind längst fester Museumsbesitz.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!