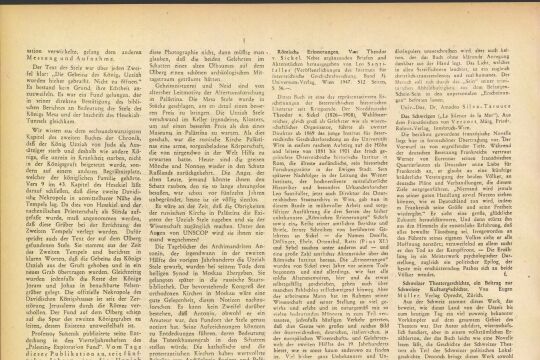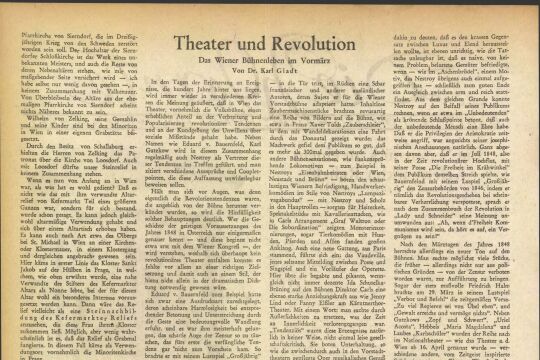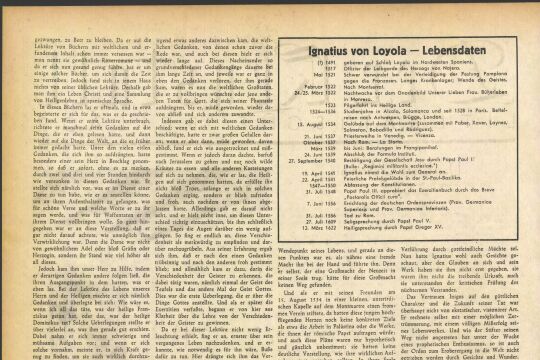Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
An der Orgel des Himmels
JOHANNES KEPLER. Dramatisches Gedicht in einem Vorspiel und acht Bildern. Von Arthur Fischer-Colbrie. Oberösterreichischer Landesverlag, Linz. 150 Seiten. Preis 38 S.
„Wenn man Keplers Lebensgeschichte mit demjenigen, was er geworden und geleistet, zusammenhält“, schreibt Goethe in der fünften Abteilung des historischen Teiles seiner Farbenlehre, „so gerat man in ein frohes Erstaunen, indem man sich überzeugt, daß der wahre Genius alle Hindernisse überwindet.“ Und gleich darnach: „Ändern sei es überlassen, seine Verdienste anzuerkennen und zu rühmen, welche außer unserm Gesichtskreise liegen: aber uns ziemt es, sein herrliches Gemüt zu bemerken, das überall auf das freudigste durchblickt.“
„Ändern sei es überlassenᾠ" Wem anderen denn gleich, als den Dichtern, wem anderen als einem, der aus jener Stadt stammt, in der Kepler gewirkt hat: aus Linzi Dorthin war 1612, wie geschichtlich bezeugt ist, der Astronom, Mathematiker und Begründer der geometrischen Optik, nachdem er vorher schon in Graz und Prag tätig gewesen, als Lehrer für Mathematik gegangen. In Linz hat Kepler sein bedeutendstes Werk, „Harmonices mundi libri V“, veröffentlicht, wobei er das dritte Keplersche Gesetz fand. In diesem Manne, der wegen seines Bekenntnisses zum Kopemikani- schen System in Gegensatz zu beiden christlichen Kirchen geriet, vereinte sich naturwissenschaftlicher, gründlicher Forschungsgeist mit echter Religiosität. Kepler ist lange hindurch verkannt worden.
Aber nicht so sehr um sein Wirken als Gelehrter geht das vorliegende dramatische Gedicht, das — in etwas anderer Form — seine Uraufführung 1950 im Landestheater Linz erlebt hat, sondern mehr darum, zu zeigen, wie in einer Welt, die von Krämpfen geschüttelt wurde, in einer Welt des Hasses und der Vernichtung, sich gegen die Dissonanz die Konsonanz durchsetzt, wie ein gewaltiger Geist vor die Schöpfung in Demut hintritt und zuletzt die Harmonie der Welt erlauscht.
Fischer-Colbrie hebt das Geschehen von Anbeginn her an den Quell des Überirdischen. Ihm ist Keplers Lebenskampf zugleich Kampf mit den dunklen Mächten. Der Feind alles Hellen — er heißt einfach: der Widersacher — erfährt doch eine Niederlage.
Das Vorspiel in der „mythischen Landschaft“ ist nicht mehr und nicht weniger als der Anruf des Allgegenwärtigen an eine gehorsame Seele, Verkünder der Wunder des Himmels zu sein und Zeuge zugleich der Herrlichkeit und Macht des Schöpfers. Was immer auf dem Erdenwege die zum Dulden und Leiden berufene, in den vergänglichen Körper des Dieners Kepler versetzte Seele erfährt,1 es ist ein Gleichnis des Irdischen, ein Hinweis auf Überweltliches. So gesehen ist also diese Dichtung eine Bekenntnisdichtung, ein Weltgedicht.
Gewiß: wie alle Dichtung bisher, sobald sie sich mit Kepler befaßt hat, beschäftigt sich auch diese mit Keplers Beziehungen zu den Großen der Welt. Aber das ist hier durchaus folgerichtig; diese Großen der Erde sind nur Gleichnisse. Die Menschen einer Zeit, in der Astronomie und Astrologie kaum zu trennen waren, konnten in einer Persönlichkeit, die sich dem Geschick unterwarf und die Sterne nicht als Werkzeuge für die Prophetie, sondern als Zeugnisse des Weltbaumeisters ansah, kein Genüge finden. Das ergibt den tragischen Gegensatz dieser Zeit zu dem großen Astronomen, der seinen Mitlebenden weit voraus war, ergibt den ewigen tragischen Gegensatz, der nie aus der Welt weichen wird, den Gegensatz der Tradition und des Fortschritts. Hierzu tritt noch ein Thema, das die Dichtung, wenn es um Kepler ging, immer gerne aufgriff: das Verhältnis zur Mutter, das von besonderer Innigkeit war. Fischer-Colbrie bedeutet es einen Ton im Akkord dieses Lebens, einen Ton, von dem tiefste Ergriffenheit ausgeht. Vielleicht sieht sich der Dichter in der Mutter den Müttern nahe; was Leben gibt, was Leben ernährt, was um das Leben des Sohnes bangt, ist Urquell des Werdens und darf wieder als Symbol gelten.
In weitgehendem Maße hat sich der Autor an die geschichtlichen Tatsachen gehalten — ob es nun um die in einen Hexenprozeß verwickelte Mutter geht, ob um die Beziehungen zu Wallenstein, ob um die schließlich bis auf die phantastische Summe von 12.000 Dukaten angewachsene Gehaltsschuld der kaiserlichen Hofkammer an Kepler oder um die Ursache des Todes Keplers — bei ungünstigem Wetter, zur Herbstzeit, war er nach Regensburg gereist, um vor dem Reichstag seine Geldforderungen (er lebte in den drückendsten Verhältnissen) geltend zu machen.
Die Sprache dieser Dichtung, von der man nur hoffen möchte, sie auf der repräsentativen Bühne Österreichs, im Burgtheater, zu sehen (schade, daß Hinde- mith bei der Abfassung seiner Oper sich nicht an diesen eminent dichterischen Text gehalten hat), diese Sprache, in der alle Regungen des Gefühls schwingen, von vielen poetischen Gleichnissen wundersam durchwebt, ist in der Gesetzmäßigkeit der fünffüßigen, gereimten Jamben für sich bereits sinnvolle Harmonie der Welt. Auch für diese Dichtung kann gesagt werden, was Keplers Engel am Schlüsse des Stückes verkündet: „Und brausend von der himmlischen Empore, grüßt sie der Gottesorgel ewige Fuge!“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!