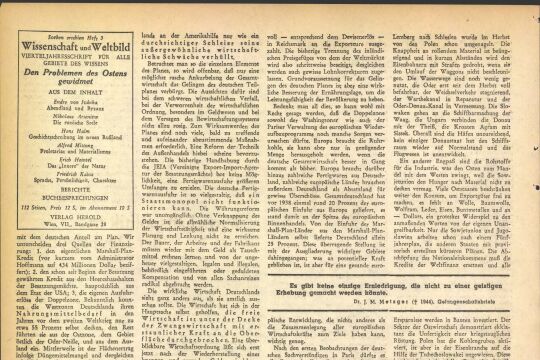Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das kranke Herz Europas
„Die Deutschen machen eine miserable Politik, aber sie können arbeiten. Wenn ihre Generäle bessere Politiker gewesen wären, dann hätten wir keinen Kommunismus im Land.“ Der Prager Ingenieur sagte es ohne Bitterkeit. Vor uns stand das granitene Mahnmal der 1. amerikanischen Panzerarmee des General Patton, nur wenige Kilometer vom Eger entfernt. Und nur wenige Meter von dem Sexaeder entfernt, bezeugt ein im Jahr 1871 von preußischen Heeresmathematikern errichteter Stein, daß sich
hier der geographische Mittelpunkt Europas befindet. Die Tschechoslowakei im Herzen Europas. Aber dieses Herz ist krank und kein Arzt weit und breit in Sicht, nur Kurpfuscher experimentieren an ihm herum. Die Rede Hu-säks anläßlich des 100. Geburtstages von Lenin — er prangte zwischen Würsten und Babykleidern, zwischen Cognacflaschen und Damenschuhen wochenlang in jedem Schaufenster — bewies es aufs neue. Der Kurpfuscher vermochte den Arzt nicht zu ersetzen.
Die Arbeiter in den Skoda-Werken haben in den letzten Wochen wenigstens aufs neue bewiesen, daß sie politisch sehr viel mündiger sind als die Abgesandten des ZK, die sie zu Unmündigen stempeln möchten. Höchstpersönlich kam ein leitender Mann zu einem Vorarbeiter, der seit 40 Jahren Mitglied der KP ist und nun im Zuge der „Umtauschaktion“ der Parteibücher befragt werden sollte. Der Mann lehnte es ab, in die Büroräume mitzukommen und erklärte unter dem Beifall der umstehenden Kollegen, daß er genau wisse, was richtig sei, und darum hiermit sein Parteibuch zurückgebe.
Er kann es sich leisten, auf ihn kann der Arbeiter- und Bauernstaat auch jetzt nicht verzichten, die Angestellte der Prager Post, gleicher Inquisition mit aller Schärfe unterzogen, muß aus ihrem Herzen eine Mördergrube machen, will sie nicht ihre Arbeit verlieren.
Der Prager Ingenieur dort an dem Mahnmal der 1. Amerikanischen Armee kannte sich in der Diagnose der Herzkrankheit seines Staates so gut aus wie sein Gesprächspartner bus dem Westen: Stagnation auf allen Gebieten, Flucht in die Privatsphäre, Zunahme der Sittenverrohung. Wer ständig von oben gestoßen wird, verlernt es, mit dem Nächsten höflich umzugehen.
Die gewaltsame Befreiung von außen oder innen scheint auf lange Zeit ausgeschlossen zu sein. Befreiung von außen — immerhin hat der Westen keine Hand gerührt, als das letzte SOS aus Budapest vor 14 Jahren erklang. Niemand will mehr für die Freiheit der Unfreien sterben, wie es noch die Inschrift auf dem amerikanischen Mahnmal den Gefallenen aus den fernen USA bescheinigte. Auch das weiß man ohne Resignation.
Langsam spricht sich auch, nach dem anhaltenden Schock der Invasion, die Erkenntnis herum, daß nicht alle gegenwärtigen Übel der Anwesenheit der Besatzer anzulasten sind. Forcierter Export in die UdSSR? Den hat es auch vor 1968 gegeben. Verfälschung des abendländischen Auftrags der CSSR durch die ideologische Steuerung aus Moskau? Auch das ist nichts Neues. Aber gerade dieses letzte Phänomen, seit 25 Jahren, und nun zunehmend in den letzten Monaten wieder offizielles Leitbild der Politik, zeigt bereits die Möglichkeit einer Therapie an. Niemals zuvor in seiner Geschichte hat sich das Volk der Tschechen und Slowaken — sie sind jetzt trotz aller Unterschiede wirklich ein Volk — seiner Zugehörigkeit zum Westen so sicher gefühlt wie im Zeichen der gegenteiligen Propaganda. Das ist nicht einfach eine zähneknirschende Reaktion, sondern bewußte Aufnahme und Weiterverarbeitung eigener Kultur- und Bildungstradition, von Kaiser Karl IV. über Co-menius bis hin zu Jean Anouilh. Es ist deutlich: Die Therapie beschränkt sich vorerst auf das Bemühen, den Anschluß nicht zu verlieren. Die wirtschaftliche Stagnation wird dadurch so wenig beendet wie die zunehmende Proletarisierung der ehemaligen Kleinbürger, aber beide Übel und noch viele andere werden erträglicher, weil der Blutkreislauf des Patienten intakt ist. Daran wendet man alle Mühe, mit einem Bildungs- und Wissenshunger, der die Besucher aus dem Westen oft genug beschämt. Nur dadurch überwindet man vor allem das Minderwertigkeitsgefühl, auf wirtschaftlichem Gebiet hoffnungslos ins Hintertreffen geraten zu sein. Das Leben ist mehr als sein Standard.
Wer seit Jahren mit Tschechen und Slowaken zusammenlebt, bewundert immer aufs neue ihr savoir vivre, ihre Lebenskunst. Sie speist sich aus gänzlich verschiedenen Quellen. Die europäische Prophetie eines Come-nius steht dabei ebenso Pate wie die Heimattreue des Böhmen, die Lust am Erhabenen und nicht weniger der Hang zur Ausschweifung, völlige Säkularisierung hart neben schlichter Bauernfrömmigkeit. Das Gefälle von der Stadt zum bäuerlichen Dorf hat sich, trotz aller Proletarisierung des Bauern zum Kolchosarbeiter, besonders in der Slowakei erstaunlich gehalten. Stadt im strengen Sinn ist dabei eigentlich nur Prag; schon Brünn und Bratislava die Zentren Mährens und der Slowakei sind Provinz.
Die politischen Experimente des Hradschin haben daher den Charakter der Tschechen und Slowaken nur tangiert, aber nicht an der Wurzel verändert — sie ruht wohlverwahrt in größeren Tiefen und speist sich aus vielfältigen Quellen. Der Rausch der Ideologie, in dem die Deutschen der benachbarten DDR die angestammten Quellen verschmutzen und schließlich versanden lassen, ist den Menschen in der CSSR unheimlicher als die öffentlich geschmähten Erscheinungen des westlichen Lebens. Dessen Auswüchse, so meint man hier, lassen sich durch Vernunft und guten Willen korrigieren, aber gegen weltanschaulichen Fanatismus ist kein Kraut gewachsen. Die wenigen Unbelehrbaren in den eigenen Reihen zeigen es im übrigen, ohne daß man in die Ferne schweifen müßte.
Ganz gleich, wie sich die politischen und wirtschaftliche Zukunft der nächsten Jahre zeigen wird — ob die Bestandsaufnahme der tausend Übel zur Demokratisierung oder zu neuer Verschärfung führt: Die Seele dieses Volkes wird dabei ebensowenig Schaden leiden, wie sie es in dem nun mit viel Gepränge gefeierten Vierteljahrhundert tat. Das ist, vergleicht man die vielfältigen Krankheitssymptome etwa Polens, Ungarns und vor allem der DDR mit denen der CSSR, eine erfreuliche und trotz allem optimistisch stimmende Perspektive.
Freilich sind auch die Abnutzungserscheinungen im Umgang oder im Kampf mit oder gegen wesensfremde Doktrinen nicht zu übersehen. An erster Stelle ist hier das Bonzentum der Funktionäre und das Mitläufer-tum ihrer Trabanten zu nennen. So unpopulär sie sind, so allmächtig gebärden sie sich. Zur Lebenskunst gehört daher, sich mit ihnen gut zu stellen, ohne ihnen Reverenz zu erweisen.
Gleich danach rangiert die schwindende Arbeitsmoral, zumal der jüngeren Generation. Der Lohn reicht noch immer nicht zu wesentlichen Verbesserungen des Lebensstandards — also schont man seine Kräfte und spart sie für die Schwarzarbeit.
Die „gemeinsame Pflicht der sozialistischen Länder“ besteht forthin in der „Verteidigung der sozialistischen Errungenschaften“. Sollte in der UdSSR plötzlich eine „Konterrevolution“ ausbrechen, müßten also auch Truppen der CSSR von der Moldau nach Moskau entsandt werden. Die Brüderlichkeit hat ungeahnte Perspektiven bekommen.
Husaks vielgepriesene „Konsolidierung“ aber trägt ihrem Urheber jetzt Zinsen. In den Händen seiner Clique ist nach einjährigem Großreinemachen kein Abtrünniger mehr zu befürchten.
Doch die Geschichte wird nicht nur mit Panzern und Okkupationen, sondern auch mit dem Blut der Märtyrer geschrieben. Das Grab Jan Pallachs war in diesen Tagen, wie lange nicht mehr, Ziel Tausender, die Lichter auf dem Hügel trotzten selbst den scharfen Frühlingswinden, die über den Friedhof tosten. Alexander Dubieks Bilder sind nicht nur in den Herzen fest verwahrt, sie sind in Zehntausenden von Stuben mit Blumen geschmückt.
Schnell hat der Volksmund einen neuen Witz geschaffen und durch die ganze Republik geschleust — wehmütig und bei aller Resignation, doch tröstlich genug: Steht ein Zigeuner an der Westgrenze, tagelang und schaut gen Osten. Schließlich fragt ihn der Chef der Grenzstation: Was stehst du da und schaust nach Osten? Antwort: Ich warte, daß die Russen abziehen! Daraufhin der Offizier: Da hast du die erste feste Arbeit in deinem Leben gefunden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!