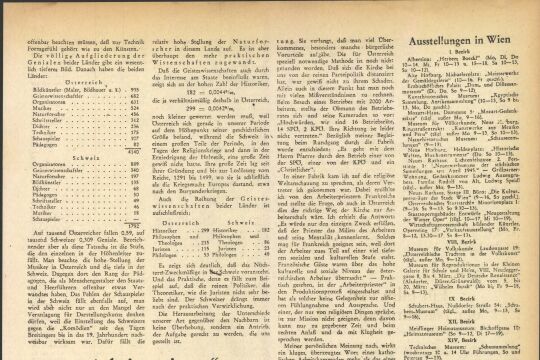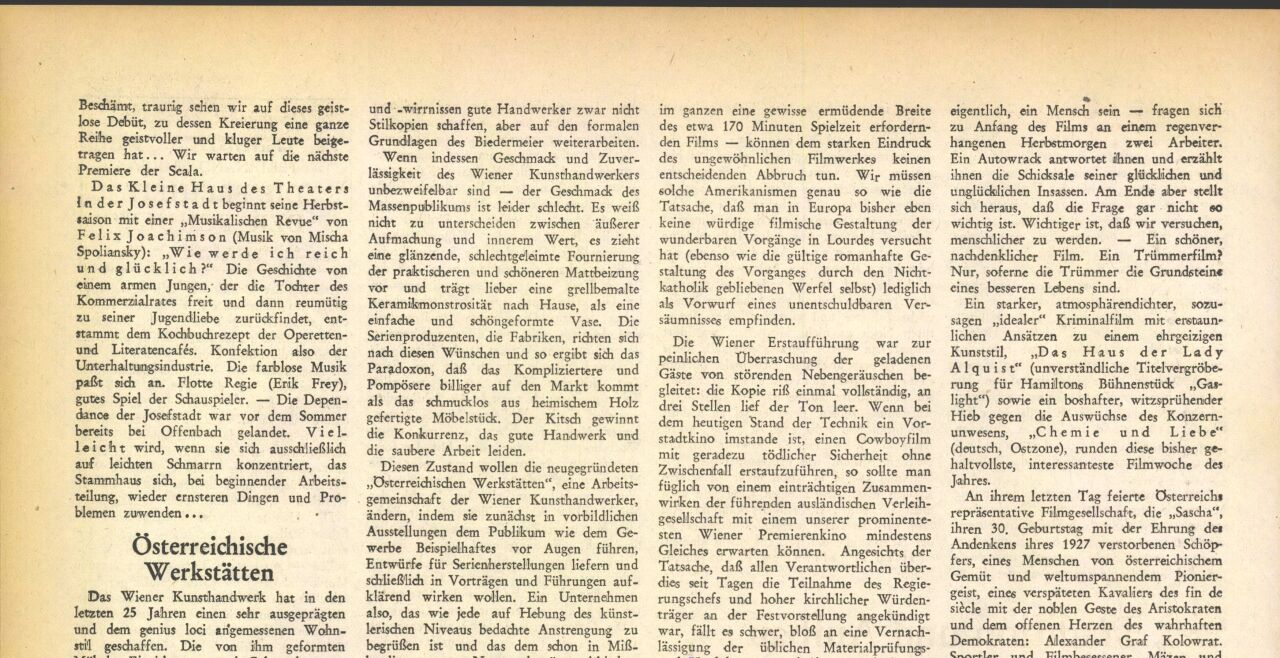
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Das Lied von Bernadette“
In dem Roman Franz Werfels „Das Lied von Bernadette“ tritt einer Epoche des Suchens und Sich-Verlierens ein Dokument von einzigartiger Gläubigkeit und Lauterkeit entgegen. Es ist in der leiblichen Gefahr der Flucht gelobt, in der geistigen Not der Verbannung begonnen und im Kampf um die allerletzte seelische Entscheidung, den Franz Werfel nicht zu Ende bestanden hat, vollendet worden. Dieses wohl für Millionen gültige, im Grunde aber doch einmalige persönliche Erlebnis durch den technischen Filter des Films hindurch zu bewahren, war ein unlösliches Unterfangen. Trotzdem stehen wir erstaunt und bewundernd vor dem großartigen Kompromiß, das der gleichnamige Hollywood-Film darstellt.
„Für die, die glauben, ist eine Erklärung nicht notwendig, für die, die nicht glauben, ist eine Erklärung nicht möglich.“ Mit diesem Motto des Eingangstitels, das in der Wiener Aufführung ein persönlicher Vorspruch von Dr. Diego Götz deutete, zieht der Film in bitter-kluger Selbstbescheidung selbst die Grenzen seines Wirkungsbereiches. Denn Werfel meinte mehr, wollte mehr: sein Schriftsteller Hyacinthe de Lafite, der im Film bezeichnenderweise fehlt, beziehungsweise in der Gestalt des Staatsanwalts in einen konturenlosen Schatten auseinanderfließt, ist nämlich unverkennbar der aufgerufene Nichtgläubige: der Dichter selbst. Und hinter ihm ein Jahrhundert der Skepsis. Diesen Aufruf kann der Film nicht wagen, wird er als Synthese von Schöpfung, Mechanik und Spekulation niemals können. Darum muß ter sich vornehmlich, wenn nicht ausschließlich an die, die glauben, wenden. Als ob er geahnt hätte, daß den Kritiker einer Wiener Alliiertenpresse die Stimmung einer würdigen Premiere lediglich zu Ausfällen von beispielloser Zuchtlosigkeit gegen den
„Massenbetrieb von Lourdes, die Heilbaderei in der Segensquelle und den Kult des ,wundertätigen' Madonnenbildes" reizen werde…
Die anderen, die glauben, werden tief berührt mit dem 14jährigen Müllerskind Bernadette Soubirous den Weg aus der ärmlichen elterlichen Hütte in die Grotte von Massabielle gehen, wo ihm die Erscheinung der Immakulata an 15 (historisch 18) Tagen erklärt, sie wolle hier Leute sehen und eine Kapelle haben; den Weg über die schwere Prüfung seitens der verständlicherweise vorerst ablehnenden und erst nach jahrelanger gewissenhafter Prüfung zustimmenden kirchlichen Behörden in das demutvolle, von tödlicher Krankheit beschattete Leben als Schwester Maria Bernarde bis zu ihrem Tod.
So hingegeben auch Regie, Kamera und Musik um die „Dichtung“ (im Ursinn des Wortes) des schwierigen Stoffes bemüht waren: die intensivste Gläubigkeit geht doch vom Spiel der blutjungen, neuentdeckten Darstellerin aus. Ihr gelingt als Künstlerin für sich und in der überzeugenden Formung der historischen Gestalt, was der Prologus des Films den Sieg des Kindlichen über die naturbedingte Abwehr des Physischen beim Zusammenstoß mit dem Übernatürlichen nannte. Dieses durchaus unschöne Antlitz hat Momente, wo es von innen her zu leuchten anfängt. Seinem schatten- und lichtersprühenden, Zweifel und Vertrauen, Not und Verzückung ausstrahlenden Mienenspiel hätte ein europäisches Publikum ohne Schwierigkeit die Wirkung der übernatürlichen Erscheinung auch ohne den überdeutlichen amerikanischen Effekt der Erscheinung selbst abgelesen, ganz abgesehen von dem schweren Verstoß gegen die Logik der Dramaturgie, die ja die Erscheinung immer nur von dem Mädchen allein, also auch nicht vom Zuschauer erblickt, fordert! Dieser wie einige andere Einwände — die unzulängliche Begründung der „Verweisung“ Bernadettes in das Kloster, die romantisierende Sterbeszene sowie im ganzen eine gewisse ermüdende Breite des etwa 170 Minuten Spielzeit erfordernden Films — können dem starken Eindruck des ungewöhnlichen Film Werkes keinen entscheidenden Abbruch tun. Wir müssen solche Amerikanismen genau so wie die Tatsache, daß man in Europa bisher eben keine würdige filmische Gestaltung der wunderbaren Vorgänge in Lourdes versucht hat (ebenso wie die gültige romanhafte Gestaltung des Vorganges durch den Nichtkatholik gebliebenen Werfel selbst) lediglich als Vorwurf eines unentschuldbaren Versäumnisses empfinden.
Die Wiener Erstaufführung war zur peinlichen Überraschung der geladenen Gäste von störenden Nebengeräuschen begleitet: die Kopie riß einmal vollständig, an drei Stellen lief der Ton leer. Wenn bei dem heutigen Stand der Technik ein Vorstadtkino imstande ist, einen Cowboyfilm mit geradezu tödlicher Sicherheit ohne Zwischenfall erstaufzuführen, so sollte man füglich von einem einträchtigen Zusammenwirken der führenden ausländischen Verleihgesellschaft mit einem unserer prominentesten Wiener Premierenkino mindestens Gleiches erwarten können. Angesichts der Tatsache, daß allen Verantwortlichen überdies seit Tagen die Teilnahme des Regierungschefs und hoher kirchlicher Würdenträger an der Festvorstellung angekündigt war, fällt es schwer, bloß an eine Vernachlässigung der üblichen Materialprüfungis- und Vorführungsvorschriften zu glauben.
„In jenen Tagen“ (deutsch, Westzone) ist der beinahe geglückte Versuch, die Tragödie der Jahre vor 1945 in aphoristische Blitzlichter aufzulösen, bittere und gescheite, düstere und bejahende. Was ist das eigentlich, ein Mensch sein — fragen sich zu Anfang des Films an einem regenverhangenen Herbstmorgen zwei Arbeiter. Ein Autowrack antwortet ihnen und erzählt ihnen die Schicksale seiner glücklichen und unglücklichen Insassen. Am Ende aber stellt sich heraus, daß die Frage gar nicht so wichtig ist. Wichtiger ist, daß wir versuchen, menschlicher zu werden. — Ein schöner, nachdenklicher Film. Ein Trümmerfilm? Nur, soferne die Trümmer die Grundstein eines besseren Lebens sind.
Ein starker, atmosphärendichter, sozusagen „idealer" Kriminalfilm mit erstaunlichen Ansätzen zu einem ehrgeizigen Kunststil, „Das Haus der Lady Alquist“ (unverständliche Titelvergröberung für Hamiltons Bühnenstück „Gaslight“) sowie ein boshafter, witzsprühender Hieb gegen die Auswüchse des Konzernunwesens, „C hemie und Liebe" (deutsch, Ostzone), runden diese bisher gehaltvollste, interessanteste Filmwoche des Jahres.
An ihrem letzten Tag feierte Österreichs repräsentative Filmgesellschaft, die „Sascha", ihren 30. Geburtstag mit der Ehrung des Andenkens ihres 1927 verstorbenen Schöpfers, eines Menschen von österreichischem Gemüt und weltumspannendem Pioniergeist, eines verspäteten Kavaliers des fin de siede mit der noblen Geste des Aristokraten und dem offenen Herzen des wahrhaften Demokraten: Alexander Graf Kolowrat. Sportler und Filmbesessener, Mäzen und Enthusiast, Erlaucht und Dufreund der Chauffeure, Beleuchter und Operateure: ein Mensch, ein Mann. „Ich werde nimmer seinesgleichen sehn." Was ist das eigentlich, ein Mensch sein? Ach, laß! Wichtiger ist, daß wir versuchen, menschlicher zu werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!