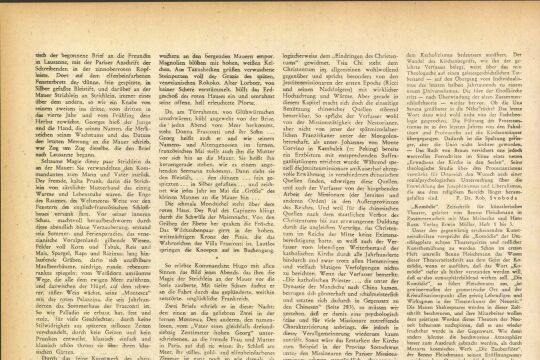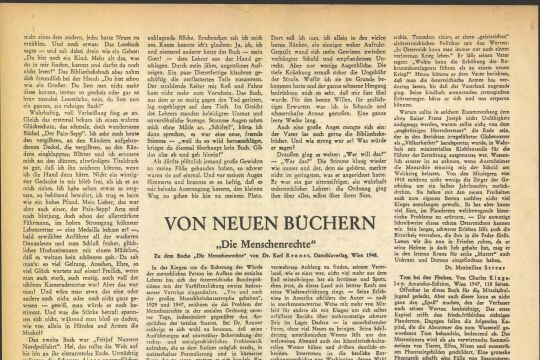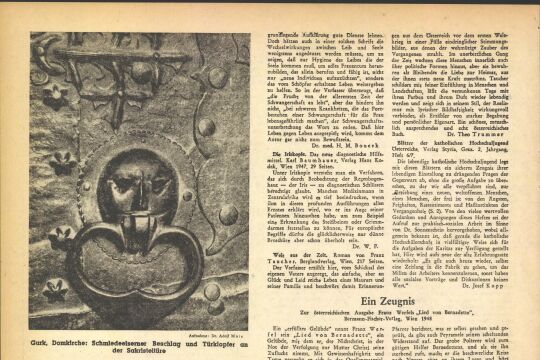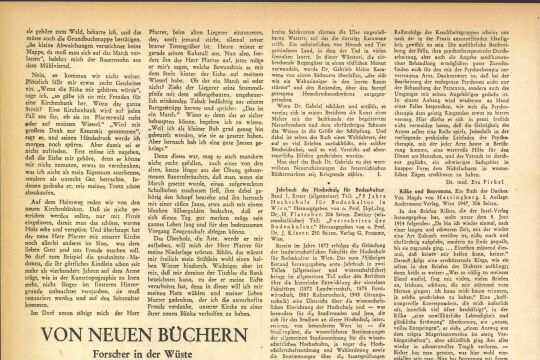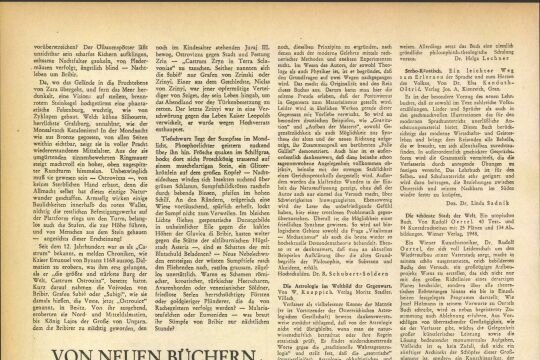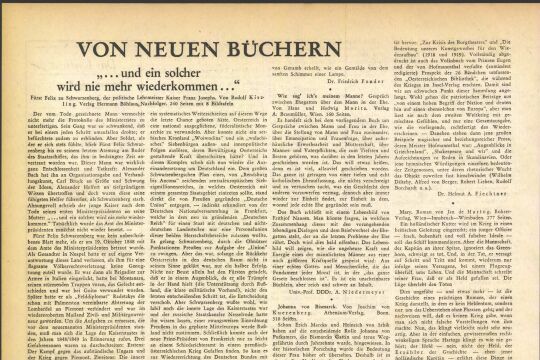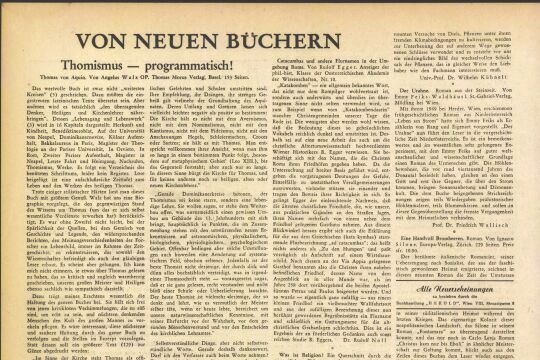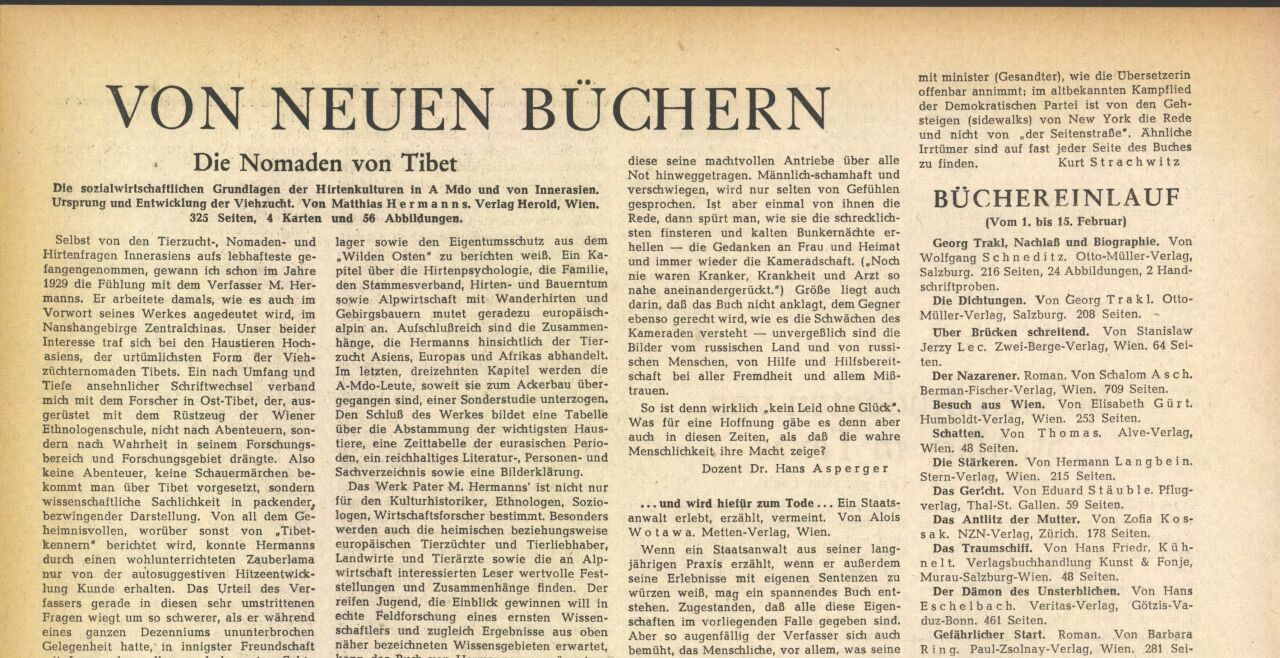
Selbst von den Tierzucht-, Nomaden- und Hirtenfragen Innerasiens aufs lebhafteste gefangengenommen, gewann idi schon im Jahre 1929 die Fühlung mit dem Verfasser M. Hermanns. Er arbeitete damals, wie es auch im Vorwort seines Werkes angedeutet wird, im Nanshangebirge Zentraldiinas. Unser beider Interesse traf sich bei den Haustieren Hochasiens, der urtümlichsten Form der Viehzüchternomaden Tibets. Ein nach Umfang und Tiefe ansehnlicher Schriftwechsel verband mich mit dem Forscher in Ost-Tibet, der, ausgerüstet mit dem Rüstzeug der Wiener Ethnologenschule, nicht nach Abenteuern, sondern nach Wahrheit in seinem Forschungsbereich und Forschungsgebiet drängte. Also keine Abenteuer, keine Schauermärchen bekommt man über Tibet vorgesetzt, sondern wissenschaftliche Sachlichkeit in packender, bezwingender Darstellung. Von all dem Geheimnisvollen, worüber sonst von „Tibetkennern“ berichtet wird, konnte Hermanns durch einen wohlunterrichteten Zauberlama nur von der autosuggestiven Hitzeentwicklung Kunde erhalten. Das Urteil des Verfassers gerade in diesen sehr umstrittenen Fragen wiegt um so schwerer, als er während eines ganzen Dezenniums ununterbrochen Gelegenheit hatte, in innigster Freundschaft mit Lamas der gelben und der roten Sekte selbst über die intimsten Fragen der Tibeter Gedankenaustausch zu pflegen, und zwar in chinesischer und tibetischer Sprache. Diese Voraussetzungen haben nach Hermanns viele Bücherschreiber über Tibet nicht erfüllt. Sprachkenntnisse, wissenschaftliche Schulung auf breitester Grundlage und ein natürliches, taktvolles Einfühlungsvermögen bahnten dem Forscher Hermanns die Wege zur Erkenntnis und zum Verständnis des Nomadenlebens auf dem „Dach der Welt“. Was er uns daher vorzulegen hat als ersten Band eines Werkes über „Die Nomaden von Tibet“ ist einzigartig, neu und echt.
Im ersten Hauptteil werden die geographischen, klimatischen, vorgeschichtlichen und geschichtlichen Grundlagen aufgezeigt, die zur Bildung der A-Mdo-Leute führten. Ihre Wirtschaft, Wohnung (Zelt), Kleidung, Schmuck, Waffen und Nahrung sowie die Handwerke bilden für das Hauptthema sozusagen die Einleitung. Bedeutend, vor allem auch für uhsere Landwirte, sind die Kapitel über die Viehzucht. Sie ist es ja, die das ganze Sinnen und Trachten, das Leben der Tibetnomaden beherrscht. Hermanns erweist sich bei der Erfassung der Kriterien als ausgezeichneter, vorurteilsfreier und feiner Beobachter,- der in klarer, scharfer Analyse das Wesentliche erkennt und herausstellt. In der Abhandlung über die Schafzucht konnte er die von H. F. Wallace 1913 gemachte Feststellung bestätigen, daß bei den osttibetanischen Nomaden inselhaft, gar nicht eigentlich nach Osttibet gehörig, noch ein Schaf vorkommt, ganz ähnlich dem ungarischen Rackaschaf der Pußta. Unverkennbar eigenartig in seinem Gehörn, als einziges Dürrschwanzschaf inmitten der weitverbreiteten Fettsteißschafe Hochasiens, schlägt dieses Schaf die Brücke zwischen Tibetnomaden und Ungarn. Schlaglichtartig beleuchtet es die großen Völkerbewegungen, die teils in vorgeschichtlicher, teils in geschichtlicher Zeit über Eurasien fluteten und gelegentlich auch Vorder- und Hochasien erfaßten. Ein anderes derartiges „Haustierfossü“ oder, besser gesagt, „Leitfossil“, noch lebend als Haustier, bereits von dem russischen Forscher Przewalskij erwähnt, wird ebenfalls von Hermanns in seiner Sonderstellung erkannt, nämlich das Fettschwanzschaf vom Nän-Shan-Gebirge; es ist ein typischer Vertreter der Vorderasienschafe und kann nur mit Völkerwellen aus diesem Bereich nach Zentraldiina gelangt sein. Hermanns klärt diese Frage sehr eindeutig. Er erkennt im Gegensatz zur bisherigen Auffassung die Schaf- und Ziegenzucht als die ältesten Formen der Haustiere, während er die Pferde- und Rentierzucht verhältnismäßig jung ansetzt.
Neu und einzigartig hat Hermanns die Yakzucht der A-Mdo-Nomaden und angrenzender Gebiete behandelt. Es ist ihm durchaus beizupflichten, wenn er den Ursprung nicht in Tibet, sondern weiter westlich in Pamir-Hindu-kush, sieht. So ist es auch zwanglos verständlich, daß die Verbreitung einerseits über den Altai, die Mongolei, das Baikalgebiet reicht, wo der Yak schon prähistorisch zu fassen ist, bis in die Mandschurei, andererseits die südliche Route über den Tjen Shan, Kuen Lun, ins Isaidam- und Koku-Nor-Gebiet nimmt, um von hier aus die höchstgelegenen Weidegründe Tibets zu erreichen, beziehungsweise aus dem Wildbestand zur Zucht anzuregen.
Für die besondere Artung unserer Wir-schaftsverhältnisse in Osterreich dürfte sehr aufschlußreich sein, was Hermanns über die. Weidebesitzrechte, Allmenden und Winterlager sowie den Eigentumsschutz aus dem „Wilden Osten“ zu berichten weiß. Ein Kapitel über die Hirtenpsychologie, die Familie, den Stammesverband, Hirten- und Bauerntum sowie Alpwirtschaft mit Wanderhirten und Gebirgsbauern mutet geradezu europäischalpin an. Aufschlußreich sind die Zusammenhänge, die Hermanns hinsichtlich der Tierzucht Asiens, Europas und Afrikas abhandelt. Im letzten, dreizehnten Kapitel werden die A-Mdo-Leute, soweit sie zum Ackerbau übergegangen sind, einer Sonderstudie unterzogen. Den Schluß des Werkes bildet eine Tabelle über die Abstammung der wichtigsten Haustiere, eine Zeittabelle der eurasischen Perioden, ein reichhaltiges Literatur-, Personen- und Sachverzeichnis sowie eine Bilderklärung.
Das Werk Pater M. Hermanns' ist nicht nur für den Kulturhistoriker, Ethnologen, Soziologen, Wirtschaftsforscher bestimmt. Besonders werden auch die heimischen beziehungsweise europäischen Tierzüchter und Tierliebhaber, Landwirte und Tierärzte sowie die an Alpwirtschaft interessierten Leser wertvolle Feststellungen und Zusammenhänge finden. Der reifen Jugend, die Einblick gewinnen will in echte Feldforschung eines ernsten Wissenschaftlers und zugleich Ergebnisse aus oben näher bezeichneten Wissensgebieten erwartet, kann das Buch von Hermanns nur wärmstens empfohlen werden. Der Verlag hat dem Werk eine sehr schöne Ausstattung angedeihen lassen.
Univ.-Prof. Dr. Joh. Wolfg. Amschler
Arzt in Stalingrad. Von Hans D i b o 1 d. Otto-Müller-Verlag, Salzburg.
Das klarste und größte Zeugnis über den letzten Krieg wird Dibolds Buch bilden. Nicht, oder nicht hauptsächlich aus dem Grund, weil es in Stalingrad spielt, welcher Name stets mit dem Höhepunkt und der Peripetie dieses Krieges verbunden bleiben wird — das Geschehen von Dibolds Buch setzt ein, als die Kapitulation beschlossen, die Schlachtentschei-dung also bereits gefallen ist —, sondern weil hier ein Maß von menschlichem Leid geschildert wird, das keine Dichtung je zu erfinden wagte, das unvorstellbar ist, aber doch in Wirklichkeit erlitten werden mußte.
All das Geschehen wird in einer Sprache gesagt, die Größe hat und doch fast karg zu nennen ist; nur so sind ja solche Dinge, wie sie hier geschildert werden, ertragbar. Es ist die Sprache des Arztes, der mit unerbittlicher Schärfe die Dinge sieht, wie sie sind; doch dahinter steht der Wille zu helfen aus den letzten Kräften, die gleichzeitig auch den Arzt selber halten und erhalten: indem der Mensch, der Arzt sidi restlos ausgibt, wird er durch diese seine machtvollen Antriebe über alle Not hinweggetragen. Männlich-schamhaft und verschwiegen, wird nur selten von Gefühlen gesprochen. Ist aber einmal von ihnen die Rede, dann spürt man, wie sie die schrecklichsten finsteren und kalten Bunkernächte erhellen — die Gedanken an Frau und Heimat und immer wieder die Kameradschaft. („Noch nie waren Kranker, Krankheit und Arzt so nahe aneinandergerückt.“) Größe liegt auch darin, daß das Buch nicht anklagt, dem Gegner ebenso gerecht wird, wie es die Schwächen des Kameraden versteht — unvergeßlich sind die Bilder vom russischen Land und von russischen Menschen, von Hilfe und Hilfsbereitschaft bei aller Fremdheit und allem Mißtrauen.
So ist denn wirklich „kein Leid ohne Glück“. Was für eine Hoffnung gäbe es denn aber auch in diesen Zeiten, als daß die wahre Menschlichkeit ihre Macht zeige?
Dozent Dr. Hans Asperger
... und wird hiefür zum Tode ... Ein Staatsanwalt erlebt, erzählt, vermeint. Von Alois W o t a w a. Metten-Verlag, Wien.
Wenn ein Staatsanwalt aus seiner langjährigen Praxis erzählt, wenn er außerdem seine Erlebnisse mit eigenen Sentenzen zu würzen weiß, mag ein spannendes Buch entstehen. Zugestanden, daß alle diese Eigenschaften im vorliegenden Falle gegeben sind. Aber so augenfällig der Verfasser sich auch bemüht, das Menschliche, vor allem, was seine Person betrifft, in den Vordergrund zu rücken, so sehr bleibt doch ein letzter leiser Rest des Mißtrauens in uns zurück. Werk und Verfasser können nun einmal nicht voneinander getrennt werden, und die Stellung, die Doktor Wotawa als Senatsvorsitzender beim Sondergericht innehatte, ist noch nicht vergessen, auch wenn sich der Verfasser in schöner Selbsteinschätzung als „der unerbitterliche Staatsanwalt gegen wirkliche Verbrecher und Gemeinschädlinge und der stets nachsichtige Anwalt armselig Gestrauchelter“ bezeichnet. Es ist schön, wenn aus einem Saulus ein Paulus wird, doch müßte, damit man an diese Wandlung glauben kann, denn doch mit mehr Bekennermut an die Wurzel des Übels herangegangen werden. Nicht zu unserer Freude — wer könnte sich über seines Bruders Fehl freuen? —, nein, zur Ehre seines inneren Menschen wollten wir es einmal hören, dieses: „Vater, auch ich habe gefehlt, vergib mir die Schuld, wie ich den anderen vergebe . ..“ tAber diese Tiefe des menschlichsten aller Bekenntnisse mangelt dem Buch. Sein Verfasser überschreitet keineswegs den Rahmen eines amüsanten Plaudertons, der nur gegen das Ende zu, gleichsam im Vorübergehen, kurz an das grausige Inferno der Hinrichtungsszenen streift. Für einen Staatsanwalt, der die Zeit namenlosen menschlichen Leides, die Zeit der deutschen Sondergerichte, mittätig erlebte, denn doch etwas zu wenig.